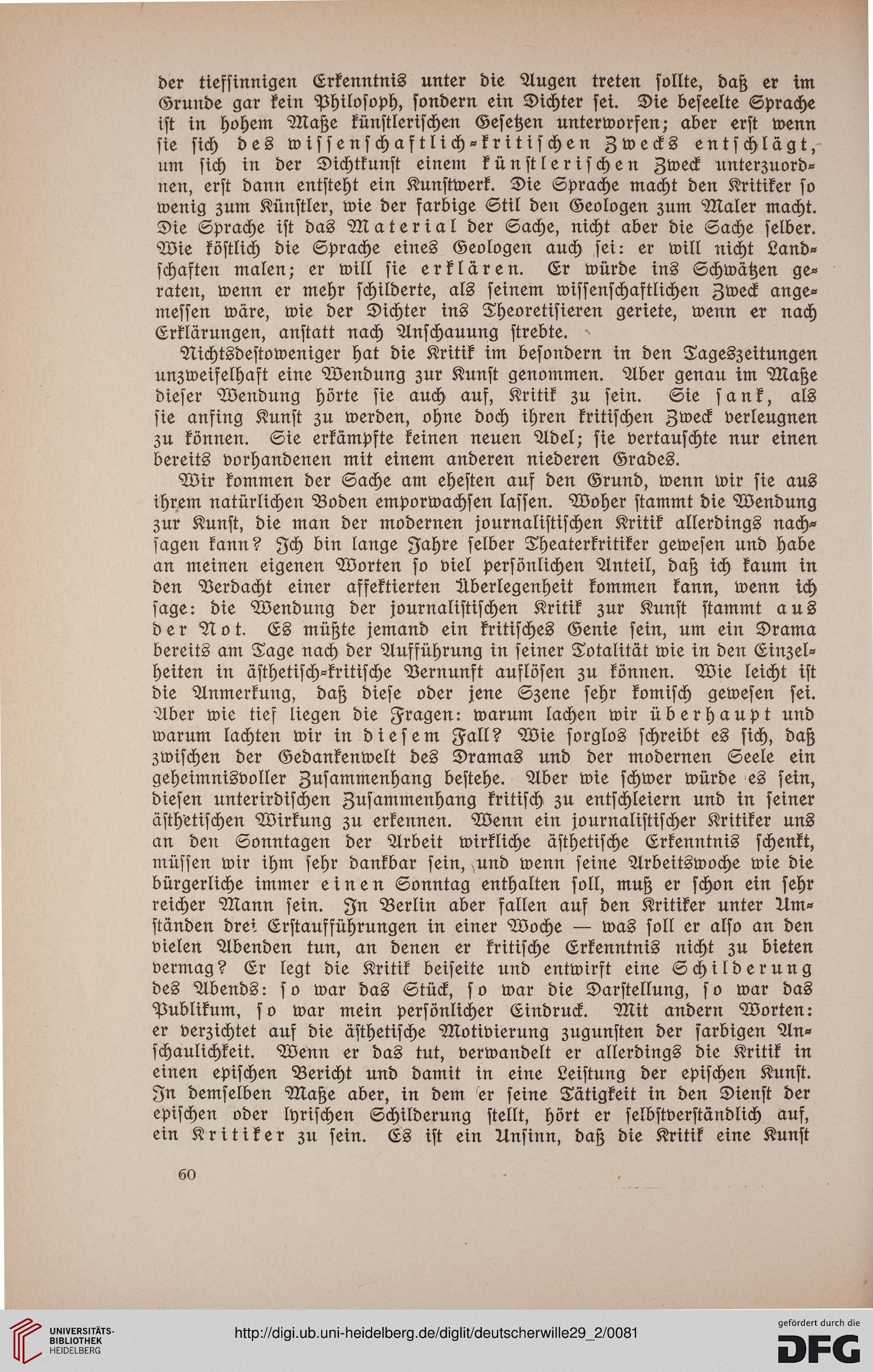der tiefsinnigen Erkenntnis unter die Augen treten sollte, daß er im
Grunde gar kein Philosoph, sondern ein Dichter sei. Die beseelte Sprache
ist in hohem Maße künstlerischen Gesetzen unterworfen; aber erst wenn
sie sich des wissenschaftlich-kritischen Zwecks entschlägt,
um sich in der Dichtkunst einem künstlerischen Zweck unterzuord«
nen, erst dann entsteht ein Kunstwerk. Die Sprache macht den Kritiker so
wenig zum Künstler, wie der farbige Stil den Geologen zum Maler macht.
Die Sprache ist das Material der Sache, nicht aber die Sache selber.
Wie köstlich die Sprache eines Geologen auch sei: er will nicht Land«
schaften malen; er will sie erklären. Er würde ins Schwätzen ge-
raten, wenn er mehr schilderte, als seinem wissenschaftlichen Zweck ange-
messen wäre, wie der Dichter ins Theoretisieren geriete, wenn er nach
Erklärungen, anstatt nach Anschauung strebte. -
Mchtsdestoweniger hat die Kritik im besondern in den Tageszeitungen
unzweifelhaft eine Wendung zur Kunst genommen. Aber genau im Maße
dieser Wendung hörte sie auch auf, Kritik zu sein. Sie sank, als
sie anfing Kunst zu werden, ohne doch ihren kritischen Zweck verleugnen
zu können. Sie erkämpfte keinen neuen Adel; sie vertauschte nur einen
bereits vorhandenen mit einem anderen niederen Grades.
Wir kommen der Sache am ehesten auf den Grund, wenn wir sie aus
ihrem natürlichen Boden emporwachsen lassen. Woher stammt die Wendung
zur Kunst, die man der modernen journalistischen Kritik allerdings nach--
sagen kann? Ich bin lange Iahre selber Theaterkritiker gewesen und habe
an meinen eigenen Worten so viel persönlichen Anteil, daß ich kaum in
den Verdacht einer affektierten Äberlegenheit kommen kann, wenn ich
sage: die Wendung der journalistischen Kritik zur Kunst stammt aus
der Not. Es müßte jemand ein kritisches Genie sein, um ein Drama
bereits am Tage nach der Aufsührung in seiner Totalität wie in den Einzel-
heiten in ästhetisch-kritische Vernunft auflösen zu können. Wie leicht ist
die Anmerkung, daß diese oder jene Szene sehr komisch gewesen sei.
Aber wie tief liegen die Fragen: warum lachen wir überhaupt und
warum lachten wir in diesem Fall? Wie sorglos schreibt es sich, daß
zwischen der Gedankenwelt des Dramas und der modernen Seele ein
geheimnisvoller Zusammenhang bestehe. Aber wie schwer würde -es sein,
diesen unterirdischen Iusammenhang kritisch zu entschleiern und in seiner
ästhetischen Wirkung zu erkennen. Wenn ein journalistischer Kritiker uns
an den Sonntagen der Arbeit wirkliche ästhetische Erkenntnis schenkt,
müssen wir ihm sehr dankbar sein, ^und wenn seine Arbeitswoche wie die
bürgerliche immer einen Sonntag enthalten soll, muß er schon ein sehr
reicher Mann sein. In Berlin aber fallen auf den Kritiker unter Äm-
ständen drei Erstaufführungen in einer Woche — was soll er also an den
vielen Abenden tun, an denen er kritische Erkenntnis nicht zu bieten
vermag? Er legt die Kritik beiseite und entwirft eine Schilderung
des Abends: so war das Stück, so war die Darstellung, so war das
Publikum, so war mein persönlicher Eindruck. Mit andern Worten:
er verzichtet auf die ästhetische Motivierung zugunsten der sarbigen An-
schaulichkeit. Wenn er das tut, verwandelt er allerdings die Kritik in
einen epischen Bericht und damit in eine Leistung der epischen Kunst.
In demselben Maße aber, in dem er seine Tätigkeit in den Dienst der
epischen oder lyrischen Schilderung stellt, hört er selbstverständlich auf,
ein Kritiker zu sein. Es ist ein Unsinn, daß die Kritik eine Kunst
60
Grunde gar kein Philosoph, sondern ein Dichter sei. Die beseelte Sprache
ist in hohem Maße künstlerischen Gesetzen unterworfen; aber erst wenn
sie sich des wissenschaftlich-kritischen Zwecks entschlägt,
um sich in der Dichtkunst einem künstlerischen Zweck unterzuord«
nen, erst dann entsteht ein Kunstwerk. Die Sprache macht den Kritiker so
wenig zum Künstler, wie der farbige Stil den Geologen zum Maler macht.
Die Sprache ist das Material der Sache, nicht aber die Sache selber.
Wie köstlich die Sprache eines Geologen auch sei: er will nicht Land«
schaften malen; er will sie erklären. Er würde ins Schwätzen ge-
raten, wenn er mehr schilderte, als seinem wissenschaftlichen Zweck ange-
messen wäre, wie der Dichter ins Theoretisieren geriete, wenn er nach
Erklärungen, anstatt nach Anschauung strebte. -
Mchtsdestoweniger hat die Kritik im besondern in den Tageszeitungen
unzweifelhaft eine Wendung zur Kunst genommen. Aber genau im Maße
dieser Wendung hörte sie auch auf, Kritik zu sein. Sie sank, als
sie anfing Kunst zu werden, ohne doch ihren kritischen Zweck verleugnen
zu können. Sie erkämpfte keinen neuen Adel; sie vertauschte nur einen
bereits vorhandenen mit einem anderen niederen Grades.
Wir kommen der Sache am ehesten auf den Grund, wenn wir sie aus
ihrem natürlichen Boden emporwachsen lassen. Woher stammt die Wendung
zur Kunst, die man der modernen journalistischen Kritik allerdings nach--
sagen kann? Ich bin lange Iahre selber Theaterkritiker gewesen und habe
an meinen eigenen Worten so viel persönlichen Anteil, daß ich kaum in
den Verdacht einer affektierten Äberlegenheit kommen kann, wenn ich
sage: die Wendung der journalistischen Kritik zur Kunst stammt aus
der Not. Es müßte jemand ein kritisches Genie sein, um ein Drama
bereits am Tage nach der Aufsührung in seiner Totalität wie in den Einzel-
heiten in ästhetisch-kritische Vernunft auflösen zu können. Wie leicht ist
die Anmerkung, daß diese oder jene Szene sehr komisch gewesen sei.
Aber wie tief liegen die Fragen: warum lachen wir überhaupt und
warum lachten wir in diesem Fall? Wie sorglos schreibt es sich, daß
zwischen der Gedankenwelt des Dramas und der modernen Seele ein
geheimnisvoller Zusammenhang bestehe. Aber wie schwer würde -es sein,
diesen unterirdischen Iusammenhang kritisch zu entschleiern und in seiner
ästhetischen Wirkung zu erkennen. Wenn ein journalistischer Kritiker uns
an den Sonntagen der Arbeit wirkliche ästhetische Erkenntnis schenkt,
müssen wir ihm sehr dankbar sein, ^und wenn seine Arbeitswoche wie die
bürgerliche immer einen Sonntag enthalten soll, muß er schon ein sehr
reicher Mann sein. In Berlin aber fallen auf den Kritiker unter Äm-
ständen drei Erstaufführungen in einer Woche — was soll er also an den
vielen Abenden tun, an denen er kritische Erkenntnis nicht zu bieten
vermag? Er legt die Kritik beiseite und entwirft eine Schilderung
des Abends: so war das Stück, so war die Darstellung, so war das
Publikum, so war mein persönlicher Eindruck. Mit andern Worten:
er verzichtet auf die ästhetische Motivierung zugunsten der sarbigen An-
schaulichkeit. Wenn er das tut, verwandelt er allerdings die Kritik in
einen epischen Bericht und damit in eine Leistung der epischen Kunst.
In demselben Maße aber, in dem er seine Tätigkeit in den Dienst der
epischen oder lyrischen Schilderung stellt, hört er selbstverständlich auf,
ein Kritiker zu sein. Es ist ein Unsinn, daß die Kritik eine Kunst
60