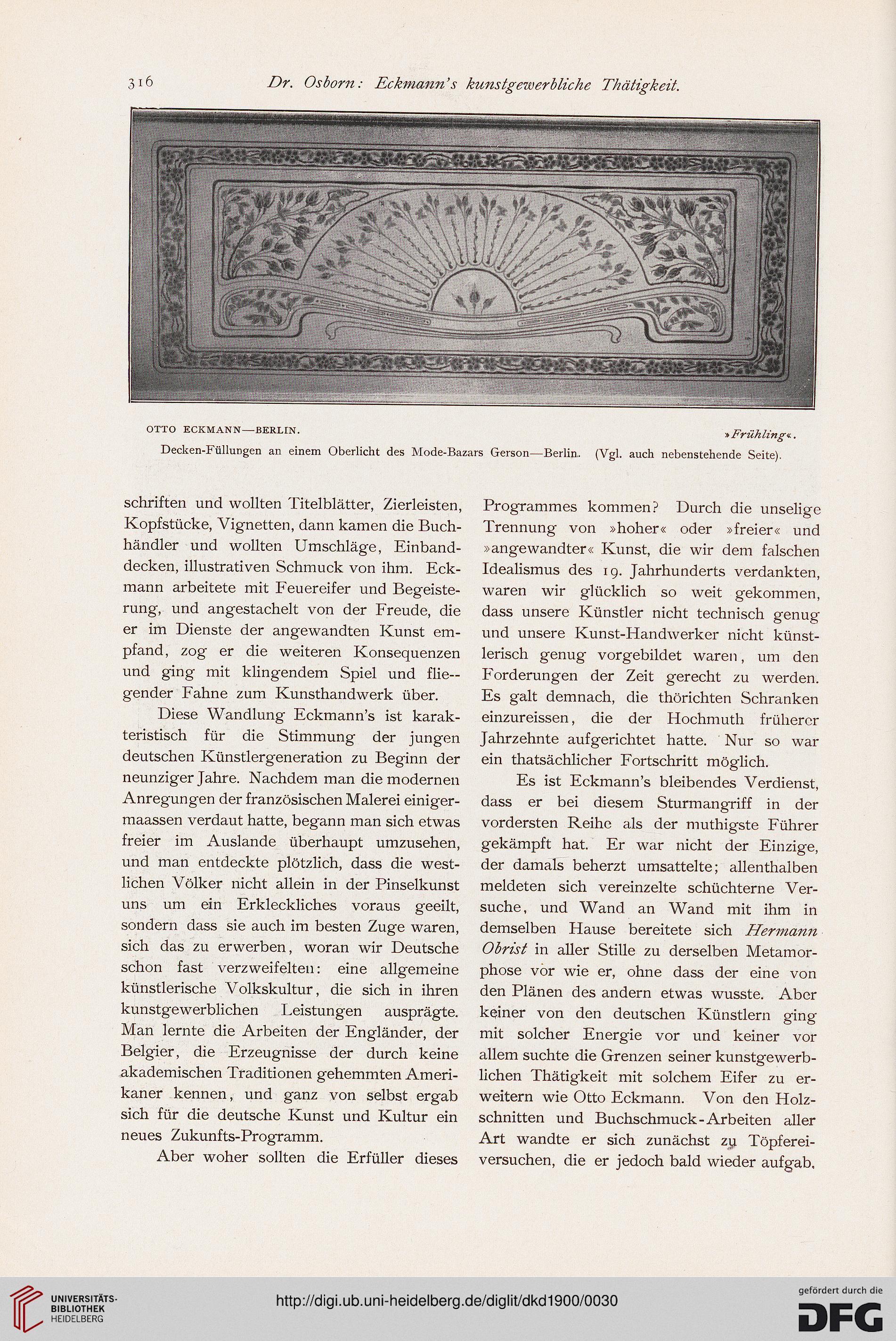3i6
Dr. Osborn: Eckmann's kunstgewerbliche Thätigkeit.
Schriften und wollten Titelblätter, Zierleisten,
Kopfstücke, Vignetten, dann kamen die Buch-
händler und wollten Umschläge, Einband-
decken, illustrativen Schmuck von ihm. Eck-
mann arbeitete mit Feuereifer und Begeiste-
rung, und angestachelt von der Freude, die
er im Dienste der angewandten Kunst em-
pfand, zog er die weiteren Konsequenzen
und ging mit klingendem Spiel und flie-
gender Fahne zum Kunsthandwerk über.
Diese Wandlung Eckmann's ist karak-
teristisch für die Stimmung der jungen
deutschen Künstlergeneration zu Beginn der
neunziger Jahre. Nachdem man die modernen
Anregungen der französischen Malerei einiger-
maassen verdaut hatte, begann man sich etwas
freier im Auslande überhaupt umzusehen,
und man entdeckte plötzlich, dass die west-
lichen Völker nicht allein in der Pinselkunst
uns um ein Erkleckliches voraus geeilt,
sondern dass sie auch im besten Zuge waren,
sich das zu erwerben, woran wir Deutsche
schon fast verzweifelten: eine allgemeine
künstlerische Volkskultur, die sich in ihren
kunstgewerblichen Leistungen ausprägte.
Man lernte die Arbeiten der Engländer, der
Belgier, die Erzeugnisse der durch keine
akademischen Traditionen gehemmten Ameri-
kaner kennen, und ganz von selbst ergab
sich für die deutsche Kunst und Kultur ein
neues Zukunfts-Programm.
Aber woher sollten die Erfüller dieses
Programmes kommen? Durch die unselige
Trennung von »hoher« oder »freier« und
»angewandter« Kunst, die wir dem falschen
Idealismus des ig. Jahrhunderts verdankten,
waren wir glücklich so weit gekommen,
dass unsere Künstler nicht technisch genug
und unsere Kunst-Handwerker nicht künst-
lerisch genug vorgebildet waren, um den
Forderungen der Zeit gerecht zu werden.
Es galt demnach, die thörichten Schranken
einzureissen, die der Hochmuth früherer
Jahrzehnte aufgerichtet hatte. Nur so war
ein thatsächlicher Fortschritt möglich.
Es ist Eckmann's bleibendes Verdienst,
dass er bei diesem Sturmangriff in der
vordersten Reihe als der muthigste Führer
gekämpft hat. Er war nicht der Einzige,
der damals beherzt umsattelte; allenthalben
meldeten sich vereinzelte schüchterne Ver-
suche, und Wand an Wand mit ihm in
demselben Hause bereitete sich Hermann
Obrist in aller Stille zu derselben Metamor-
phose vor wie er, ohne dass der eine von
den Plänen des andern etwas wusste. Aber
keiner von den deutschen Künstlern ging
mit solcher Energie vor und keiner vor
allem suchte die Grenzen seiner kunstgewerb-
lichen Thätigkeit mit solchem Eifer zu er-
weitern wie Otto Eckmann. Von den Holz-
schnitten und Buchschmuck-Arbeiten aller
Art wandte er sich zunächst zu Töpferei-
versuchen, die er jedoch bald wieder aufgab.
Dr. Osborn: Eckmann's kunstgewerbliche Thätigkeit.
Schriften und wollten Titelblätter, Zierleisten,
Kopfstücke, Vignetten, dann kamen die Buch-
händler und wollten Umschläge, Einband-
decken, illustrativen Schmuck von ihm. Eck-
mann arbeitete mit Feuereifer und Begeiste-
rung, und angestachelt von der Freude, die
er im Dienste der angewandten Kunst em-
pfand, zog er die weiteren Konsequenzen
und ging mit klingendem Spiel und flie-
gender Fahne zum Kunsthandwerk über.
Diese Wandlung Eckmann's ist karak-
teristisch für die Stimmung der jungen
deutschen Künstlergeneration zu Beginn der
neunziger Jahre. Nachdem man die modernen
Anregungen der französischen Malerei einiger-
maassen verdaut hatte, begann man sich etwas
freier im Auslande überhaupt umzusehen,
und man entdeckte plötzlich, dass die west-
lichen Völker nicht allein in der Pinselkunst
uns um ein Erkleckliches voraus geeilt,
sondern dass sie auch im besten Zuge waren,
sich das zu erwerben, woran wir Deutsche
schon fast verzweifelten: eine allgemeine
künstlerische Volkskultur, die sich in ihren
kunstgewerblichen Leistungen ausprägte.
Man lernte die Arbeiten der Engländer, der
Belgier, die Erzeugnisse der durch keine
akademischen Traditionen gehemmten Ameri-
kaner kennen, und ganz von selbst ergab
sich für die deutsche Kunst und Kultur ein
neues Zukunfts-Programm.
Aber woher sollten die Erfüller dieses
Programmes kommen? Durch die unselige
Trennung von »hoher« oder »freier« und
»angewandter« Kunst, die wir dem falschen
Idealismus des ig. Jahrhunderts verdankten,
waren wir glücklich so weit gekommen,
dass unsere Künstler nicht technisch genug
und unsere Kunst-Handwerker nicht künst-
lerisch genug vorgebildet waren, um den
Forderungen der Zeit gerecht zu werden.
Es galt demnach, die thörichten Schranken
einzureissen, die der Hochmuth früherer
Jahrzehnte aufgerichtet hatte. Nur so war
ein thatsächlicher Fortschritt möglich.
Es ist Eckmann's bleibendes Verdienst,
dass er bei diesem Sturmangriff in der
vordersten Reihe als der muthigste Führer
gekämpft hat. Er war nicht der Einzige,
der damals beherzt umsattelte; allenthalben
meldeten sich vereinzelte schüchterne Ver-
suche, und Wand an Wand mit ihm in
demselben Hause bereitete sich Hermann
Obrist in aller Stille zu derselben Metamor-
phose vor wie er, ohne dass der eine von
den Plänen des andern etwas wusste. Aber
keiner von den deutschen Künstlern ging
mit solcher Energie vor und keiner vor
allem suchte die Grenzen seiner kunstgewerb-
lichen Thätigkeit mit solchem Eifer zu er-
weitern wie Otto Eckmann. Von den Holz-
schnitten und Buchschmuck-Arbeiten aller
Art wandte er sich zunächst zu Töpferei-
versuchen, die er jedoch bald wieder aufgab.