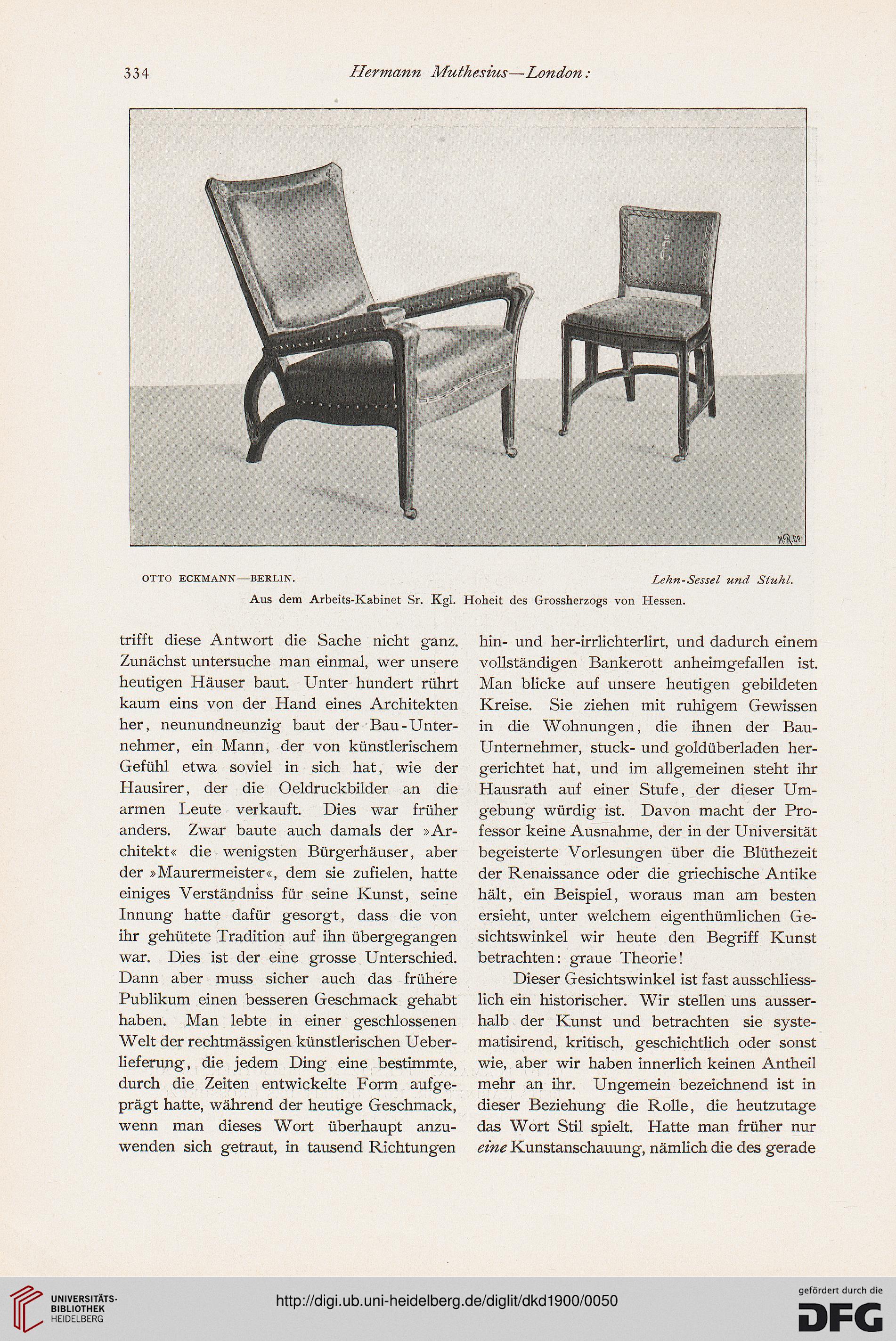334
Hermann Muthesius—London:
otto eckmann—berlin. Lehn-Sessel und Stuhl.
Aus dem Arbeits-Kabinet Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen.
trifft diese Antwort die Sache nicht ganz.
Zunächst untersuche man einmal, wer unsere
heutigen Häuser baut. Unter hundert rührt
kaum eins von der Hand eines Architekten
her, neunundneunzig baut der Bau-Unter-
nehmer, ein Mann, der von künstlerischem
Gefühl etwa soviel in sich hat, wie der
Hausirer, der die Oeldruckbilder an die
armen Leute verkauft. Dies war früher
anders. Zwar baute auch damals der »Ar-
chitekt« die wenigsten Bürgerhäuser, aber
der »Maurermeister«, dem sie zufielen, hatte
einiges Verständniss für seine Kunst, seine
Innung hatte dafür gesorgt, dass die von
ihr gehütete Tradition auf ihn übergegangen
war. Dies ist der eine grosse Unterschied.
Dann aber muss sicher auch das frühere
Publikum einen besseren Geschmack gehabt
haben. Man lebte in einer geschlossenen
Welt der rechtmässigen künstlerischen Ueber-
lieferung, die jedem Ding eine bestimmte,
durch die Zeiten entwickelte Form aufge-
prägt hatte, während der heutige Geschmack,
wenn man dieses Wort überhaupt anzu-
wenden sich getraut, in tausend Richtungen
hin- und her-irrlichterlirt, und dadurch einem
vollständigen Bankerott anheimgefallen ist.
Man blicke auf unsere heutigen gebildeten
Kreise. Sie ziehen mit ruhigem Gewissen
in die Wohnungen, die ihnen der Bau-
Unternehmer, stuck- und goldüberladen her-
gerichtet hat, und im allgemeinen steht ihr
Hausrath auf einer Stufe, der dieser Um-
gebung würdig ist. Davon macht der Pro-
fessor keine Ausnahme, der in der Universität
begeisterte Vorlesungen über die Blüthezeit
der Renaissance oder die griechische Antike
hält, ein Beispiel, woraus man am besten
ersieht, unter welchem eigenthümlichen Ge-
sichtswinkel wir heute den Begriff Kunst
betrachten: graue Theorie!
Dieser Gesichtswinkel ist fast ausschliess-
lich ein historischer. Wir stellen uns ausser-
halb der Kunst und betrachten sie syste-
matisirend, kritisch, geschichtlich oder sonst
wie, aber wir haben innerlich keinen Antheil
mehr an ihr. Ungemein bezeichnend ist in
dieser Beziehung die Rolle, die heutzutage
das Wort Stil spielt. Hatte man früher nur
eine Kunstanschauung, nämlich die des gerade
Hermann Muthesius—London:
otto eckmann—berlin. Lehn-Sessel und Stuhl.
Aus dem Arbeits-Kabinet Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen.
trifft diese Antwort die Sache nicht ganz.
Zunächst untersuche man einmal, wer unsere
heutigen Häuser baut. Unter hundert rührt
kaum eins von der Hand eines Architekten
her, neunundneunzig baut der Bau-Unter-
nehmer, ein Mann, der von künstlerischem
Gefühl etwa soviel in sich hat, wie der
Hausirer, der die Oeldruckbilder an die
armen Leute verkauft. Dies war früher
anders. Zwar baute auch damals der »Ar-
chitekt« die wenigsten Bürgerhäuser, aber
der »Maurermeister«, dem sie zufielen, hatte
einiges Verständniss für seine Kunst, seine
Innung hatte dafür gesorgt, dass die von
ihr gehütete Tradition auf ihn übergegangen
war. Dies ist der eine grosse Unterschied.
Dann aber muss sicher auch das frühere
Publikum einen besseren Geschmack gehabt
haben. Man lebte in einer geschlossenen
Welt der rechtmässigen künstlerischen Ueber-
lieferung, die jedem Ding eine bestimmte,
durch die Zeiten entwickelte Form aufge-
prägt hatte, während der heutige Geschmack,
wenn man dieses Wort überhaupt anzu-
wenden sich getraut, in tausend Richtungen
hin- und her-irrlichterlirt, und dadurch einem
vollständigen Bankerott anheimgefallen ist.
Man blicke auf unsere heutigen gebildeten
Kreise. Sie ziehen mit ruhigem Gewissen
in die Wohnungen, die ihnen der Bau-
Unternehmer, stuck- und goldüberladen her-
gerichtet hat, und im allgemeinen steht ihr
Hausrath auf einer Stufe, der dieser Um-
gebung würdig ist. Davon macht der Pro-
fessor keine Ausnahme, der in der Universität
begeisterte Vorlesungen über die Blüthezeit
der Renaissance oder die griechische Antike
hält, ein Beispiel, woraus man am besten
ersieht, unter welchem eigenthümlichen Ge-
sichtswinkel wir heute den Begriff Kunst
betrachten: graue Theorie!
Dieser Gesichtswinkel ist fast ausschliess-
lich ein historischer. Wir stellen uns ausser-
halb der Kunst und betrachten sie syste-
matisirend, kritisch, geschichtlich oder sonst
wie, aber wir haben innerlich keinen Antheil
mehr an ihr. Ungemein bezeichnend ist in
dieser Beziehung die Rolle, die heutzutage
das Wort Stil spielt. Hatte man früher nur
eine Kunstanschauung, nämlich die des gerade