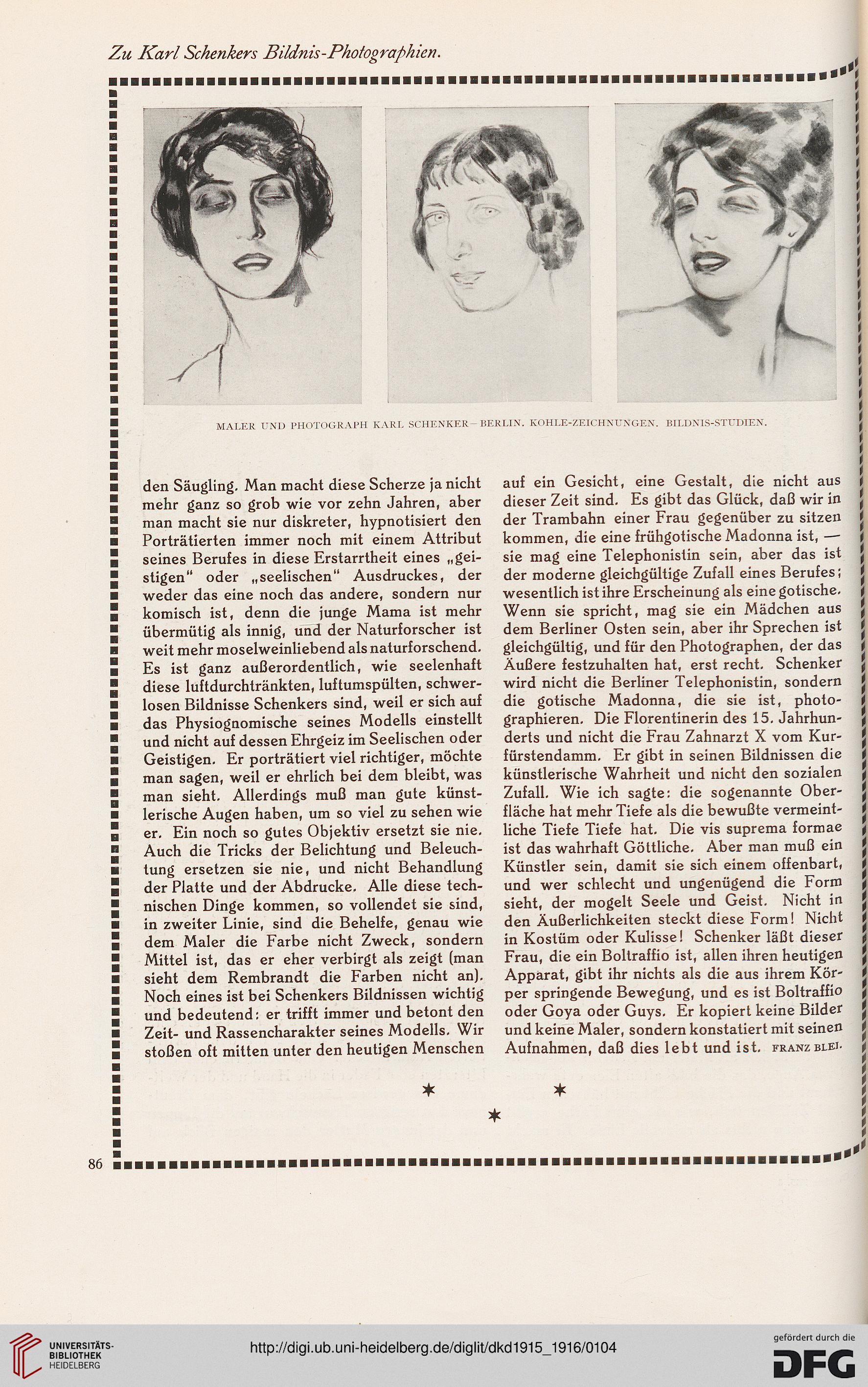den Säugling. Man macht diese Scherze ja nicht
mehr ganz so grob wie vor zehn Jahren, aber
man macht sie nur diskreter, hypnotisiert den
Porträtierten immer noch mit einem Attribut
seines Berufes in diese Erstarrtheit eines „gei-
stigen" oder „seelischen" Ausdruckes, der
weder das eine noch das andere, sondern nur
komisch ist, denn die junge Mama ist mehr
übermütig als innig, und der Naturforscher ist
weit mehr moselweinliebend als naturforschend.
Es ist ganz außerordentlich, wie seelenhaft
diese luftdurchtränkten, luftumspülten, schwer-
losen Bildnisse Schenkers sind, weil er sich auf
das Physiognomische seines Modells einstellt
und nicht auf dessen Ehrgeiz im Seelischen oder
Geistigen. Er porträtiert viel richtiger, möchte
man sagen, weil er ehrlich bei dem bleibt, was
man sieht. Allerdings muß man gute künst-
lerische Augen haben, um so viel zu sehen wie
er. Ein noch so gutes Objektiv ersetzt sie nie.
Auch die Tricks der Belichtung und Beleuch-
tung ersetzen sie nie, und nicht Behandlung
der Platte und der Abdrucke. Alle diese tech-
nischen Dinge kommen, so vollendet sie sind,
in zweiter Linie, sind die Behelfe, genau wie
dem Maler die Farbe nicht Zweck, sondern
Mittel ist, das er eher verbirgt als zeigt (man
sieht dem Rembrandt die Farben nicht an).
Noch eines ist bei Schenkers Bildnissen wichtig
und bedeutend: er trifft immer und betont den
Zeit- und Rassencharakter seines Modells. Wir
stoßen oft mitten unter den heutigen Menschen
auf ein Gesicht, eine Gestalt, die nicht aus
dieser Zeit sind. Es gibt das Glück, daß wir in
der Trambahn einer Frau gegenüber zu sitzen
kommen, die eine frühgotische Madonna ist, —■
sie mag eine Telephonistin sein, aber das ist
der moderne gleichgültige Zufall eines Berufes;
wesentlich ist ihre Erscheinung als eine gotische.
Wenn sie spricht, mag sie ein Mädchen aus
dem Berliner Osten sein, aber ihr Sprechen ist
gleichgültig, und für den Photographen, der das
Äußere festzuhalten hat, erst recht. Schenker
wird nicht die Berliner Telephonistin, sondern
die gotische Madonna, die sie ist, photo-
graphieren. Die Florentinerin des 15. Jahrhun-
derts und nicht die Frau Zahnarzt X vom Kur-
fürstendamm. Er gibt in seinen Bildnissen die
künstlerische Wahrheit und nicht den sozialen
Zufall. Wie ich sagte: die sogenannte Ober-
fläche hat mehr Tiefe als die bewußte vermeint-
liche Tiefe Tiefe hat. Die vis suprema formae
ist das wahrhaft Göttliche. Aber man muß ein
Künstler sein, damit sie sich einem offenbart,
und wer schlecht und ungenügend die Form
sieht, der mogelt Seele und Geist. Nicht in
den Äußerlichkeiten steckt diese Form! Nicht
in Kostüm oder Kulisse! Schenker läßt dieser
Frau, die ein Bollraffio ist, allen ihren heutigen
Apparat, gibt ihr nichts als die aus ihrem Kör-
per springende Bewegung, und es ist Boltraffio
oder Goya oder Guys. Er kopiert keine Bilder
und keine Maler, sondern konstatiert mit seinen
Aufnahmen, daß dies lebt und ist. franzblei-
* *
*
*
mehr ganz so grob wie vor zehn Jahren, aber
man macht sie nur diskreter, hypnotisiert den
Porträtierten immer noch mit einem Attribut
seines Berufes in diese Erstarrtheit eines „gei-
stigen" oder „seelischen" Ausdruckes, der
weder das eine noch das andere, sondern nur
komisch ist, denn die junge Mama ist mehr
übermütig als innig, und der Naturforscher ist
weit mehr moselweinliebend als naturforschend.
Es ist ganz außerordentlich, wie seelenhaft
diese luftdurchtränkten, luftumspülten, schwer-
losen Bildnisse Schenkers sind, weil er sich auf
das Physiognomische seines Modells einstellt
und nicht auf dessen Ehrgeiz im Seelischen oder
Geistigen. Er porträtiert viel richtiger, möchte
man sagen, weil er ehrlich bei dem bleibt, was
man sieht. Allerdings muß man gute künst-
lerische Augen haben, um so viel zu sehen wie
er. Ein noch so gutes Objektiv ersetzt sie nie.
Auch die Tricks der Belichtung und Beleuch-
tung ersetzen sie nie, und nicht Behandlung
der Platte und der Abdrucke. Alle diese tech-
nischen Dinge kommen, so vollendet sie sind,
in zweiter Linie, sind die Behelfe, genau wie
dem Maler die Farbe nicht Zweck, sondern
Mittel ist, das er eher verbirgt als zeigt (man
sieht dem Rembrandt die Farben nicht an).
Noch eines ist bei Schenkers Bildnissen wichtig
und bedeutend: er trifft immer und betont den
Zeit- und Rassencharakter seines Modells. Wir
stoßen oft mitten unter den heutigen Menschen
auf ein Gesicht, eine Gestalt, die nicht aus
dieser Zeit sind. Es gibt das Glück, daß wir in
der Trambahn einer Frau gegenüber zu sitzen
kommen, die eine frühgotische Madonna ist, —■
sie mag eine Telephonistin sein, aber das ist
der moderne gleichgültige Zufall eines Berufes;
wesentlich ist ihre Erscheinung als eine gotische.
Wenn sie spricht, mag sie ein Mädchen aus
dem Berliner Osten sein, aber ihr Sprechen ist
gleichgültig, und für den Photographen, der das
Äußere festzuhalten hat, erst recht. Schenker
wird nicht die Berliner Telephonistin, sondern
die gotische Madonna, die sie ist, photo-
graphieren. Die Florentinerin des 15. Jahrhun-
derts und nicht die Frau Zahnarzt X vom Kur-
fürstendamm. Er gibt in seinen Bildnissen die
künstlerische Wahrheit und nicht den sozialen
Zufall. Wie ich sagte: die sogenannte Ober-
fläche hat mehr Tiefe als die bewußte vermeint-
liche Tiefe Tiefe hat. Die vis suprema formae
ist das wahrhaft Göttliche. Aber man muß ein
Künstler sein, damit sie sich einem offenbart,
und wer schlecht und ungenügend die Form
sieht, der mogelt Seele und Geist. Nicht in
den Äußerlichkeiten steckt diese Form! Nicht
in Kostüm oder Kulisse! Schenker läßt dieser
Frau, die ein Bollraffio ist, allen ihren heutigen
Apparat, gibt ihr nichts als die aus ihrem Kör-
per springende Bewegung, und es ist Boltraffio
oder Goya oder Guys. Er kopiert keine Bilder
und keine Maler, sondern konstatiert mit seinen
Aufnahmen, daß dies lebt und ist. franzblei-
* *
*
*