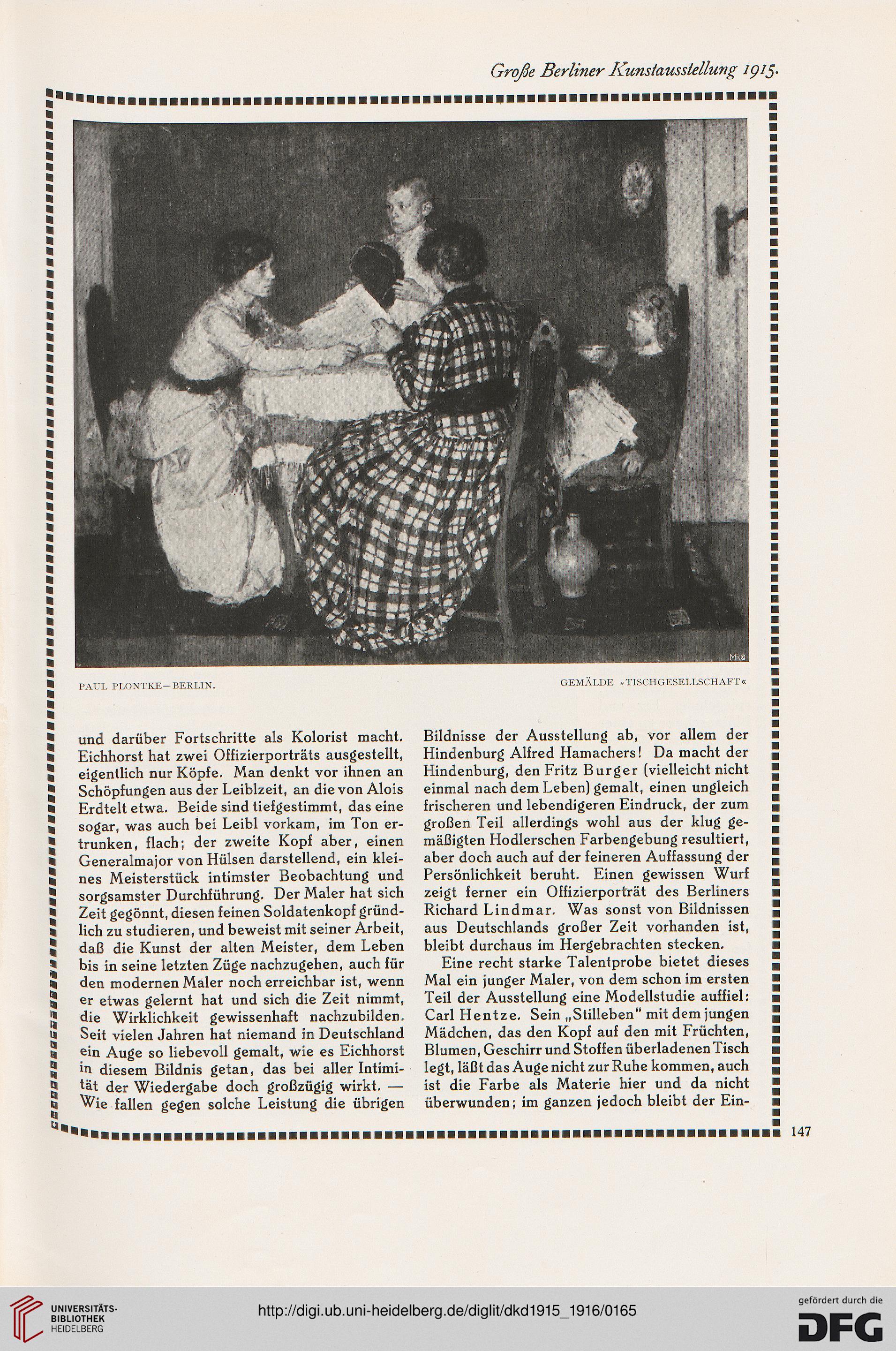Große Berliner Kunstausstellung ig
PAUL l'I.ONTKE- BERLIN.
GEMÄLDE »TISCHC.ESELI.SCHAET«
und darüber Fortschritte als Kolorist macht.
Eichhorst hat zwei Offizierporträts ausgestellt,
eigentlich nur Köpfe. Man denkt vor ihnen an
Schöpfungen aus der Leibizeit, an die von Alois
Erdtelt etwa. Beide sind tiefgestimmt, das eine
sogar, was auch bei Leibi vorkam, im Ton er-
trunken, flach; der zweite Kopf aber, einen
Generalmajor von Hülsen darstellend, ein klei-
nes Meisterstück intimster Beobachtung und
sorgsamster Durchführung. Der Maler hat sich
Zeit gegönnt, diesen feinen Soldatenkopf gründ-
lich zu studieren, und beweist mit seiner Arbeit,
daß die Kunst der alten Meister, dem Leben
bis in seine letzten Züge nachzugehen, auch für
den modernen Maler noch erreichbar ist, wenn
er etwas gelernt hat und sich die Zeit nimmt,
die Wirklichkeit gewissenhaft nachzubilden.
Seit vielen Jahren hat niemand in Deutschland
ein Auge so liebevoll gemalt, wie es Eichhorst
lfi diesem Bildnis getan, das bei aller Intimi-
tät der Wiedergabe doch großzügig wirkt. —
Wie fallen gegen solche Leistung die übrigen
Bildnisse der Ausstellung ab, vor allem der
Hindenburg Alfred Hamachers! Da macht der
Hindenburg, den Fritz Burg er (vielleicht nicht
einmal nach dem Leben) gemalt, einen ungleich
frischeren und lebendigeren Eindruck, der zum
großen Teil allerdings wohl aus der klug ge-
mäßigten Hodlerschen Farbengebung resultiert,
aber doch auch auf der feineren Auffassung der
Persönlichkeit beruht. Einen gewissen Wurf
zeigt ferner ein Offizierporträt des Berliners
Richard Lindmar. Was sonst von Bildnissen
aus Deutschlands großer Zeit vorhanden ist,
bleibt durchaus im Hergebrachten stecken.
Eine recht starke Talentprobe bietet dieses
Mal ein junger Maler, von dem schon im ersten
Teil der Ausstellung eine Modellstudie auffiel:
Carl Hentze. Sein „Stilleben" mit dem jungen
Mädchen, das den Kopf auf den mit Früchten,
Blumen, Geschirr und Stoffen überladenen Tisch
legt, läßt das Auge nicht zur Ruhe kommen, auch
ist die Farbe als Materie hier und da nicht
überwunden; im ganzen jedoch bleibt der Ein-
PAUL l'I.ONTKE- BERLIN.
GEMÄLDE »TISCHC.ESELI.SCHAET«
und darüber Fortschritte als Kolorist macht.
Eichhorst hat zwei Offizierporträts ausgestellt,
eigentlich nur Köpfe. Man denkt vor ihnen an
Schöpfungen aus der Leibizeit, an die von Alois
Erdtelt etwa. Beide sind tiefgestimmt, das eine
sogar, was auch bei Leibi vorkam, im Ton er-
trunken, flach; der zweite Kopf aber, einen
Generalmajor von Hülsen darstellend, ein klei-
nes Meisterstück intimster Beobachtung und
sorgsamster Durchführung. Der Maler hat sich
Zeit gegönnt, diesen feinen Soldatenkopf gründ-
lich zu studieren, und beweist mit seiner Arbeit,
daß die Kunst der alten Meister, dem Leben
bis in seine letzten Züge nachzugehen, auch für
den modernen Maler noch erreichbar ist, wenn
er etwas gelernt hat und sich die Zeit nimmt,
die Wirklichkeit gewissenhaft nachzubilden.
Seit vielen Jahren hat niemand in Deutschland
ein Auge so liebevoll gemalt, wie es Eichhorst
lfi diesem Bildnis getan, das bei aller Intimi-
tät der Wiedergabe doch großzügig wirkt. —
Wie fallen gegen solche Leistung die übrigen
Bildnisse der Ausstellung ab, vor allem der
Hindenburg Alfred Hamachers! Da macht der
Hindenburg, den Fritz Burg er (vielleicht nicht
einmal nach dem Leben) gemalt, einen ungleich
frischeren und lebendigeren Eindruck, der zum
großen Teil allerdings wohl aus der klug ge-
mäßigten Hodlerschen Farbengebung resultiert,
aber doch auch auf der feineren Auffassung der
Persönlichkeit beruht. Einen gewissen Wurf
zeigt ferner ein Offizierporträt des Berliners
Richard Lindmar. Was sonst von Bildnissen
aus Deutschlands großer Zeit vorhanden ist,
bleibt durchaus im Hergebrachten stecken.
Eine recht starke Talentprobe bietet dieses
Mal ein junger Maler, von dem schon im ersten
Teil der Ausstellung eine Modellstudie auffiel:
Carl Hentze. Sein „Stilleben" mit dem jungen
Mädchen, das den Kopf auf den mit Früchten,
Blumen, Geschirr und Stoffen überladenen Tisch
legt, läßt das Auge nicht zur Ruhe kommen, auch
ist die Farbe als Materie hier und da nicht
überwunden; im ganzen jedoch bleibt der Ein-