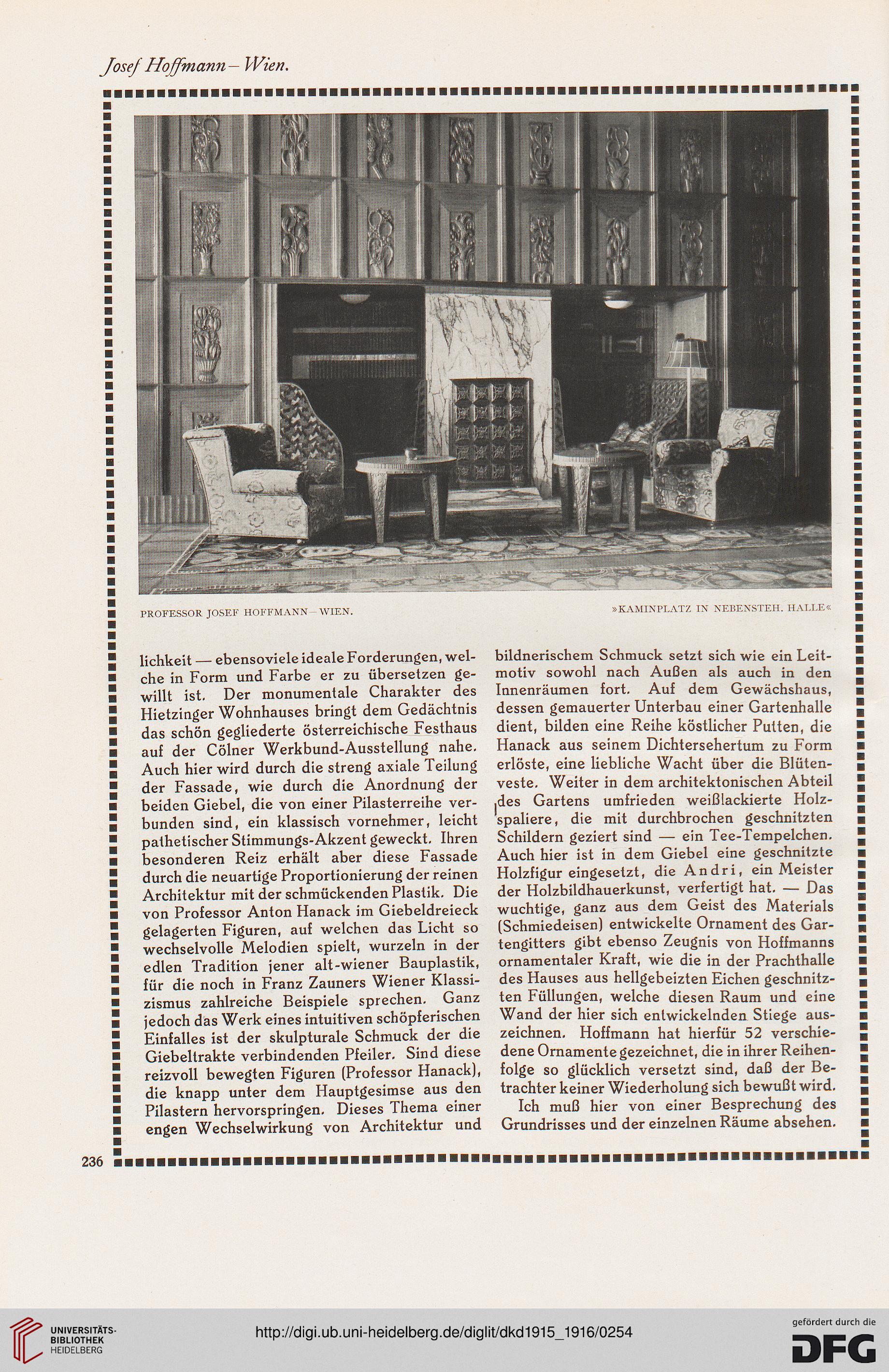Josef Hoffmann- Wien.
PROFESSOR JOSEV IIOFFMAKN WIEN.
>KAMINPI.AT/. IN" NF.BENSTEII. HALLE
lichkeit — ebensoviele ideale Forderungen, wel-
che in Form und Farbe er zu übersetzen ge-
willt ist. Der monumentale Charakter des
Hietzinger Wohnhauses bringt dem Gedächtnis
das schön gegliederte österreichische Festhaus
auf der Cölner Werkbund-Ausstellung nahe.
Auch hier wird durch die streng axiale Teilung
der Fassade, wie durch die Anordnung der
beiden Giebel, die von einer Pilasterreihe ver-
bunden sind, ein klassisch vornehmer, leicht
pathetischer Stimmungs-Akzent geweckt. Ihren
besonderen Reiz erhält aber diese Fassade
durch die neuartige Proportionierung der reinen
Architektur mit der schmückenden Plastik. Die
von Professor Anton Hanack im Giebeldreieck
gelagerten Figuren, auf welchen das Licht so
wechselvolle Melodien spielt, wurzeln in der
edlen Tradition jener alt-wiener Bauplastik,
für die noch in Franz Zauners Wiener Klassi-
zismus zahlreiche Beispiele sprechen. Ganz
jedoch das Werk eines intuitiven schöpferischen
Einfalles ist der skulpturale Schmuck der die
Giebeltrakte verbindenden Pfeiler. Sind diese
reizvoll bewegten Figuren (Professor Hanack),
die knapp unter dem Hauptgesimse aus den
Pilastern hervorspringen. Dieses Thema einer
engen Wechselwirkung von Architektur und
bildnerischem Schmuck setzt sich wie ein Leit-
motiv sowohl nach Außen als auch in den
Innenräumen fort. Auf dem Gewächshaus,
dessen gemauerter Unterbau einer Gartenhalle
dient, bilden eine Reihe köstlicher Putten, die
Hanack aus seinem Dichtersehertum zu Form
erlöste, eine liebliche Wacht über die Blüten-
veste. Weiter in dem architektonischen Abteil
jdes Gartens umfrieden weißlackierte Holz-
spaliere, die mit durchbrochen geschnitzten
Schildern geziert sind — ein Tee-Tempelchen.
Auch hier ist in dem Giebel eine geschnitzte
Holzfigur eingesetzt, die Andri, ein Meister
der Holzbildhauerkunst, verfertigt hat. — Das
wuchtige, ganz aus dem Geist des Materials
(Schmiedeisen) entwickelte Ornament des Gar-
tengitters gibt ebenso Zeugnis von Hoffmanns
ornamentaler Kraft, wie die in der Prachthalle
des Hauses aus hellgebeizten Eichen geschnitz-
ten Füllungen, welche diesen Raum und eine
Wand der hier sich entwickelnden Stiege aus-
zeichnen. Hoffmann hat hierfür 52 verschie-
dene Ornamente gezeichnet, die in ihrer Reihen-
folge so glücklich versetzt sind, daß der Be-
trachter keiner Wiederholung sich bewußt wird.
Ich muß hier von einer Besprechung des
Grundrisses und der einzelnen Räume absehen.
PROFESSOR JOSEV IIOFFMAKN WIEN.
>KAMINPI.AT/. IN" NF.BENSTEII. HALLE
lichkeit — ebensoviele ideale Forderungen, wel-
che in Form und Farbe er zu übersetzen ge-
willt ist. Der monumentale Charakter des
Hietzinger Wohnhauses bringt dem Gedächtnis
das schön gegliederte österreichische Festhaus
auf der Cölner Werkbund-Ausstellung nahe.
Auch hier wird durch die streng axiale Teilung
der Fassade, wie durch die Anordnung der
beiden Giebel, die von einer Pilasterreihe ver-
bunden sind, ein klassisch vornehmer, leicht
pathetischer Stimmungs-Akzent geweckt. Ihren
besonderen Reiz erhält aber diese Fassade
durch die neuartige Proportionierung der reinen
Architektur mit der schmückenden Plastik. Die
von Professor Anton Hanack im Giebeldreieck
gelagerten Figuren, auf welchen das Licht so
wechselvolle Melodien spielt, wurzeln in der
edlen Tradition jener alt-wiener Bauplastik,
für die noch in Franz Zauners Wiener Klassi-
zismus zahlreiche Beispiele sprechen. Ganz
jedoch das Werk eines intuitiven schöpferischen
Einfalles ist der skulpturale Schmuck der die
Giebeltrakte verbindenden Pfeiler. Sind diese
reizvoll bewegten Figuren (Professor Hanack),
die knapp unter dem Hauptgesimse aus den
Pilastern hervorspringen. Dieses Thema einer
engen Wechselwirkung von Architektur und
bildnerischem Schmuck setzt sich wie ein Leit-
motiv sowohl nach Außen als auch in den
Innenräumen fort. Auf dem Gewächshaus,
dessen gemauerter Unterbau einer Gartenhalle
dient, bilden eine Reihe köstlicher Putten, die
Hanack aus seinem Dichtersehertum zu Form
erlöste, eine liebliche Wacht über die Blüten-
veste. Weiter in dem architektonischen Abteil
jdes Gartens umfrieden weißlackierte Holz-
spaliere, die mit durchbrochen geschnitzten
Schildern geziert sind — ein Tee-Tempelchen.
Auch hier ist in dem Giebel eine geschnitzte
Holzfigur eingesetzt, die Andri, ein Meister
der Holzbildhauerkunst, verfertigt hat. — Das
wuchtige, ganz aus dem Geist des Materials
(Schmiedeisen) entwickelte Ornament des Gar-
tengitters gibt ebenso Zeugnis von Hoffmanns
ornamentaler Kraft, wie die in der Prachthalle
des Hauses aus hellgebeizten Eichen geschnitz-
ten Füllungen, welche diesen Raum und eine
Wand der hier sich entwickelnden Stiege aus-
zeichnen. Hoffmann hat hierfür 52 verschie-
dene Ornamente gezeichnet, die in ihrer Reihen-
folge so glücklich versetzt sind, daß der Be-
trachter keiner Wiederholung sich bewußt wird.
Ich muß hier von einer Besprechung des
Grundrisses und der einzelnen Räume absehen.