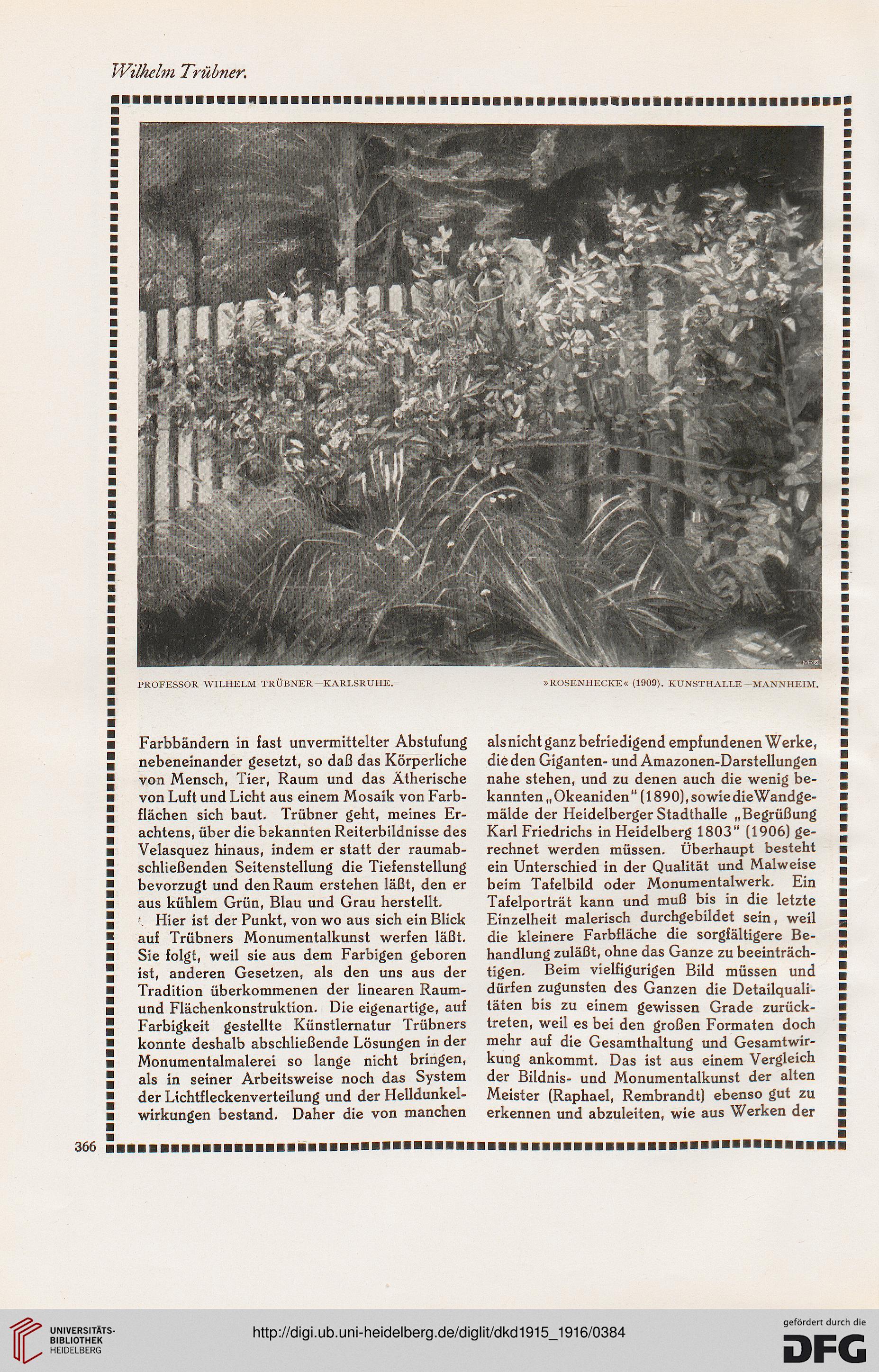Wilhelm Trübner.
PROFESSOR WILHELM TRUBNER KARLSRUHE.
»ROSENHECKE« (1909). KUNSTH
-MANNHEIM.
Farbbändern in fast unvermittelter Abstufung
nebeneinander gesetzt, so daß das Körperliche
von Mensch, Tier, Raum und das Ätherische
von Luft und Licht aus einem Mosaik von Farb-
flächen sich baut. Trübner geht, meines Er-
achtens, über die bskannten Reiterbildnisse des
Velasquez hinaus, indem er statt der raumab-
schließenden Seitenstellung die Tiefenstellung
bevorzugt und den Raum erstehen läßt, den er
aus kühlem Grün, Blau und Grau herstellt.
Hier ist der Punkt, von wo aus sich ein Blick
auf Trübners Monumentalkunst werfen läßt.
Sie folgt, weil sie aus dem Farbigen geboren
ist, anderen Gesetzen, als den uns aus der
Tradition überkommenen der linearen Raum-
und Flächenkonstruktion. Die eigenartige, auf
Farbigkeit gestellte Künstlernatur Trübners
konnte deshalb abschließende Lösungen in der
Monumentalmalerei so lange nicht bringen,
als in seiner Arbeitsweise noch das System
der Lichtfleckenverteilung und der Helldunkel-
wirkungen bestand. Daher die von manchen
als nicht ganz befriedigend empfundenen Werke,
die den Giganten- und Amazonen-Darstellungen
nahe stehen, und zu denen auch die wenig be-
kannten „ Okeaniden "(1890), sowie die Wandge-
mälde der Heidelberger Stadthalle „Begrüßung
Karl Friedrichs in Heidelberg 1803" (1906) ge-
rechnet werden müssen. Überhaupt besteht
ein Unterschied in der Qualität und Malweise
beim Tafelbild oder Monumentalwerk. Ein
Tafelporträt kann und muß bis in die letzte
Einzelheit malerisch durchgebildet sein, weil
die kleinere Farbfläche die sorgfältigere Be-
handlung zuläßt, ohne das Ganze zu beeinträch-
tigen. Beim vielfigurigen Bild müssen und
dürfen zugunsten des Ganzen die Detailquali-
täten bis zu einem gewissen Grade zurück-
treten, weil es bei den großen Formaten doch
mehr auf die Gesamthaltung und Gesamtwir-
kung ankommt. Das ist aus einem Vergleich
der Bildnis- und Monumentalkunst der alten
Meister (Raphael, Rembrandt) ebenso gut zu
erkennen und abzuleiten, wie aus Werken der
PROFESSOR WILHELM TRUBNER KARLSRUHE.
»ROSENHECKE« (1909). KUNSTH
-MANNHEIM.
Farbbändern in fast unvermittelter Abstufung
nebeneinander gesetzt, so daß das Körperliche
von Mensch, Tier, Raum und das Ätherische
von Luft und Licht aus einem Mosaik von Farb-
flächen sich baut. Trübner geht, meines Er-
achtens, über die bskannten Reiterbildnisse des
Velasquez hinaus, indem er statt der raumab-
schließenden Seitenstellung die Tiefenstellung
bevorzugt und den Raum erstehen läßt, den er
aus kühlem Grün, Blau und Grau herstellt.
Hier ist der Punkt, von wo aus sich ein Blick
auf Trübners Monumentalkunst werfen läßt.
Sie folgt, weil sie aus dem Farbigen geboren
ist, anderen Gesetzen, als den uns aus der
Tradition überkommenen der linearen Raum-
und Flächenkonstruktion. Die eigenartige, auf
Farbigkeit gestellte Künstlernatur Trübners
konnte deshalb abschließende Lösungen in der
Monumentalmalerei so lange nicht bringen,
als in seiner Arbeitsweise noch das System
der Lichtfleckenverteilung und der Helldunkel-
wirkungen bestand. Daher die von manchen
als nicht ganz befriedigend empfundenen Werke,
die den Giganten- und Amazonen-Darstellungen
nahe stehen, und zu denen auch die wenig be-
kannten „ Okeaniden "(1890), sowie die Wandge-
mälde der Heidelberger Stadthalle „Begrüßung
Karl Friedrichs in Heidelberg 1803" (1906) ge-
rechnet werden müssen. Überhaupt besteht
ein Unterschied in der Qualität und Malweise
beim Tafelbild oder Monumentalwerk. Ein
Tafelporträt kann und muß bis in die letzte
Einzelheit malerisch durchgebildet sein, weil
die kleinere Farbfläche die sorgfältigere Be-
handlung zuläßt, ohne das Ganze zu beeinträch-
tigen. Beim vielfigurigen Bild müssen und
dürfen zugunsten des Ganzen die Detailquali-
täten bis zu einem gewissen Grade zurück-
treten, weil es bei den großen Formaten doch
mehr auf die Gesamthaltung und Gesamtwir-
kung ankommt. Das ist aus einem Vergleich
der Bildnis- und Monumentalkunst der alten
Meister (Raphael, Rembrandt) ebenso gut zu
erkennen und abzuleiten, wie aus Werken der