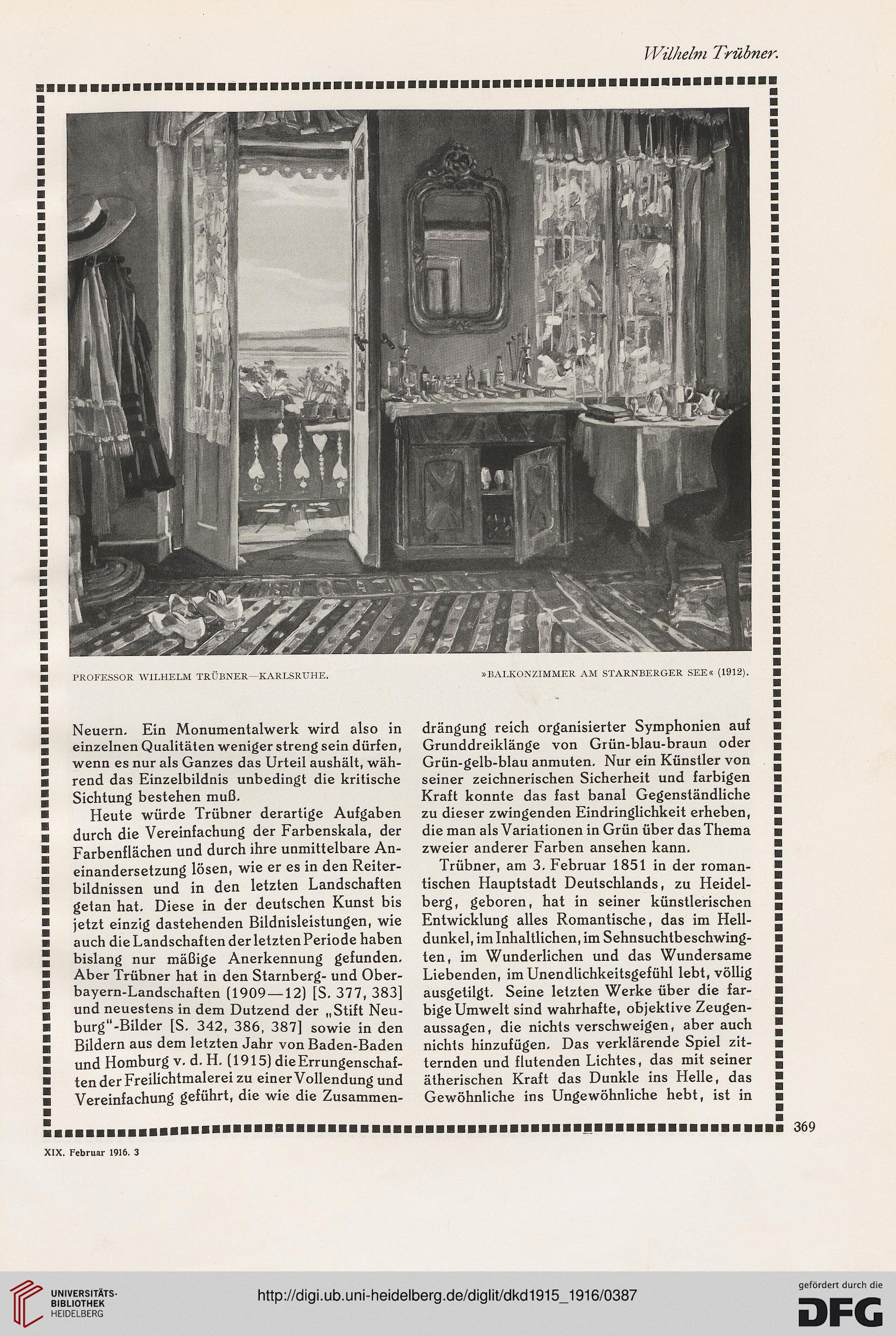Wilhelm Trübner.
PROFESSOR WILHELM TRI BN'EK KARLSRUHE.
»BALKONZIMMER AM STARNBERGER SEE« (1912
Neuern. Ein Monumentalwerk wird also in
einzelnen Qualitäten weniger streng sein dürfen,
wenn es nur als Ganzes das Urteil aushält, wäh-
rend das Einzelbildnis unbedingt die kritische
Sichtung bestehen muß.
Heute würde Trübner derartige Aufgaben
durch die Vereinfachung der Farbenskala, der
Farbenflächen und durch ihre unmittelbare An-
einandersetzung lösen, wie er es in den Reiter-
bildnissen und in den letzten Landschaften
getan hat. Diese in der deutschen Kunst bis
jetzt einzig dastehenden Bildnisleistungen, wie
auch die Landschaften der letzten Periode haben
bislang nur mäßige Anerkennung gefunden.
Aber Trübner hat in den Starnberg- und Ober-
bayern-Landschaften (1909 — 12) [S. 377, 383]
und neuestens in dem Dutzend der „Stift Neu-
burg"-Bilder [S. 342, 386, 387] sowie in den
Bildern aus dem letzten Jahr von Baden-Baden
und Homburg v. d. H. (1915) die Errungenschaf-
ten der Freilichtmalerei zu einer Vollendung und
Vereinfachung geführt, die wie die Zusammen-
drängung reich organisierter Symphonien auf
Grunddreiklänge von Grün-blau-braun oder
Grün-gelb-blau anmuten. Nur ein Künstler von
seiner zeichnerischen Sicherheit und farbigen
Kraft konnte das fast banal Gegenständliche
zu dieser zwingenden Eindringlichkeit erheben,
die man als Variationen in Grün über das Thema
zweier anderer Farben ansehen kann.
Trübner, am 3. Februar 1851 in der roman-
tischen Hauptstadt Deutschlands, zu Heidel-
berg, geboren, hat in seiner künstlerischen
Entwicklung alles Romantische, das im Hell-
dunkel, im Inhaltlichen, im Sehnsuchtbeschwing-
ten, im Wunderlichen und das Wundersame
Liebenden, im Unendlichkeitsgefühl lebt, völlig
ausgetilgt. Seine letzten Werke über die far-
bige Umwelt sind wahrhafte, objektive Zeugen-
aussagen, die nichts verschweigen, aber auch
nichts hinzufügen. Das verklärende Spiel zit-
ternden und flutenden Lichtes, das mit seiner
ätherischen Kraft das Dunkle ins Helle, das
Gewöhnliche ins Ungewöhnliche hebt, ist in
XIX. Februar 1916. 3
PROFESSOR WILHELM TRI BN'EK KARLSRUHE.
»BALKONZIMMER AM STARNBERGER SEE« (1912
Neuern. Ein Monumentalwerk wird also in
einzelnen Qualitäten weniger streng sein dürfen,
wenn es nur als Ganzes das Urteil aushält, wäh-
rend das Einzelbildnis unbedingt die kritische
Sichtung bestehen muß.
Heute würde Trübner derartige Aufgaben
durch die Vereinfachung der Farbenskala, der
Farbenflächen und durch ihre unmittelbare An-
einandersetzung lösen, wie er es in den Reiter-
bildnissen und in den letzten Landschaften
getan hat. Diese in der deutschen Kunst bis
jetzt einzig dastehenden Bildnisleistungen, wie
auch die Landschaften der letzten Periode haben
bislang nur mäßige Anerkennung gefunden.
Aber Trübner hat in den Starnberg- und Ober-
bayern-Landschaften (1909 — 12) [S. 377, 383]
und neuestens in dem Dutzend der „Stift Neu-
burg"-Bilder [S. 342, 386, 387] sowie in den
Bildern aus dem letzten Jahr von Baden-Baden
und Homburg v. d. H. (1915) die Errungenschaf-
ten der Freilichtmalerei zu einer Vollendung und
Vereinfachung geführt, die wie die Zusammen-
drängung reich organisierter Symphonien auf
Grunddreiklänge von Grün-blau-braun oder
Grün-gelb-blau anmuten. Nur ein Künstler von
seiner zeichnerischen Sicherheit und farbigen
Kraft konnte das fast banal Gegenständliche
zu dieser zwingenden Eindringlichkeit erheben,
die man als Variationen in Grün über das Thema
zweier anderer Farben ansehen kann.
Trübner, am 3. Februar 1851 in der roman-
tischen Hauptstadt Deutschlands, zu Heidel-
berg, geboren, hat in seiner künstlerischen
Entwicklung alles Romantische, das im Hell-
dunkel, im Inhaltlichen, im Sehnsuchtbeschwing-
ten, im Wunderlichen und das Wundersame
Liebenden, im Unendlichkeitsgefühl lebt, völlig
ausgetilgt. Seine letzten Werke über die far-
bige Umwelt sind wahrhafte, objektive Zeugen-
aussagen, die nichts verschweigen, aber auch
nichts hinzufügen. Das verklärende Spiel zit-
ternden und flutenden Lichtes, das mit seiner
ätherischen Kraft das Dunkle ins Helle, das
Gewöhnliche ins Ungewöhnliche hebt, ist in
XIX. Februar 1916. 3