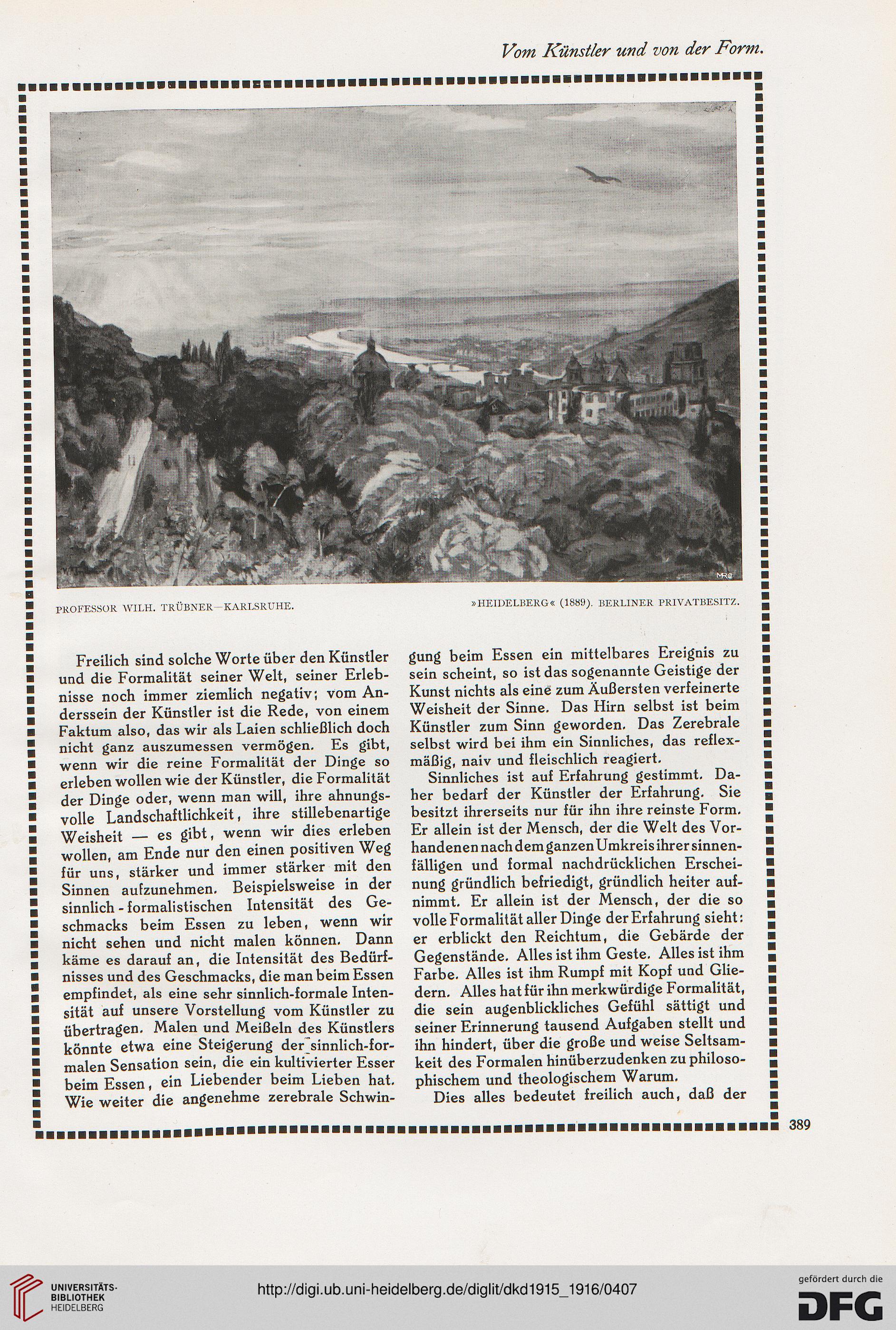Vom Künstler und von der Form.
PROFESSOR WILH. TRUBXER KARLSRUHE.
»HEIDELBERG« (188»). BERLINER PRIVATBESITZ.
Freilich sind solche Worte über den Künstler
und die Formalität seiner Welt, seiner Erleb-
nisse noch immer ziemlich negativ; vom An-
derssein der Künstler ist die Rede, von einem
Faktum also, das wir als Laien schließlich doch
nicht ganz auszumessen vermögen. Es gibt,
wenn wir die reine Formalität der Dinge so
erleben wollen wie der Künstler, die Formalität
der Dinge oder, wenn man will, ihre ahnungs-
volle Landschaftlichkeit, ihre stillebenartige
Weisheit — es gibt, wenn wir dies erleben
wollen, am Ende nur den einen positiven Weg
für uns, stärker und immer stärker mit den
Sinnen aufzunehmen. Beispielsweise in der
sinnlich - formalistischen Intensität des Ge-
schmacks beim Essen zu leben, wenn wir
nicht sehen und nicht malen können. Dann
käme es darauf an, die Intensität des Bedürf-
nisses und des Geschmacks, die man beim Essen
empfindet, als eine sehr sinnlich-formale Inten-
sität auf unsere Vorstellung vom Künstler zu
übertragen. Malen und Meißeln des Künstlers
könnte etwa eine Steigerung der~sinnlich-for-
malen Sensation sein, die ein kultivierter Esser
beim Essen, ein Liebender beim Lieben hat.
Wie weiter die angenehme zerebrale Schwin-
gung beim Essen ein mittelbares Ereignis zu
sein scheint, so ist das sogenannte Geistige der
Kunst nichts als eine zum Äußersten verfeinerte
Weisheit der Sinne. Das Hirn selbst ist beim
Künstler zum Sinn geworden. Das Zerebrale
selbst wird bei ihm ein Sinnliches, das reflex-
mäßig, naiv und fleischlich reagiert.
Sinnliches ist auf Erfahrung gestimmt. Da-
her bedarf der Künstler der Erfahrung. Sie
besitzt ihrerseits nur für ihn ihre reinste Form.
Er allein ist der Mensch, der die Welt des Vor-
handenen nach dem ganzen Umkreis ihrer sinnen-
fälligen und formal nachdrücklichen Erschei-
nung gründlich befriedigt, gründlich heiter auf-
nimmt. Er allein ist der Mensch, der die so
volle Formalität aller Dinge der Erfahrung sieht:
er erblickt den Reichtum, die Gebärde der
Gegenstände. Alles ist ihm Geste. Alles ist ihm
Farbe. Alles ist ihm Rumpf mit Kopf und Glie-
dern. Alles hat für ihn merkwürdige Formalität,
die sein augenblickliches Gefühl sättigt und
seiner Erinnerung tausend Aufgaben stellt und
ihn hindert, über die große und weise Seltsam-
keit des Formalen hinüberzudenken zu philoso-
phischem und theologischem Warum.
Dies alles bedeutet freilich auch, daß der
PROFESSOR WILH. TRUBXER KARLSRUHE.
»HEIDELBERG« (188»). BERLINER PRIVATBESITZ.
Freilich sind solche Worte über den Künstler
und die Formalität seiner Welt, seiner Erleb-
nisse noch immer ziemlich negativ; vom An-
derssein der Künstler ist die Rede, von einem
Faktum also, das wir als Laien schließlich doch
nicht ganz auszumessen vermögen. Es gibt,
wenn wir die reine Formalität der Dinge so
erleben wollen wie der Künstler, die Formalität
der Dinge oder, wenn man will, ihre ahnungs-
volle Landschaftlichkeit, ihre stillebenartige
Weisheit — es gibt, wenn wir dies erleben
wollen, am Ende nur den einen positiven Weg
für uns, stärker und immer stärker mit den
Sinnen aufzunehmen. Beispielsweise in der
sinnlich - formalistischen Intensität des Ge-
schmacks beim Essen zu leben, wenn wir
nicht sehen und nicht malen können. Dann
käme es darauf an, die Intensität des Bedürf-
nisses und des Geschmacks, die man beim Essen
empfindet, als eine sehr sinnlich-formale Inten-
sität auf unsere Vorstellung vom Künstler zu
übertragen. Malen und Meißeln des Künstlers
könnte etwa eine Steigerung der~sinnlich-for-
malen Sensation sein, die ein kultivierter Esser
beim Essen, ein Liebender beim Lieben hat.
Wie weiter die angenehme zerebrale Schwin-
gung beim Essen ein mittelbares Ereignis zu
sein scheint, so ist das sogenannte Geistige der
Kunst nichts als eine zum Äußersten verfeinerte
Weisheit der Sinne. Das Hirn selbst ist beim
Künstler zum Sinn geworden. Das Zerebrale
selbst wird bei ihm ein Sinnliches, das reflex-
mäßig, naiv und fleischlich reagiert.
Sinnliches ist auf Erfahrung gestimmt. Da-
her bedarf der Künstler der Erfahrung. Sie
besitzt ihrerseits nur für ihn ihre reinste Form.
Er allein ist der Mensch, der die Welt des Vor-
handenen nach dem ganzen Umkreis ihrer sinnen-
fälligen und formal nachdrücklichen Erschei-
nung gründlich befriedigt, gründlich heiter auf-
nimmt. Er allein ist der Mensch, der die so
volle Formalität aller Dinge der Erfahrung sieht:
er erblickt den Reichtum, die Gebärde der
Gegenstände. Alles ist ihm Geste. Alles ist ihm
Farbe. Alles ist ihm Rumpf mit Kopf und Glie-
dern. Alles hat für ihn merkwürdige Formalität,
die sein augenblickliches Gefühl sättigt und
seiner Erinnerung tausend Aufgaben stellt und
ihn hindert, über die große und weise Seltsam-
keit des Formalen hinüberzudenken zu philoso-
phischem und theologischem Warum.
Dies alles bedeutet freilich auch, daß der