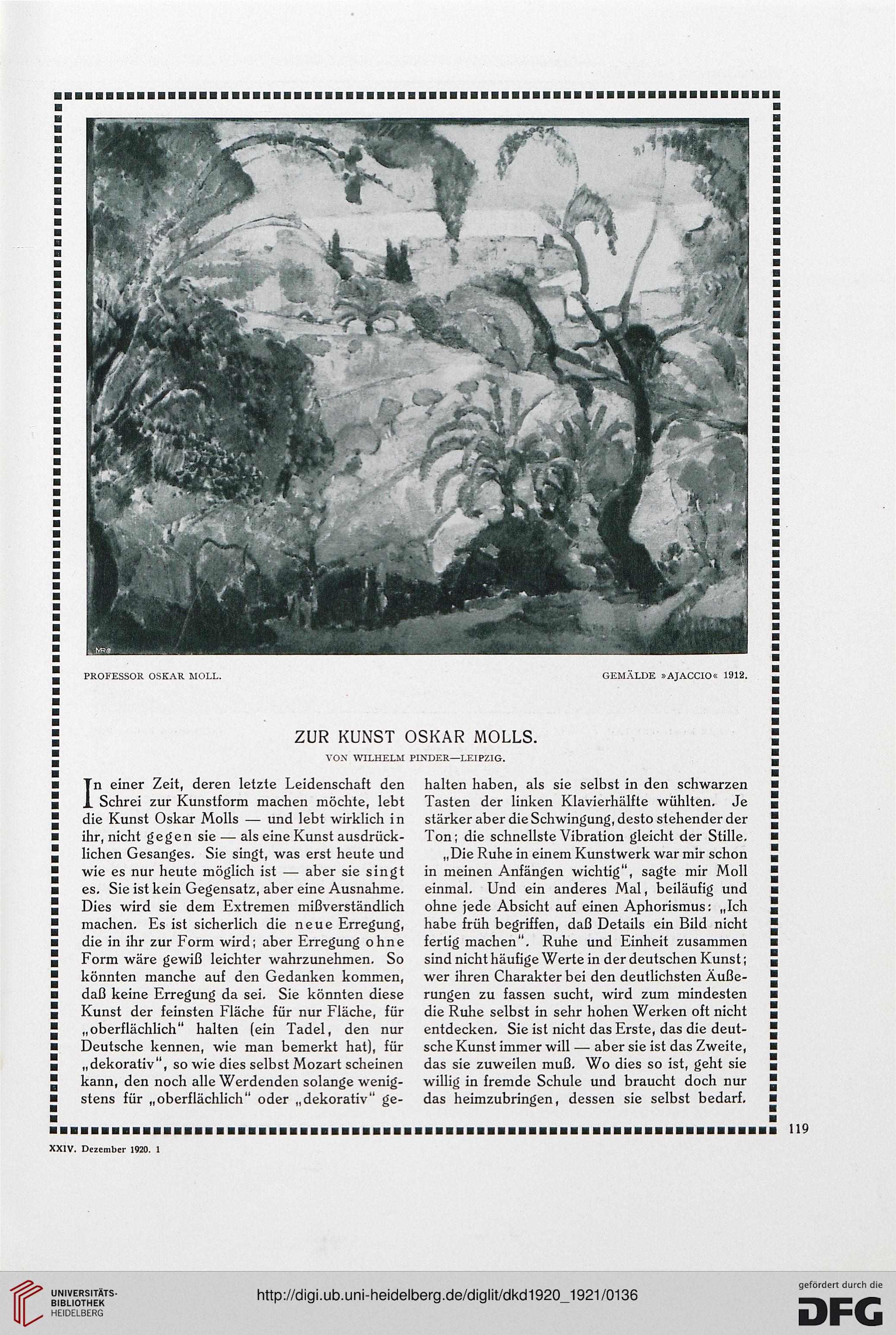PROFESSOR OSKAR MOLL.
GEMÄLDE »AJACCIO« 1912.
ZUR KUNST OSKAR MOLLS.
VON WILHELM PINDER—LEIPZIG.
In einer Zeit, deren letzte Leidenschaft den
Schrei zur Kunstform machen möchte, lebt
die Kunst Oskar Molls — und lebt wirklich in
ihr, nicht gegen sie — als eine Kunst ausdrück-
lichen Gesanges. Sie singt, was erst heute und
wie es nur heute möglich ist — aber sie singt
es. Sie ist kein Gegensatz, aber eine Ausnahme.
Dies wird sie dem Extremen mißverständlich
machen. Es ist sicherlich die neue Erregung,
die in ihr zur Form wird; aber Erregung ohne
Form wäre gewiß leichter wahrzunehmen. So
könnten manche auf den Gedanken kommen,
daß keine Erregung da sei. Sie könnten diese
Kunst der feinsten Fläche für nur Fläche, für
„oberflächlich" halten (ein Tadel, den nur
Deutsche kennen, wie man bemerkt hat), für
„dekorativ", so wie dies selbst Mozart scheinen
kann, den noch alle Werdenden solange wenig-
stens für „oberflächlich" oder „dekorativ" ge-
halten haben, als sie selbst in den schwarzen
Tasten der linken Klavierhälfte wühlten. Je
stärker aber die Schwingung, desto stehender der
Ton; die schnellste Vibration gleicht der Stille.
„Die Ruhe in einem Kunstwerk war mir schon
in meinen Anfängen wichtig", sagte mir Moll
einmal. Und ein anderes Mal, beiläufig und
ohne jede Absicht auf einen Aphorismus: „Ich
habe früh begriffen, daß Details ein Bild nicht
fertig machen". Ruhe und Einheit zusammen
sind nicht häufige Werte in der deutschen Kunst;
wer ihren Charakter bei den deutlichsten Äuße-
rungen zu fassen sucht, wird zum mindesten
die Ruhe selbst in sehr hohen Werken oft nicht
entdecken. Sie ist nicht das Erste, das die deut-
sche Kunst immer will — aber sie ist das Zweite,
das sie zuweilen muß. Wo dies so ist, geht sie
willig in fremde Schule und braucht doch nur
das heimzubringen, dessen sie selbst bedarf.
XXIV. Dezember 1020. 1
GEMÄLDE »AJACCIO« 1912.
ZUR KUNST OSKAR MOLLS.
VON WILHELM PINDER—LEIPZIG.
In einer Zeit, deren letzte Leidenschaft den
Schrei zur Kunstform machen möchte, lebt
die Kunst Oskar Molls — und lebt wirklich in
ihr, nicht gegen sie — als eine Kunst ausdrück-
lichen Gesanges. Sie singt, was erst heute und
wie es nur heute möglich ist — aber sie singt
es. Sie ist kein Gegensatz, aber eine Ausnahme.
Dies wird sie dem Extremen mißverständlich
machen. Es ist sicherlich die neue Erregung,
die in ihr zur Form wird; aber Erregung ohne
Form wäre gewiß leichter wahrzunehmen. So
könnten manche auf den Gedanken kommen,
daß keine Erregung da sei. Sie könnten diese
Kunst der feinsten Fläche für nur Fläche, für
„oberflächlich" halten (ein Tadel, den nur
Deutsche kennen, wie man bemerkt hat), für
„dekorativ", so wie dies selbst Mozart scheinen
kann, den noch alle Werdenden solange wenig-
stens für „oberflächlich" oder „dekorativ" ge-
halten haben, als sie selbst in den schwarzen
Tasten der linken Klavierhälfte wühlten. Je
stärker aber die Schwingung, desto stehender der
Ton; die schnellste Vibration gleicht der Stille.
„Die Ruhe in einem Kunstwerk war mir schon
in meinen Anfängen wichtig", sagte mir Moll
einmal. Und ein anderes Mal, beiläufig und
ohne jede Absicht auf einen Aphorismus: „Ich
habe früh begriffen, daß Details ein Bild nicht
fertig machen". Ruhe und Einheit zusammen
sind nicht häufige Werte in der deutschen Kunst;
wer ihren Charakter bei den deutlichsten Äuße-
rungen zu fassen sucht, wird zum mindesten
die Ruhe selbst in sehr hohen Werken oft nicht
entdecken. Sie ist nicht das Erste, das die deut-
sche Kunst immer will — aber sie ist das Zweite,
das sie zuweilen muß. Wo dies so ist, geht sie
willig in fremde Schule und braucht doch nur
das heimzubringen, dessen sie selbst bedarf.
XXIV. Dezember 1020. 1