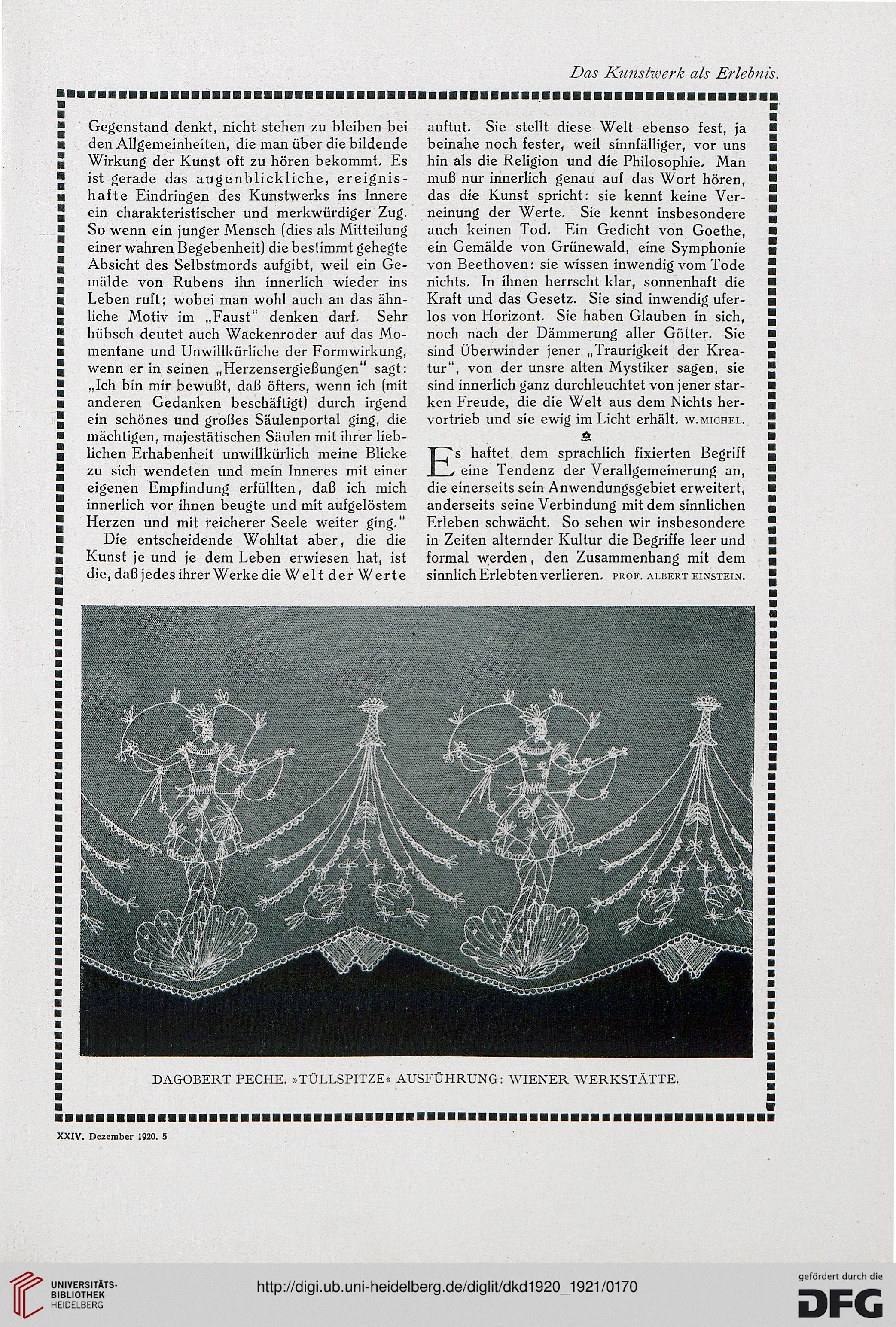Das Kunstwerk als Erlebnis.
Gegenstand denkt, nicht stehen zu bleiben bei
den Allgemeinheiten, die man über die bildende
Wirkung der Kunst oft zu hören bekommt. Es
ist gerade das augenblickliche, ereignis-
hafte Eindringen des Kunstwerks ins Innere
ein charakteristischer und merkwürdiger Zug.
So wenn ein junger Mensch (dies als Mitteilung
einer wahren Begebenheit) die beslimmt gehegte
Absicht des Selbstmords aufgibt, weil ein Ge-
mälde von Rubens ihn innerlich wieder ins
Leben ruft; wobei man wohl auch an das ähn-
liche Motiv im „Faust" denken darf. Sehr
hübsch deutet auch Wackenroder auf das Mo-
mentane und Unwillkürliche der Formwirkung,
wenn er in seinen „Herzensergießungen" sagt:
„Ich bin mir bewußt, daß öfters, wenn ich (mit
anderen Gedanken beschäftigt) durch irgend
ein schönes und großes Säulenportal ging, die
mächtigen, majestätischen Säulen mit ihrer lieb-
lichen Erhabenheit unwillkürlich meine Blicke
zu sich wendeten und mein Inneres mit einer
eigenen Empfindung erfüllten, daß ich mich
innerlich vor ihnen beugte und mit aufgelöstem
Herzen und mit reicherer Seele weiter ging."
Die entscheidende Wohltat aber, die die
Kunst je und je dem Leben erwiesen hat, ist
die, daß jedes ihrer Werke die Welt der Werte
auftut. Sie stellt diese Welt ebenso fest, ja
beinahe noch fester, weil sinnfälliger, vor uns
hin als die Religion und die Philosophie. Man
muß nur innerlich genau auf das Wort hören,
das die Kunst spricht: sie kennt keine Ver-
neinung der Werte. Sie kennt insbesondere
auch keinen Tod. Ein Gedicht von Goethe,
ein Gemälde von Grünewald, eine Symphonie
von Beethoven: sie wissen inwendig vom Tode
nichts. In ihnen herrscht klar, sonnenhaft die
Kraft und das Gesetz. Sie sind inwendig ufer-
los von Horizont. Sie haben Glauben in sich,
noch nach der Dämmerung aller Götter. Sie
sind Überwinder jener „Traurigkeit der Krea-
tur", von der unsre alten Mystiker sagen, sie
sind innerlich ganz durchleuchtet von jener star-
ken Freude, die die Welt aus dem Nichts her-
vortrieb und sie ewig im Licht erhält, w.micbel,
&
Es haftet dem sprachlich fixierten Begriff
eine Tendenz der Verallgemeinerung an,
die einerseits sein Anwendungsgebiet erweitert,
anderseits seine Verbindung mit dem sinnlichen
Erleben schwächt. So sehen wir insbesondere
in Zeiten alternder Kultur die Begriffe leer und
formal werden, den Zusammenhang mit dem
sinnlich Erlebten verlieren, prof. albert Einstein.
DAGOBERT PECHE. »TÜLLSPITZE« AUSFÜHRUNG: WIENER WERKSTÄTTE.
XXIV. Dezember 1920. 5
Gegenstand denkt, nicht stehen zu bleiben bei
den Allgemeinheiten, die man über die bildende
Wirkung der Kunst oft zu hören bekommt. Es
ist gerade das augenblickliche, ereignis-
hafte Eindringen des Kunstwerks ins Innere
ein charakteristischer und merkwürdiger Zug.
So wenn ein junger Mensch (dies als Mitteilung
einer wahren Begebenheit) die beslimmt gehegte
Absicht des Selbstmords aufgibt, weil ein Ge-
mälde von Rubens ihn innerlich wieder ins
Leben ruft; wobei man wohl auch an das ähn-
liche Motiv im „Faust" denken darf. Sehr
hübsch deutet auch Wackenroder auf das Mo-
mentane und Unwillkürliche der Formwirkung,
wenn er in seinen „Herzensergießungen" sagt:
„Ich bin mir bewußt, daß öfters, wenn ich (mit
anderen Gedanken beschäftigt) durch irgend
ein schönes und großes Säulenportal ging, die
mächtigen, majestätischen Säulen mit ihrer lieb-
lichen Erhabenheit unwillkürlich meine Blicke
zu sich wendeten und mein Inneres mit einer
eigenen Empfindung erfüllten, daß ich mich
innerlich vor ihnen beugte und mit aufgelöstem
Herzen und mit reicherer Seele weiter ging."
Die entscheidende Wohltat aber, die die
Kunst je und je dem Leben erwiesen hat, ist
die, daß jedes ihrer Werke die Welt der Werte
auftut. Sie stellt diese Welt ebenso fest, ja
beinahe noch fester, weil sinnfälliger, vor uns
hin als die Religion und die Philosophie. Man
muß nur innerlich genau auf das Wort hören,
das die Kunst spricht: sie kennt keine Ver-
neinung der Werte. Sie kennt insbesondere
auch keinen Tod. Ein Gedicht von Goethe,
ein Gemälde von Grünewald, eine Symphonie
von Beethoven: sie wissen inwendig vom Tode
nichts. In ihnen herrscht klar, sonnenhaft die
Kraft und das Gesetz. Sie sind inwendig ufer-
los von Horizont. Sie haben Glauben in sich,
noch nach der Dämmerung aller Götter. Sie
sind Überwinder jener „Traurigkeit der Krea-
tur", von der unsre alten Mystiker sagen, sie
sind innerlich ganz durchleuchtet von jener star-
ken Freude, die die Welt aus dem Nichts her-
vortrieb und sie ewig im Licht erhält, w.micbel,
&
Es haftet dem sprachlich fixierten Begriff
eine Tendenz der Verallgemeinerung an,
die einerseits sein Anwendungsgebiet erweitert,
anderseits seine Verbindung mit dem sinnlichen
Erleben schwächt. So sehen wir insbesondere
in Zeiten alternder Kultur die Begriffe leer und
formal werden, den Zusammenhang mit dem
sinnlich Erlebten verlieren, prof. albert Einstein.
DAGOBERT PECHE. »TÜLLSPITZE« AUSFÜHRUNG: WIENER WERKSTÄTTE.
XXIV. Dezember 1920. 5