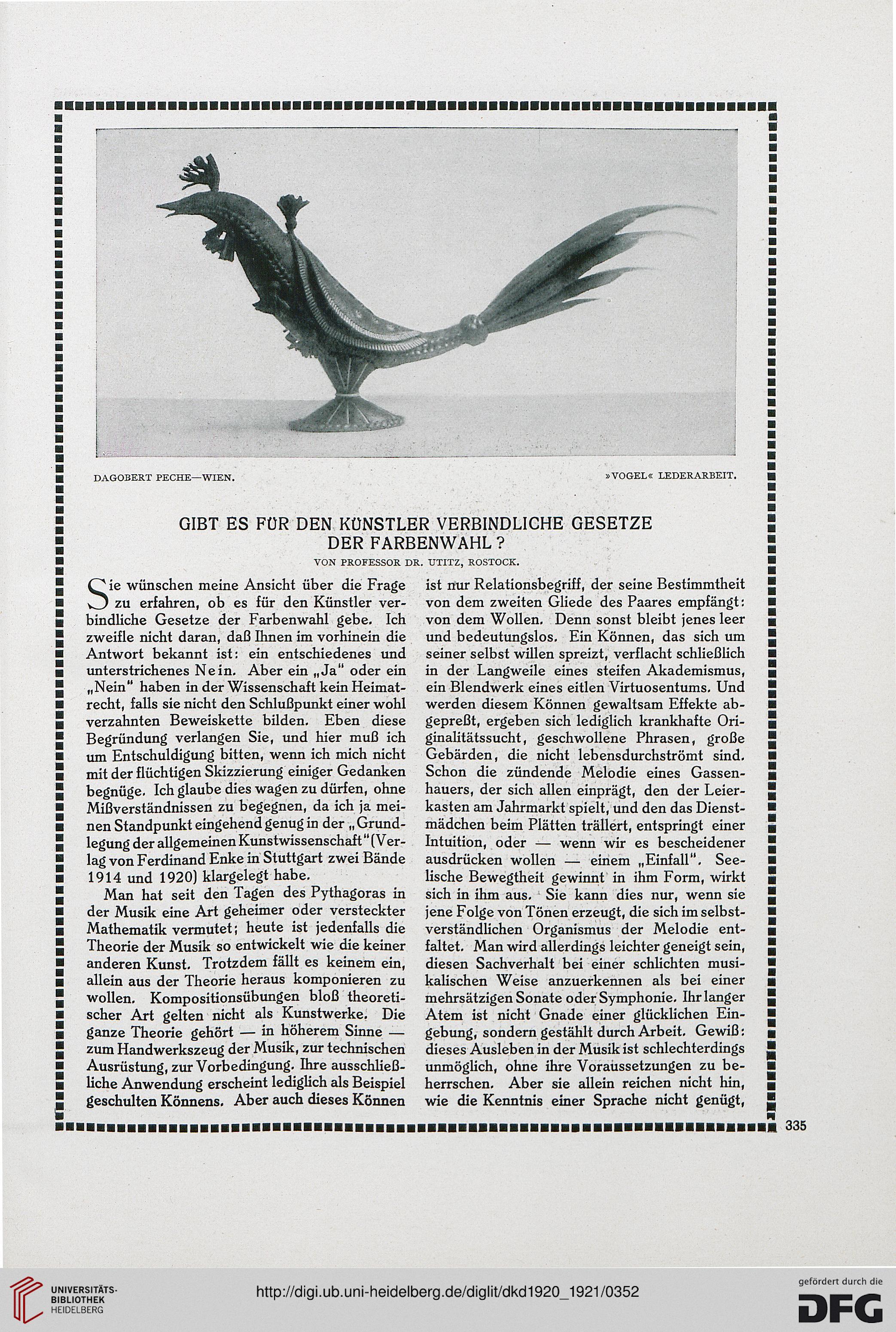DAGOBERT PECHE—WIEN.
»VOGEL« LEDERARBEIT.
GIBT ES FÜR DEN KÜNSTLER VERBINDLICHE GESETZE
DER FARBENWAHL?
VON PROFESSOR DR. UTITZ, ROSTOCK.
Sie wünschen meine Ansicht über die Frage
zu erfahren, ob es für den Künstler ver-
bindliche Gesetze der Farbenwahl gebe. Ich
zweifle nicht daran, daß Ihnen im vorhinein die
Antwort bekannt ist: ein entschiedenes und
unterstrichenes Nein. Aber ein „Ja" oder ein
„Nein" haben in der Wissenschaft kein Heimat-
recht, falls sie nicht den Schlußpunkt einer wohl
verzahnten Beweiskette bilden. Eben diese
Begründung verlangen Sie, und hier muß ich
um Entschuldigung bitten, wenn ich mich nicht
mit der flüchtigen Skizzierung einiger Gedanken
begnüge. Ich glaube dies wagen zu dürfen, ohne
Mißverständnissen zu begegnen, da ich ja mei-
nen Standpunkt eingehend genug in der „Grund-
legung der allgemeinen Kunstwissenschaft" (Ver-
lag von Ferdinand Enke in Stuttgart zwei Bände
1914 und 1920) klargelegt habe.
Man hat seit den Tagen des Pythagoras in
der Musik eine Art geheimer oder versteckter
Mathematik vermutet; heute ist jedenfalls die
Theorie der Musik so entwickelt wie die keiner
anderen Kunst. Trotzdem fällt es keinem ein,
allein aus der Theorie heraus komponieren zu
wollen. Kompositionsübungen bloß theoreti-
scher Art gelten nicht als Kunstwerke. Die
ganze Theorie gehört — in höherem Sinne —
zum Handwerkszeug der Musik, zur technischen
Ausrüstung, zur Vorbedingung. Ihre ausschließ-
liche Anwendung erscheint lediglich als Beispiel
geschulten Könnens. Aber auch dieses Können
ist nur Relationsbegriff, der seine Bestimmtheit
von dem zweiten Gliede des Paares empfängt:
von dem Wollen. Denn sonst bleibt jenes leer
und bedeutungslos. Ein Können, das sich um
seiner selbst willen spreizt, verflacht schließlich
in der Langweile eines steifen Akademismus,
ein Blendwerk eines eitlen Virtuosentums. Und
werden diesem Können gewaltsam Effekte ab-
gepreßt, ergeben sich lediglich krankhafte Ori-
ginalitätssucht, geschwollene Phrasen, große
Gebärden, die nicht lebensdurchströmt sind.
Schon die zündende Melodie eines Gassen-
hauers, der sich allen einprägt, den der Leier-
kasten am Jahrmarkt spielt, und den das Dienst-
mädchen beim Plätten trällert, entspringt einer
Intuition, oder — wenn wir es bescheidener
ausdrücken wollen — einem „Einfall". See-
lische Bewegtheit gewinnt in ihm Form, wirkt
sich in ihm aus. Sie kann dies nur, wenn sie
jene Folge von Tönen erzeugt, die sich im selbst-
verständlichen Organismus der Melodie ent-
faltet. Man wird allerdings leichter geneigt sein,
diesen Sachverhalt bei einer schlichten musi-
kalischen Weise anzuerkennen als bei einer
mehrsätzigen Sonate oder Symphonie. Ihr langer
Atem ist nicht Gnade einer glücklichen Ein-
gebung, sondern gestählt durch Arbeit. Gewiß:
dieses Ausleben in der Musik ist schlechterdings
unmöglich, ohne ihre Voraussetzungen zu be-
herrschen. Aber sie allein reichen nicht hin,
wie die Kenntnis einer Sprache nicht genügt,
»VOGEL« LEDERARBEIT.
GIBT ES FÜR DEN KÜNSTLER VERBINDLICHE GESETZE
DER FARBENWAHL?
VON PROFESSOR DR. UTITZ, ROSTOCK.
Sie wünschen meine Ansicht über die Frage
zu erfahren, ob es für den Künstler ver-
bindliche Gesetze der Farbenwahl gebe. Ich
zweifle nicht daran, daß Ihnen im vorhinein die
Antwort bekannt ist: ein entschiedenes und
unterstrichenes Nein. Aber ein „Ja" oder ein
„Nein" haben in der Wissenschaft kein Heimat-
recht, falls sie nicht den Schlußpunkt einer wohl
verzahnten Beweiskette bilden. Eben diese
Begründung verlangen Sie, und hier muß ich
um Entschuldigung bitten, wenn ich mich nicht
mit der flüchtigen Skizzierung einiger Gedanken
begnüge. Ich glaube dies wagen zu dürfen, ohne
Mißverständnissen zu begegnen, da ich ja mei-
nen Standpunkt eingehend genug in der „Grund-
legung der allgemeinen Kunstwissenschaft" (Ver-
lag von Ferdinand Enke in Stuttgart zwei Bände
1914 und 1920) klargelegt habe.
Man hat seit den Tagen des Pythagoras in
der Musik eine Art geheimer oder versteckter
Mathematik vermutet; heute ist jedenfalls die
Theorie der Musik so entwickelt wie die keiner
anderen Kunst. Trotzdem fällt es keinem ein,
allein aus der Theorie heraus komponieren zu
wollen. Kompositionsübungen bloß theoreti-
scher Art gelten nicht als Kunstwerke. Die
ganze Theorie gehört — in höherem Sinne —
zum Handwerkszeug der Musik, zur technischen
Ausrüstung, zur Vorbedingung. Ihre ausschließ-
liche Anwendung erscheint lediglich als Beispiel
geschulten Könnens. Aber auch dieses Können
ist nur Relationsbegriff, der seine Bestimmtheit
von dem zweiten Gliede des Paares empfängt:
von dem Wollen. Denn sonst bleibt jenes leer
und bedeutungslos. Ein Können, das sich um
seiner selbst willen spreizt, verflacht schließlich
in der Langweile eines steifen Akademismus,
ein Blendwerk eines eitlen Virtuosentums. Und
werden diesem Können gewaltsam Effekte ab-
gepreßt, ergeben sich lediglich krankhafte Ori-
ginalitätssucht, geschwollene Phrasen, große
Gebärden, die nicht lebensdurchströmt sind.
Schon die zündende Melodie eines Gassen-
hauers, der sich allen einprägt, den der Leier-
kasten am Jahrmarkt spielt, und den das Dienst-
mädchen beim Plätten trällert, entspringt einer
Intuition, oder — wenn wir es bescheidener
ausdrücken wollen — einem „Einfall". See-
lische Bewegtheit gewinnt in ihm Form, wirkt
sich in ihm aus. Sie kann dies nur, wenn sie
jene Folge von Tönen erzeugt, die sich im selbst-
verständlichen Organismus der Melodie ent-
faltet. Man wird allerdings leichter geneigt sein,
diesen Sachverhalt bei einer schlichten musi-
kalischen Weise anzuerkennen als bei einer
mehrsätzigen Sonate oder Symphonie. Ihr langer
Atem ist nicht Gnade einer glücklichen Ein-
gebung, sondern gestählt durch Arbeit. Gewiß:
dieses Ausleben in der Musik ist schlechterdings
unmöglich, ohne ihre Voraussetzungen zu be-
herrschen. Aber sie allein reichen nicht hin,
wie die Kenntnis einer Sprache nicht genügt,