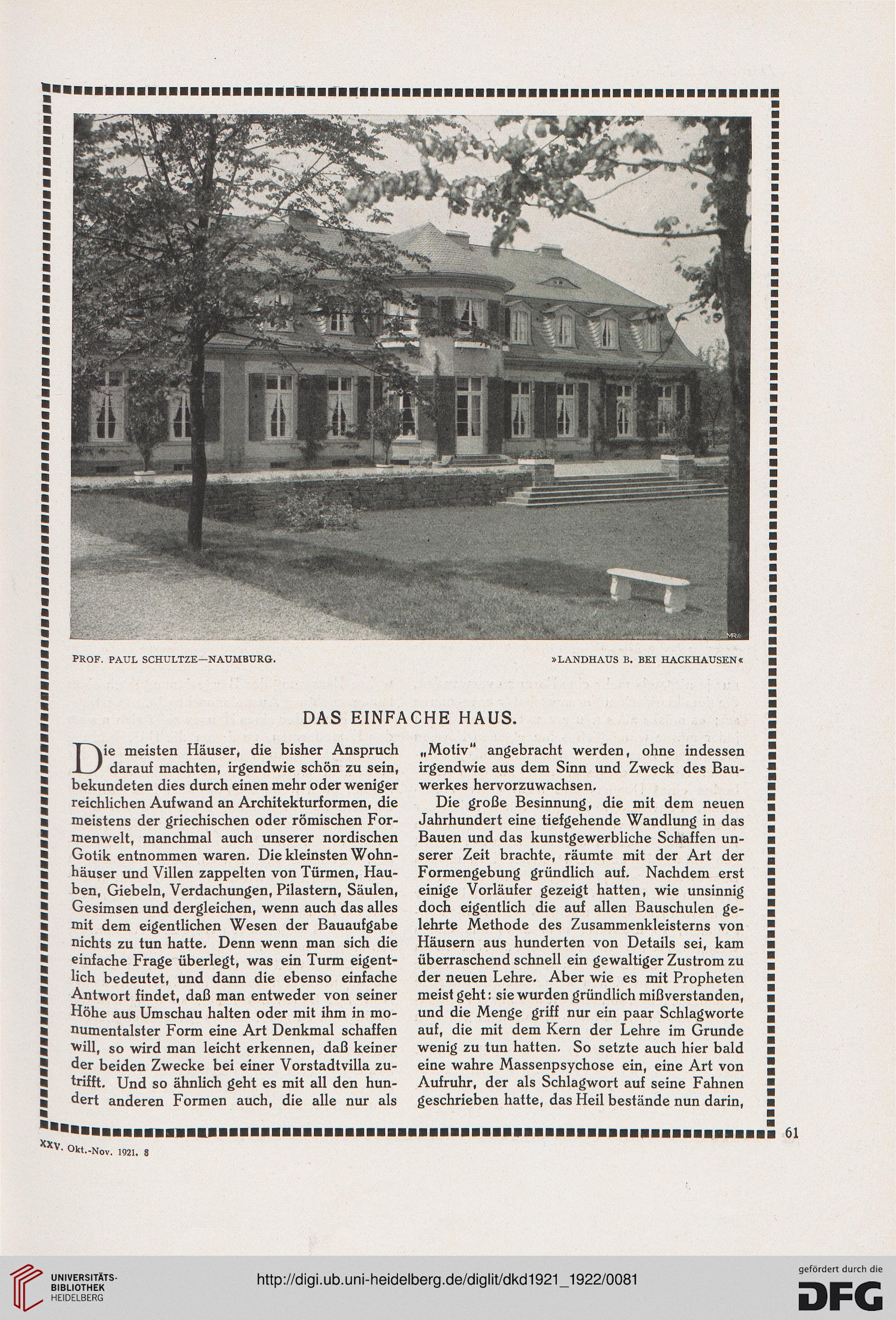PROF. PAUL SCHULTZE—NAUMBURG. »LANDHAUS B. BEI HACKHAUSEN«
DAS EINFACHE HAUS.
Die meisten Häuser, die bisher Anspruch
darauf machten, irgendwie schön zu sein,
bekundeten dies durch einen mehr oder weniger
reichlichen Aufwand an Architekturformen, die
meistens der griechischen oder römischen For-
menwelt, manchmal auch unserer nordischen
Gotik entnommen waren. Die kleinsten Wohn-
häuser und Villen zappelten von Türmen, Hau-
ben, Giebeln, Verdachungen, Pilastern, Säulen,
Gesimsen und dergleichen, wenn auch das alles
mit dem eigentlichen Wesen der Bauaufgabe
nichts zu tun hatte. Denn wenn man sich die
einfache Frage überlegt, was ein Turm eigent-
lich bedeutet, und dann die ebenso einfache
Antwort findet, daß man entweder von seiner
Höhe aus Umschau halten oder mit ihm in mo-
numentalster Form eine Art Denkmal schaffen
will, so wird man leicht erkennen, daß keiner
der beiden Zwecke bei einer Vorstadtvilla zu-
trifft. Und so ähnlich geht es mit all den hun-
dert anderen Formen auch, die alle nur als
„Motiv" angebracht werden, ohne indessen
irgendwie aus dem Sinn und Zweck des Bau-
werkes hervorzuwachsen.
Die große Besinnung, die mit dem neuen
Jahrhundert eine tiefgehende Wandlung in das
Bauen und das kunstgewerbliche Schaffen un-
serer Zeit brachte, räumte mit der Art der
Formengebung gründlich auf. Nachdem erst
einige Vorläufer gezeigt hatten, wie unsinnig
doch eigentlich die auf allen Bauschulen ge-
lehrte Methode des Zusammenkleisterns von
Häusern aus hunderten von Details sei, kam
überraschend schnell ein gewaltiger Zustrom zu
der neuen Lehre. Aber wie es mit Propheten
meist geht: sie wurden gründlich mißverstanden,
und die Menge griff nur ein paar Schlagworte
auf, die mit dem Kern der Lehre im Grunde
wenig zu tun hatten. So setzte auch hier bald
eine wahre Massenpsychose ein, eine Art von
Aufruhr, der als Schlagwort auf seine Fahnen
geschrieben hatte, das Heil bestände nun darin,
• Okt.-Nov. 1921. 8
DAS EINFACHE HAUS.
Die meisten Häuser, die bisher Anspruch
darauf machten, irgendwie schön zu sein,
bekundeten dies durch einen mehr oder weniger
reichlichen Aufwand an Architekturformen, die
meistens der griechischen oder römischen For-
menwelt, manchmal auch unserer nordischen
Gotik entnommen waren. Die kleinsten Wohn-
häuser und Villen zappelten von Türmen, Hau-
ben, Giebeln, Verdachungen, Pilastern, Säulen,
Gesimsen und dergleichen, wenn auch das alles
mit dem eigentlichen Wesen der Bauaufgabe
nichts zu tun hatte. Denn wenn man sich die
einfache Frage überlegt, was ein Turm eigent-
lich bedeutet, und dann die ebenso einfache
Antwort findet, daß man entweder von seiner
Höhe aus Umschau halten oder mit ihm in mo-
numentalster Form eine Art Denkmal schaffen
will, so wird man leicht erkennen, daß keiner
der beiden Zwecke bei einer Vorstadtvilla zu-
trifft. Und so ähnlich geht es mit all den hun-
dert anderen Formen auch, die alle nur als
„Motiv" angebracht werden, ohne indessen
irgendwie aus dem Sinn und Zweck des Bau-
werkes hervorzuwachsen.
Die große Besinnung, die mit dem neuen
Jahrhundert eine tiefgehende Wandlung in das
Bauen und das kunstgewerbliche Schaffen un-
serer Zeit brachte, räumte mit der Art der
Formengebung gründlich auf. Nachdem erst
einige Vorläufer gezeigt hatten, wie unsinnig
doch eigentlich die auf allen Bauschulen ge-
lehrte Methode des Zusammenkleisterns von
Häusern aus hunderten von Details sei, kam
überraschend schnell ein gewaltiger Zustrom zu
der neuen Lehre. Aber wie es mit Propheten
meist geht: sie wurden gründlich mißverstanden,
und die Menge griff nur ein paar Schlagworte
auf, die mit dem Kern der Lehre im Grunde
wenig zu tun hatten. So setzte auch hier bald
eine wahre Massenpsychose ein, eine Art von
Aufruhr, der als Schlagwort auf seine Fahnen
geschrieben hatte, das Heil bestände nun darin,
• Okt.-Nov. 1921. 8