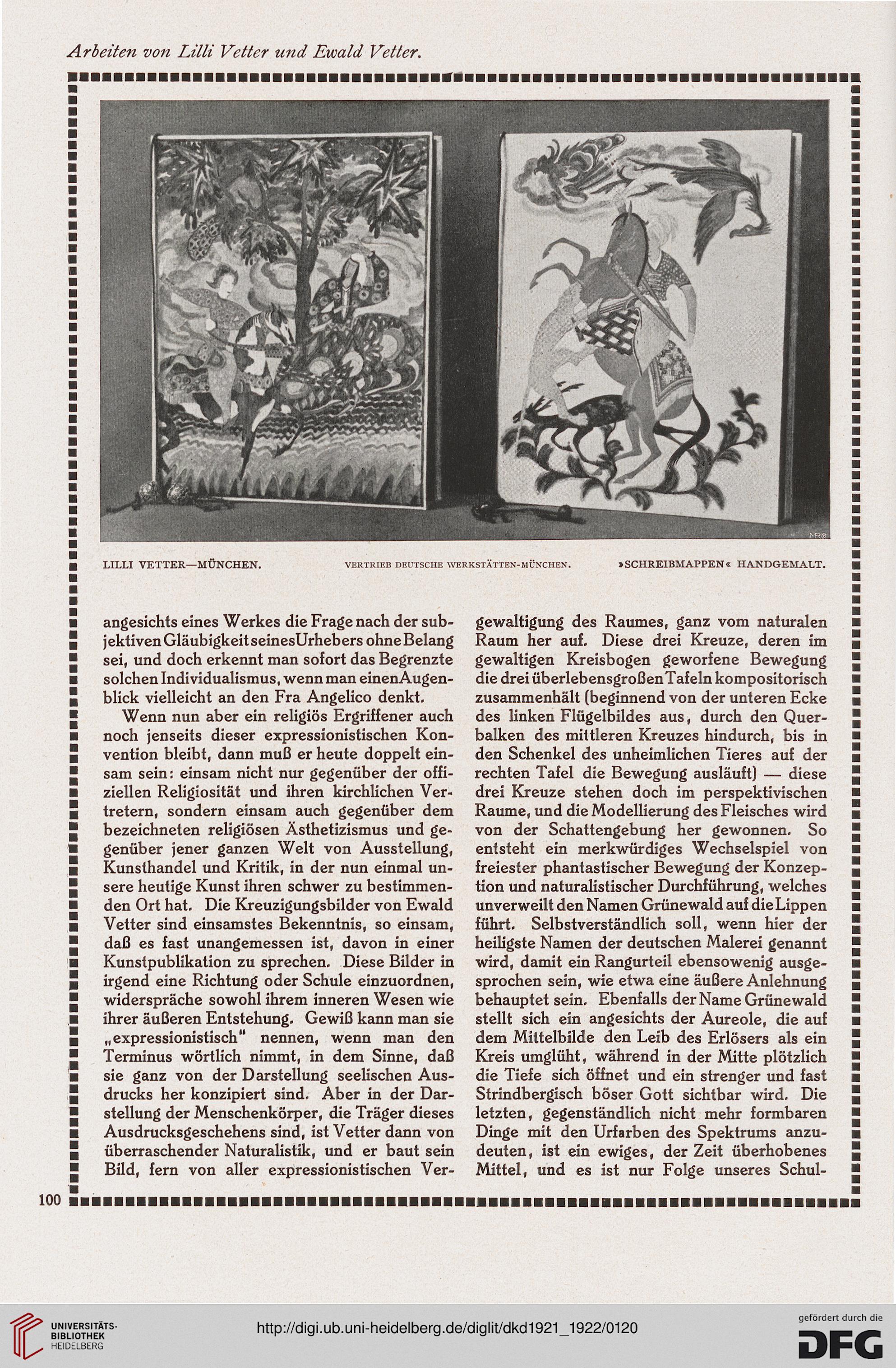Arbeiten von Lilli Vetter und Ewald Vetter.
LILLI VETTER—MÜNCHEN.
VERTRIEB DEUTSCHE WliK KS TA 1' TEN - MÜNCHEN.
>SCHREIBMAPPEN« HANDGEMALT.
angesichts eines Werkes die Frage nach der sub-
jektiven GläubigkeitseinesUrhebers ohne Belang
sei, und doch erkennt man sofort das Begrenzte
solchen Individualismus, wenn man einenAugen-
blick vielleicht an den Fra Angelico denkt.
Wenn nun aber ein religiös Ergriffener auch
noch jenseits dieser expressionistischen Kon-
vention bleibt, dann muß er heute doppelt ein-
sam sein: einsam nicht nur gegenüber der offi-
ziellen Religiosität und ihren kirchlichen Ver-
tretern, sondern einsam auch gegenüber dem
bezeichneten religiösen Ästhetizismus und ge-
genüber jener ganzen Welt von Ausstellung,
Kunsthandel und Kritik, in der nun einmal un-
sere heutige Kunst ihren schwer zu bestimmen-
den Ort hat. Die Kreuzigungsbilder von Ewald
Vetter sind einsamstes Bekenntnis, so einsam,
daß es fast unangemessen ist, davon in einer
Kunstpublikation zu sprechen. Diese Bilder in
irgend eine Richtung oder Schule einzuordnen,
widerspräche sowohl ihrem inneren Wesen wie
ihrer äußeren Entstehung. Gewiß kann man sie
„expressionistisch" nennen, wenn man den
Terminus wörtlich nimmt, in dem Sinne, daß
sie ganz von der Darstellung seelischen Aus-
drucks her konzipiert sind. Aber in der Dar-
stellung der Menschenkörper, die Träger dieses
Ausdrucksgeschehens sind, ist Vetter dann von
überraschender Naturalistik, und er baut sein
Bild, fern von aller expressionistischen Ver-
gewaltigung des Raumes, ganz vom naturalen
Raum her auf. Diese drei Kreuze, deren im
gewaltigen Kreisbogen geworfene Bewegung
die drei überlebensgroßen Tafeln kompositorisch
zusammenhält (beginnend von der unteren Ecke
des linken Flügelbildes aus, durch den Quer-
balken des mittleren Kreuzes hindurch, bis in
den Schenkel des unheimlichen Tieres auf der
rechten Tafel die Bewegung ausläuft) — diese
drei Kreuze stehen doch im perspektivischen
Räume, und die Modellierung des Fleisches wird
von der Schattengebung her gewonnen. So
entsteht ein merkwürdiges Wechselspiel von
freiester phantastischer Bewegung der Konzep-
tion und naturalistischer Durchführung, welches
unverweilt den Namen Grünewald auf die Lippen
führt. Selbstverständlich soll, wenn hier der
heiligste Namen der deutschen Malerei genannt
wird, damit ein Rangurteil ebensowenig ausge-
sprochen sein, wie etwa eine äußere Anlehnung
behauptet sein. Ebenfalls der Name Grünewald
stellt sich ein angesichts der Aureole, die auf
dem Mittelbilde den Leib des Erlösers als ein
Kreis umglüht, während in der Mitte plötzlich
die Tiefe sich öffnet und ein strenger und fast
Strindbergisch böser Gott sichtbar wird. Die
letzten, gegenständlich nicht mehr formbaren
Dinge mit den Urfarben des Spektrums anzu-
deuten, ist ein ewiges, der Zeit überhobenes
Mittel, und es ist nur Folge unseres Schul-
LILLI VETTER—MÜNCHEN.
VERTRIEB DEUTSCHE WliK KS TA 1' TEN - MÜNCHEN.
>SCHREIBMAPPEN« HANDGEMALT.
angesichts eines Werkes die Frage nach der sub-
jektiven GläubigkeitseinesUrhebers ohne Belang
sei, und doch erkennt man sofort das Begrenzte
solchen Individualismus, wenn man einenAugen-
blick vielleicht an den Fra Angelico denkt.
Wenn nun aber ein religiös Ergriffener auch
noch jenseits dieser expressionistischen Kon-
vention bleibt, dann muß er heute doppelt ein-
sam sein: einsam nicht nur gegenüber der offi-
ziellen Religiosität und ihren kirchlichen Ver-
tretern, sondern einsam auch gegenüber dem
bezeichneten religiösen Ästhetizismus und ge-
genüber jener ganzen Welt von Ausstellung,
Kunsthandel und Kritik, in der nun einmal un-
sere heutige Kunst ihren schwer zu bestimmen-
den Ort hat. Die Kreuzigungsbilder von Ewald
Vetter sind einsamstes Bekenntnis, so einsam,
daß es fast unangemessen ist, davon in einer
Kunstpublikation zu sprechen. Diese Bilder in
irgend eine Richtung oder Schule einzuordnen,
widerspräche sowohl ihrem inneren Wesen wie
ihrer äußeren Entstehung. Gewiß kann man sie
„expressionistisch" nennen, wenn man den
Terminus wörtlich nimmt, in dem Sinne, daß
sie ganz von der Darstellung seelischen Aus-
drucks her konzipiert sind. Aber in der Dar-
stellung der Menschenkörper, die Träger dieses
Ausdrucksgeschehens sind, ist Vetter dann von
überraschender Naturalistik, und er baut sein
Bild, fern von aller expressionistischen Ver-
gewaltigung des Raumes, ganz vom naturalen
Raum her auf. Diese drei Kreuze, deren im
gewaltigen Kreisbogen geworfene Bewegung
die drei überlebensgroßen Tafeln kompositorisch
zusammenhält (beginnend von der unteren Ecke
des linken Flügelbildes aus, durch den Quer-
balken des mittleren Kreuzes hindurch, bis in
den Schenkel des unheimlichen Tieres auf der
rechten Tafel die Bewegung ausläuft) — diese
drei Kreuze stehen doch im perspektivischen
Räume, und die Modellierung des Fleisches wird
von der Schattengebung her gewonnen. So
entsteht ein merkwürdiges Wechselspiel von
freiester phantastischer Bewegung der Konzep-
tion und naturalistischer Durchführung, welches
unverweilt den Namen Grünewald auf die Lippen
führt. Selbstverständlich soll, wenn hier der
heiligste Namen der deutschen Malerei genannt
wird, damit ein Rangurteil ebensowenig ausge-
sprochen sein, wie etwa eine äußere Anlehnung
behauptet sein. Ebenfalls der Name Grünewald
stellt sich ein angesichts der Aureole, die auf
dem Mittelbilde den Leib des Erlösers als ein
Kreis umglüht, während in der Mitte plötzlich
die Tiefe sich öffnet und ein strenger und fast
Strindbergisch böser Gott sichtbar wird. Die
letzten, gegenständlich nicht mehr formbaren
Dinge mit den Urfarben des Spektrums anzu-
deuten, ist ein ewiges, der Zeit überhobenes
Mittel, und es ist nur Folge unseres Schul-