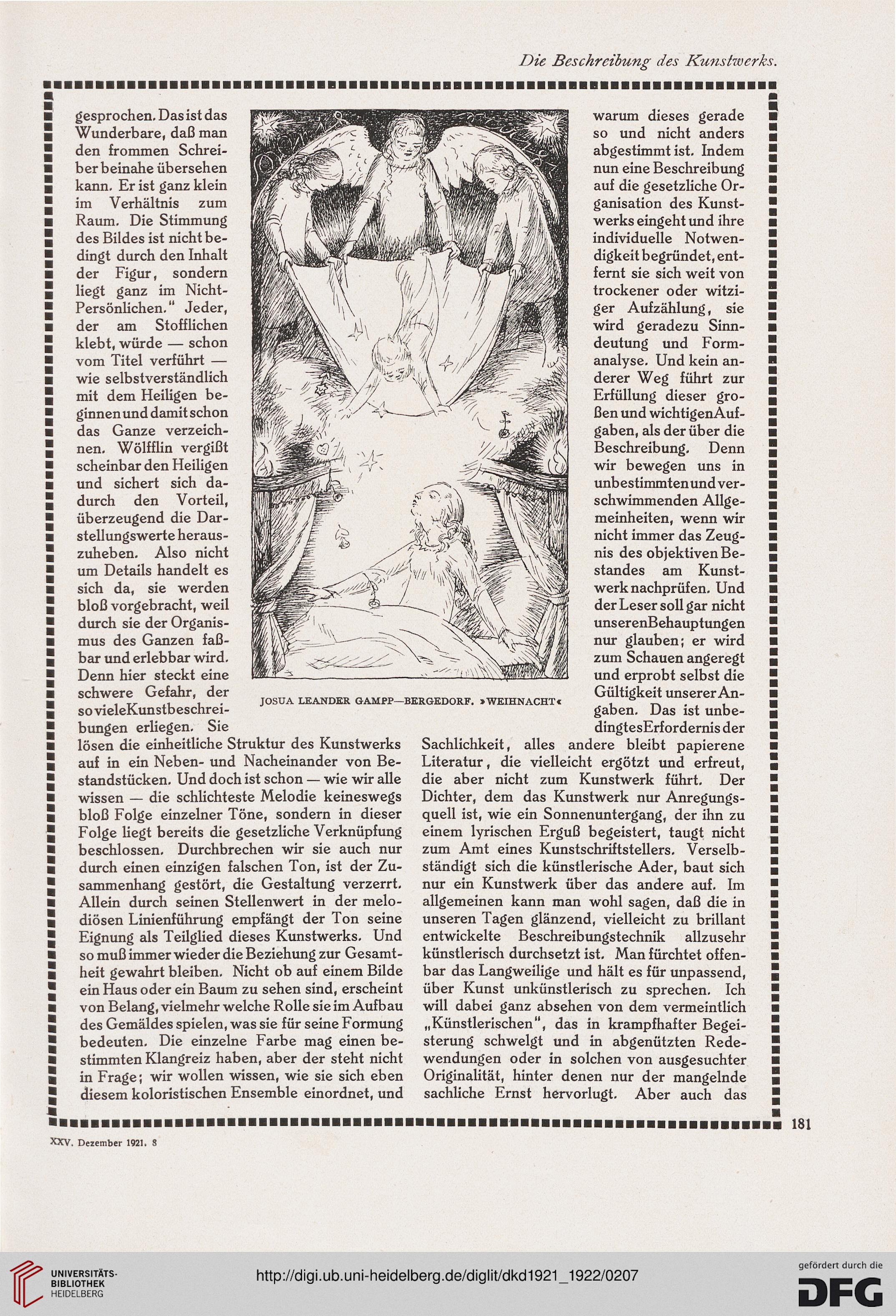Die Beschreibung des Kunstivcrks.
gesprochen. Das ist das
Wunderbare, daß man
den frommen Schrei-
berbeinahe übersehen
kann. Er ist ganz klein
im Verhältnis zum
Raum. Die Stimmung
des Bildes ist nicht be-
dingt durch den Inhalt
der Figur, sondern
liegt ganz im Nicht-
Persönlichen. " Jeder,
der am Stofflichen
klebt, würde — schon
vom Titel verführt —
wie selbstverständlich
mit dem Heiligen be-
ginnen und damit schon
das Ganze verzeich-
nen. Wölfflin vergißt
scheinbar den Heiligen
und sichert sich da-
durch den Vorteil,
überzeugend die Dar-
stellungswerte heraus-
zuheben. Also nicht
um Details handelt es
sich da, sie werden
bloß vorgebracht, weil
durch sie der Organis-
mus des Ganzen faß-
bar und erlebbar wird.
Denn hier steckt eine
schwere Gefahr, der
sovieleKunstbeschrei-
bungen erliegen. Sie
lösen die einheitliche Struktur des Kunstwerks
auf in ein Neben- und Nacheinander von Be-
standstücken. Und doch ist schon — wie wir alle
wissen — die schlichteste Melodie keineswegs
bloß Folge einzelner Töne, sondern in dieser
Folge liegt bereits die gesetzliche Verknüpfung
beschlossen. Durchbrechen wir sie auch nur
durch einen einzigen falschen Ton, ist der Zu-
sammenhang gestört, die Gestaltung verzerrt.
Allein durch seinen Stellenwert in der melo-
diösen Linienführung empfängt der Ton seine
Eignung als Teilglied dieses Kunstwerks. Und
so muß immer wieder die Beziehung zur Gesamt-
heit gewahrt bleiben. Nicht ob auf einem Bilde
ein Haus oder ein Baum zu sehen sind, erscheint
von Belang, vielmehr welche Rolle sie im Aufbau
des Gemäldes spielen, was sie für seine Formung
bedeuten. Die einzelne Farbe mag einen be-
stimmten Klangreiz haben, aber der steht nicht
in Frage; wir wollen wissen, wie sie sich eben
diesem koloristischen Ensemble einordnet, und
JOSUA LEANDER GAMPP—BERGEDORF. > WEIHNACHT <
warum dieses gerade
so und nicht anders
abgestimmt ist. Indem
nun eine Beschreibung
auf die gesetzliche Or-
ganisation des Kunst-
werks eingeht und ihre
individuelle Notwen-
digkeit begründet, ent-
fernt sie sich weit von
trockener oder witzi-
ger Aufzählung, sie
wird geradezu Sinn-
deutung und Form-
analyse. Und kein an-
derer Weg führt zur
Erfüllung dieser gro-
ßen und wichtigenAuf-
gaben, als der über die
Beschreibung. Denn
wir bewegen uns in
unbestimmten und ver-
schwimmenden Allge-
meinheiten, wenn wir
nicht immer das Zeug-
nis des objektiven Be-
standes am Kunst-
werknachprüfen. Und
der Leser soll gar nicht
unserenBehauptungen
nur glauben; er wird
zum Schauen angeregt
und erprobt selbst die
Gültigkeit unserer An-
gaben. Das ist unbe-
dingtesErf ordernis der
Sachlichkeit, alles andere bleibt papierene
Literatur, die vielleicht ergötzt und erfreut,
die aber nicht zum Kunstwerk führt. Der
Dichter, dem das Kunstwerk nur Anregungs-
quell ist, wie ein Sonnenuntergang, der ihn zu
einem lyrischen Erguß begeistert, taugt nicht
zum Amt eines Kunstschriftstellers. Verselb-
ständigt sich die künstlerische Ader, baut sich
nur ein Kunstwerk über das andere auf. Im
allgemeinen kann man wohl sagen, daß die in
unseren Tagen glänzend, vielleicht zu brillant
entwickelte Beschreibungstechnik allzusehr
künstlerisch durchsetzt ist. Man fürchtet offen-
bar das Langweilige und hält es für unpassend,
über Kunst unkünstlerisch zu sprechen. Ich
will dabei ganz absehen von dem vermeintlich
„Künstlerischen", das in krampfhafter Begei-
sterung schwelgt und in abgenützten Rede-
wendungen oder in solchen von ausgesuchter
Originalität, hinter denen nur der mangelnde
sachliche Ernst hervorlugt. Aber auch das
XXV. Dezember 1921. 8
gesprochen. Das ist das
Wunderbare, daß man
den frommen Schrei-
berbeinahe übersehen
kann. Er ist ganz klein
im Verhältnis zum
Raum. Die Stimmung
des Bildes ist nicht be-
dingt durch den Inhalt
der Figur, sondern
liegt ganz im Nicht-
Persönlichen. " Jeder,
der am Stofflichen
klebt, würde — schon
vom Titel verführt —
wie selbstverständlich
mit dem Heiligen be-
ginnen und damit schon
das Ganze verzeich-
nen. Wölfflin vergißt
scheinbar den Heiligen
und sichert sich da-
durch den Vorteil,
überzeugend die Dar-
stellungswerte heraus-
zuheben. Also nicht
um Details handelt es
sich da, sie werden
bloß vorgebracht, weil
durch sie der Organis-
mus des Ganzen faß-
bar und erlebbar wird.
Denn hier steckt eine
schwere Gefahr, der
sovieleKunstbeschrei-
bungen erliegen. Sie
lösen die einheitliche Struktur des Kunstwerks
auf in ein Neben- und Nacheinander von Be-
standstücken. Und doch ist schon — wie wir alle
wissen — die schlichteste Melodie keineswegs
bloß Folge einzelner Töne, sondern in dieser
Folge liegt bereits die gesetzliche Verknüpfung
beschlossen. Durchbrechen wir sie auch nur
durch einen einzigen falschen Ton, ist der Zu-
sammenhang gestört, die Gestaltung verzerrt.
Allein durch seinen Stellenwert in der melo-
diösen Linienführung empfängt der Ton seine
Eignung als Teilglied dieses Kunstwerks. Und
so muß immer wieder die Beziehung zur Gesamt-
heit gewahrt bleiben. Nicht ob auf einem Bilde
ein Haus oder ein Baum zu sehen sind, erscheint
von Belang, vielmehr welche Rolle sie im Aufbau
des Gemäldes spielen, was sie für seine Formung
bedeuten. Die einzelne Farbe mag einen be-
stimmten Klangreiz haben, aber der steht nicht
in Frage; wir wollen wissen, wie sie sich eben
diesem koloristischen Ensemble einordnet, und
JOSUA LEANDER GAMPP—BERGEDORF. > WEIHNACHT <
warum dieses gerade
so und nicht anders
abgestimmt ist. Indem
nun eine Beschreibung
auf die gesetzliche Or-
ganisation des Kunst-
werks eingeht und ihre
individuelle Notwen-
digkeit begründet, ent-
fernt sie sich weit von
trockener oder witzi-
ger Aufzählung, sie
wird geradezu Sinn-
deutung und Form-
analyse. Und kein an-
derer Weg führt zur
Erfüllung dieser gro-
ßen und wichtigenAuf-
gaben, als der über die
Beschreibung. Denn
wir bewegen uns in
unbestimmten und ver-
schwimmenden Allge-
meinheiten, wenn wir
nicht immer das Zeug-
nis des objektiven Be-
standes am Kunst-
werknachprüfen. Und
der Leser soll gar nicht
unserenBehauptungen
nur glauben; er wird
zum Schauen angeregt
und erprobt selbst die
Gültigkeit unserer An-
gaben. Das ist unbe-
dingtesErf ordernis der
Sachlichkeit, alles andere bleibt papierene
Literatur, die vielleicht ergötzt und erfreut,
die aber nicht zum Kunstwerk führt. Der
Dichter, dem das Kunstwerk nur Anregungs-
quell ist, wie ein Sonnenuntergang, der ihn zu
einem lyrischen Erguß begeistert, taugt nicht
zum Amt eines Kunstschriftstellers. Verselb-
ständigt sich die künstlerische Ader, baut sich
nur ein Kunstwerk über das andere auf. Im
allgemeinen kann man wohl sagen, daß die in
unseren Tagen glänzend, vielleicht zu brillant
entwickelte Beschreibungstechnik allzusehr
künstlerisch durchsetzt ist. Man fürchtet offen-
bar das Langweilige und hält es für unpassend,
über Kunst unkünstlerisch zu sprechen. Ich
will dabei ganz absehen von dem vermeintlich
„Künstlerischen", das in krampfhafter Begei-
sterung schwelgt und in abgenützten Rede-
wendungen oder in solchen von ausgesuchter
Originalität, hinter denen nur der mangelnde
sachliche Ernst hervorlugt. Aber auch das
XXV. Dezember 1921. 8