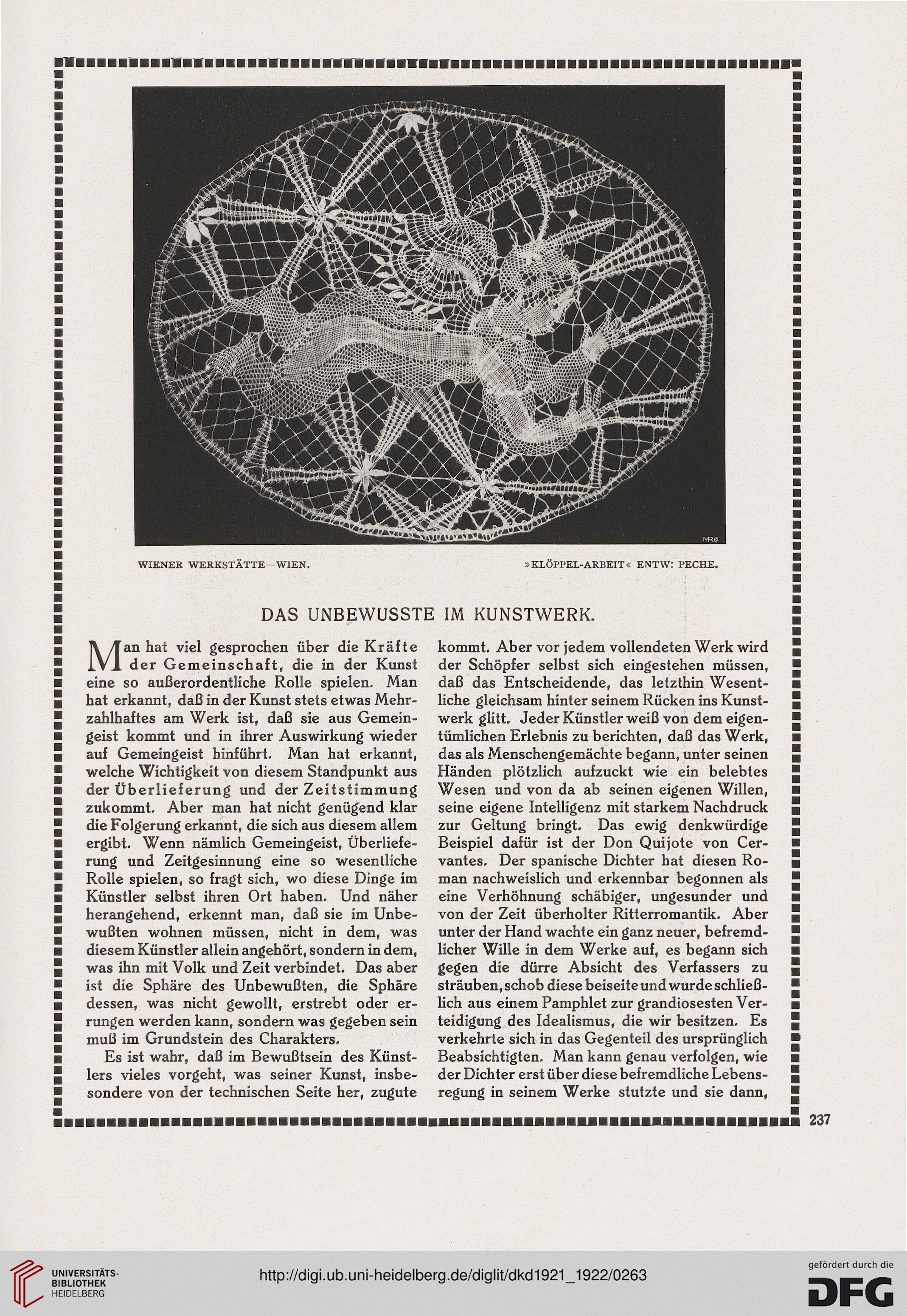Man hat viel gesprochen über die Kräfte
der Gemeinschaft, die in der Kunst
eine so außerordentliche Rolle spielen. Man
hat erkannt, daß in der Kunst stets etwas Mehr-
zahlhaftes am Werk ist, daß sie aus Gemein-
geist kommt und in ihrer Auswirkung wieder
auf Gemeingeist hinführt. Man hat erkannt,
welche Wichtigkeit von diesem Standpunkt aus
der Überlieferung und der Zeitstimmung
zukommt. Aber man hat nicht genügend klar
die Folgerung erkannt, die sich aus diesem allem
ergibt. Wenn nämlich Gemeingeist, Überliefe-
rung und Zeitgesinnung eine so wesentliche
Rolle spielen, so fragt sich, wo diese Dinge im
Künstler selbst ihren Ort haben. Und näher
herangehend, erkennt man, daß sie im Unbe-
wußten wohnen müssen, nicht in dem, was
diesem Künstler allein angehört, sondern in dem,
was ihn mit Volk und Zeit verbindet. Das aber
ist die Sphäre des Unbewußten, die Sphäre
dessen, was nicht gewollt, erstrebt oder er-
rungen werden kann, sondern was gegeben sein
muß im Grundstein des Charakters.
Es ist wahr, daß im Bewußtsein des Künst-
lers vieles vorgeht, was seiner Kunst, insbe-
sondere von der technischen Seite her, zugute
kommt. Aber vor jedem vollendeten Werk wird
der Schöpfer selbst sich eingestehen müssen,
daß das Entscheidende, das letzthin Wesent-
liche gleichsam hinter seinem Rücken ins Kunst-
werk glitt. Jeder Künstler weiß von dem eigen-
tümlichen Erlebnis zu berichten, daß das Werk,
das als Menschengemächte begann, unter seinen
Händen plötzlich aufzuckt wie ein belebtes
Wesen und von da ab seinen eigenen Willen,
seine eigene Intelligenz mit starkem Nachdruck
zur Geltung bringt. Das ewig denkwürdige
Beispiel dafür ist der Don Quijote von Cer-
vantes. Der spanische Dichter hat diesen Ro-
man nachweislich und erkennbar begonnen als
eine Verhöhnung schäbiger, ungesunder und
von der Zeit überholter Ritterromantik. Aber
unter der Hand wachte ein ganz neuer, befremd-
licher Wille in dem Werke auf, es begann sich
gegen die dürre Absicht des Verfassers zu
sträuben, schob diese beiseite und wurde schließ-
lich aus einem Pamphlet zur grandiosesten Ver-
teidigung des Idealismus, die wir besitzen. Es
verkehrte sich in das Gegenteil des ursprünglich
Beabsichtigten. Man kann genau verfolgen, wie
der Dichter erst über diese befremdliche Lebens-
regung in seinem Werke stutzte und sie dann,
mm
der Gemeinschaft, die in der Kunst
eine so außerordentliche Rolle spielen. Man
hat erkannt, daß in der Kunst stets etwas Mehr-
zahlhaftes am Werk ist, daß sie aus Gemein-
geist kommt und in ihrer Auswirkung wieder
auf Gemeingeist hinführt. Man hat erkannt,
welche Wichtigkeit von diesem Standpunkt aus
der Überlieferung und der Zeitstimmung
zukommt. Aber man hat nicht genügend klar
die Folgerung erkannt, die sich aus diesem allem
ergibt. Wenn nämlich Gemeingeist, Überliefe-
rung und Zeitgesinnung eine so wesentliche
Rolle spielen, so fragt sich, wo diese Dinge im
Künstler selbst ihren Ort haben. Und näher
herangehend, erkennt man, daß sie im Unbe-
wußten wohnen müssen, nicht in dem, was
diesem Künstler allein angehört, sondern in dem,
was ihn mit Volk und Zeit verbindet. Das aber
ist die Sphäre des Unbewußten, die Sphäre
dessen, was nicht gewollt, erstrebt oder er-
rungen werden kann, sondern was gegeben sein
muß im Grundstein des Charakters.
Es ist wahr, daß im Bewußtsein des Künst-
lers vieles vorgeht, was seiner Kunst, insbe-
sondere von der technischen Seite her, zugute
kommt. Aber vor jedem vollendeten Werk wird
der Schöpfer selbst sich eingestehen müssen,
daß das Entscheidende, das letzthin Wesent-
liche gleichsam hinter seinem Rücken ins Kunst-
werk glitt. Jeder Künstler weiß von dem eigen-
tümlichen Erlebnis zu berichten, daß das Werk,
das als Menschengemächte begann, unter seinen
Händen plötzlich aufzuckt wie ein belebtes
Wesen und von da ab seinen eigenen Willen,
seine eigene Intelligenz mit starkem Nachdruck
zur Geltung bringt. Das ewig denkwürdige
Beispiel dafür ist der Don Quijote von Cer-
vantes. Der spanische Dichter hat diesen Ro-
man nachweislich und erkennbar begonnen als
eine Verhöhnung schäbiger, ungesunder und
von der Zeit überholter Ritterromantik. Aber
unter der Hand wachte ein ganz neuer, befremd-
licher Wille in dem Werke auf, es begann sich
gegen die dürre Absicht des Verfassers zu
sträuben, schob diese beiseite und wurde schließ-
lich aus einem Pamphlet zur grandiosesten Ver-
teidigung des Idealismus, die wir besitzen. Es
verkehrte sich in das Gegenteil des ursprünglich
Beabsichtigten. Man kann genau verfolgen, wie
der Dichter erst über diese befremdliche Lebens-
regung in seinem Werke stutzte und sie dann,
mm