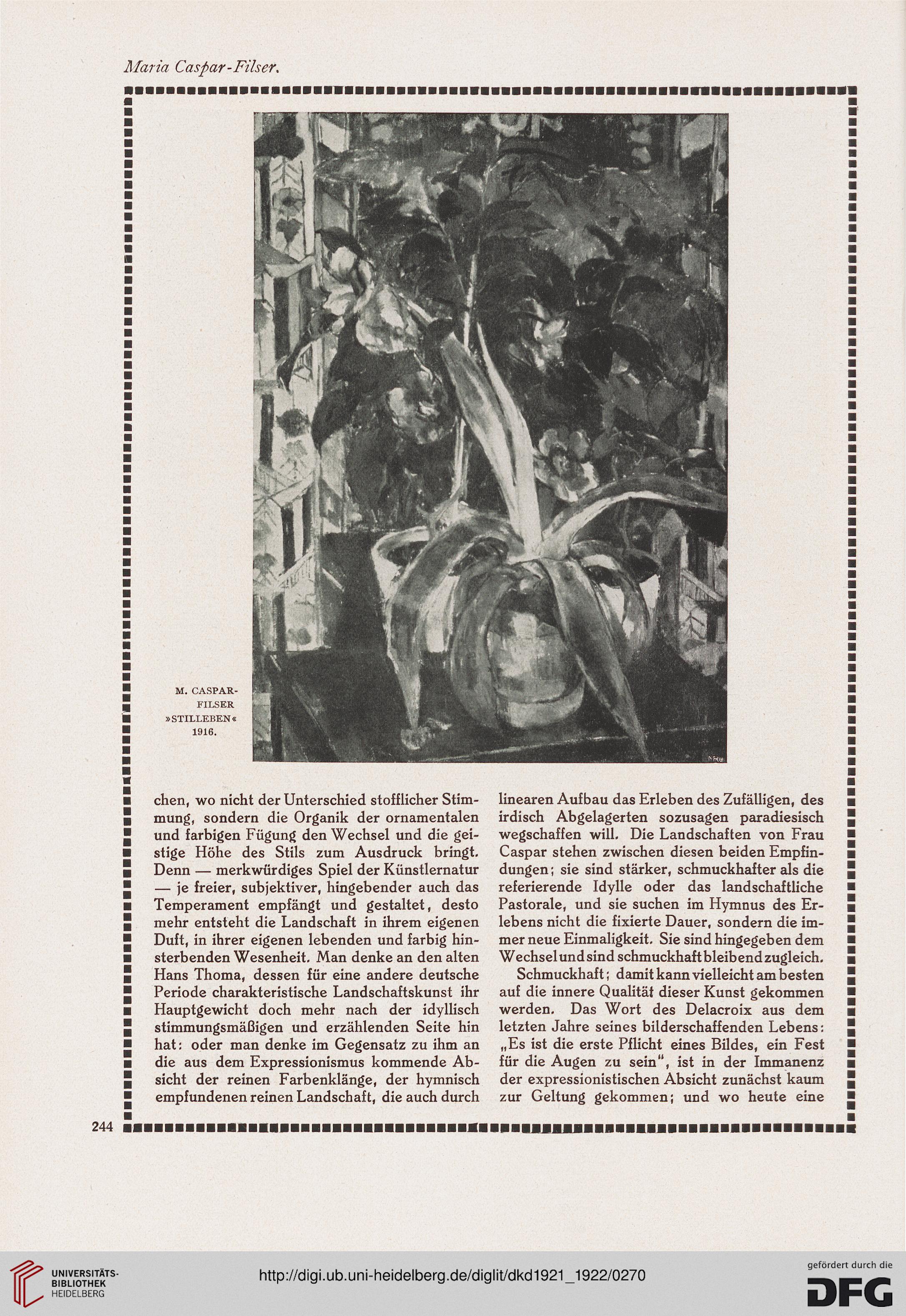Maria Caspar-Filser.
M. CASPAR-
FILS ER
»STILLEBEN«
1916.
chen, wo nicht der Unterschied stofflicher Stim-
mung, sondern die Organik der ornamentalen
und farbigen Fügung den Wechsel und die gei-
stige Höhe des Stils zum Ausdruck bringt.
Denn — merkwürdiges Spiel der Künstlernatur
— je freier, subjektiver, hingebender auch das
Temperament empfängt und gestaltet, desto
mehr entsteht die Landschaft in ihrem eigenen
Duft, in ihrer eigenen lebenden und farbig hin-
sterbenden Wesenheit. Man denke an den alten
Hans Thoma, dessen für eine andere deutsche
Periode charakteristische Landschaftskunst ihr
Hauptgewicht doch mehr nach der idyllisch
stimmungsmäßigen und erzählenden Seite hin
hat: oder man denke im Gegensatz zu ihm an
die aus dem Expressionismus kommende Ab-
sicht der reinen Farbenklänge, der hymnisch
empfundenen reinen Landschaft, die auch durch
linearen Aufbau das Erleben des Zufälligen, des
irdisch Abgelagerten sozusagen paradiesisch
wegschaffen will. Die Landschaften von Frau
Caspar stehen zwischen diesen beiden Empfin-
dungen ; sie sind stärker, schmuckhafter als die
referierende Idylle oder das landschaftliche
Pastorale, und sie suchen im Hymnus des Er-
lebens nicht die fixierte Dauer, sondern die im-
mer neue Einmaligkeit. Sie sind hingegeben dem
Wechselund sind schmuckhaft bleibend zugleich.
Schmuckhaft; damit kann vielleicht am besten
auf die innere Qualität dieser Kunst gekommen
werden. Das Wort des Delacroix aus dem
letzten Jahre seines bilderschaffenden Lebens:
„Es ist die erste Pflicht eines Bildes, ein Fest
für die Augen zu sein", ist in der Immanenz
der expressionistischen Absicht zunächst kaum
zur Geltung gekommen; und wo heute eine
244
■■MBB
M. CASPAR-
FILS ER
»STILLEBEN«
1916.
chen, wo nicht der Unterschied stofflicher Stim-
mung, sondern die Organik der ornamentalen
und farbigen Fügung den Wechsel und die gei-
stige Höhe des Stils zum Ausdruck bringt.
Denn — merkwürdiges Spiel der Künstlernatur
— je freier, subjektiver, hingebender auch das
Temperament empfängt und gestaltet, desto
mehr entsteht die Landschaft in ihrem eigenen
Duft, in ihrer eigenen lebenden und farbig hin-
sterbenden Wesenheit. Man denke an den alten
Hans Thoma, dessen für eine andere deutsche
Periode charakteristische Landschaftskunst ihr
Hauptgewicht doch mehr nach der idyllisch
stimmungsmäßigen und erzählenden Seite hin
hat: oder man denke im Gegensatz zu ihm an
die aus dem Expressionismus kommende Ab-
sicht der reinen Farbenklänge, der hymnisch
empfundenen reinen Landschaft, die auch durch
linearen Aufbau das Erleben des Zufälligen, des
irdisch Abgelagerten sozusagen paradiesisch
wegschaffen will. Die Landschaften von Frau
Caspar stehen zwischen diesen beiden Empfin-
dungen ; sie sind stärker, schmuckhafter als die
referierende Idylle oder das landschaftliche
Pastorale, und sie suchen im Hymnus des Er-
lebens nicht die fixierte Dauer, sondern die im-
mer neue Einmaligkeit. Sie sind hingegeben dem
Wechselund sind schmuckhaft bleibend zugleich.
Schmuckhaft; damit kann vielleicht am besten
auf die innere Qualität dieser Kunst gekommen
werden. Das Wort des Delacroix aus dem
letzten Jahre seines bilderschaffenden Lebens:
„Es ist die erste Pflicht eines Bildes, ein Fest
für die Augen zu sein", ist in der Immanenz
der expressionistischen Absicht zunächst kaum
zur Geltung gekommen; und wo heute eine
244
■■MBB