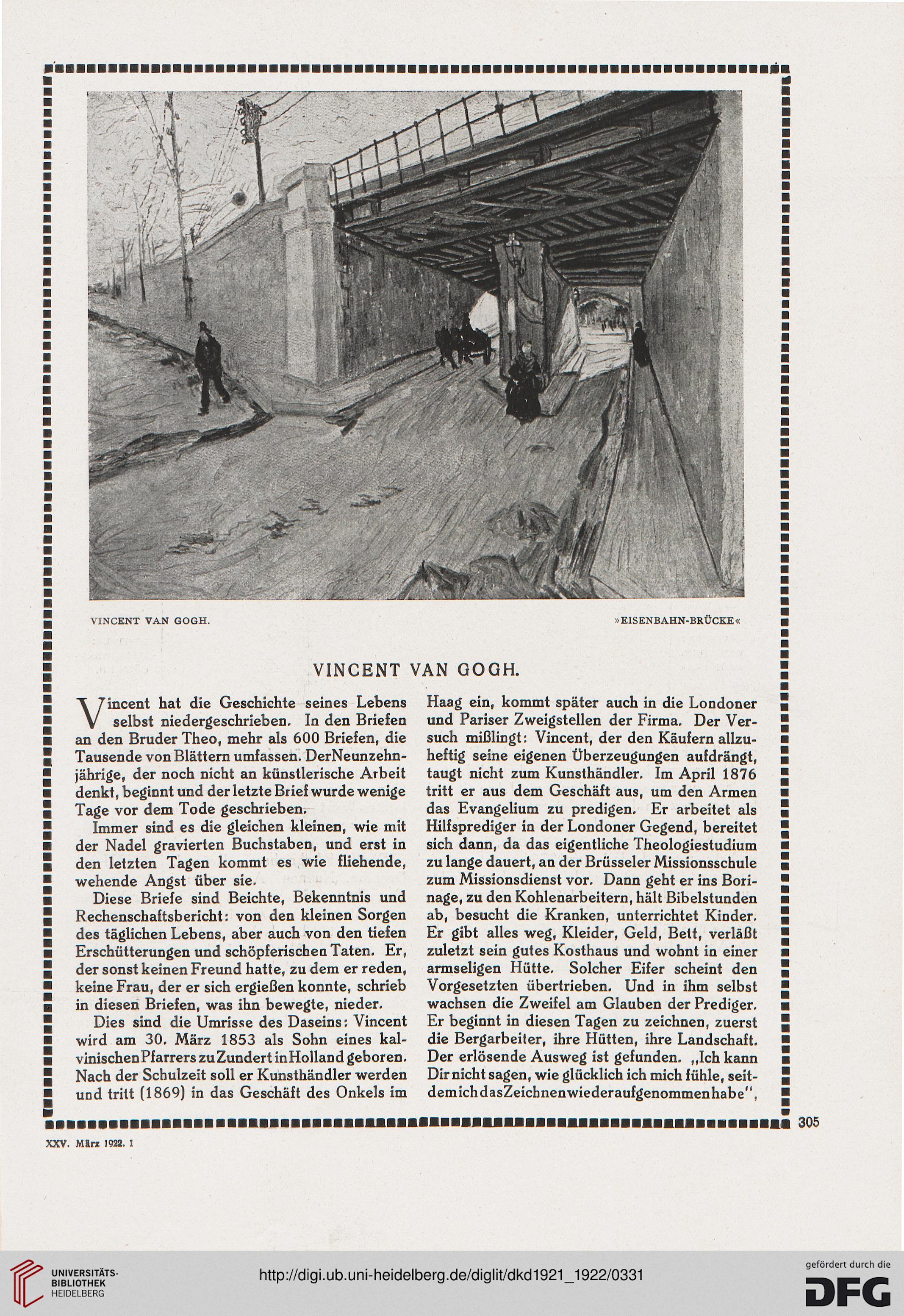VINCENT VAN GOGH. »EISENBAHN-BRÜCKE«
VINCENT VAN GOGH.
Vincent hat die Geschichte seines Lebens
selbst niedergeschrieben. In den Briefen
an den Bruder Theo, mehr als 600 Briefen, die
Tausende von Blättern umfassen. DerNeunzehn-
jährige, der noch nicht an künstlerische Arbeit
denkt, beginnt und der letzte Brief wurde wenige
Tage vor dem Tode geschrieben.
Immer sind es die gleichen kleinen, wie mit
der Nadel gravierten Buchstaben, und erst in
den letzten Tagen kommt es wie fliehende,
wehende Angst über sie.
Diese Briefe sind Beichte, Bekenntnis und
Rechenschaftsbericht: von den kleinen Sorgen
des täglichen Lebens, aber auch von den tiefen
Erschütterungen und schöpferischen Taten. Er,
der sonst keinen Freund hatte, zu dem er reden,
keine Frau, der er sich ergießen konnte, schrieb
in diesen Briefen, was ihn bewegte, nieder.
Dies sind die Umrisse des Daseins: Vincent
wird am 30. März 1853 als Sohn eines kal-
vinischenPfarrers zu Zundert inHolland geboren.
Nach der Schulzeit soll er Kunsthändler werden
und tritt (1869) in das Geschäft des Onkels im
Haag ein, kommt später auch in die Londoner
und Pariser Zweigstellen der Firma. Der Ver-
such mißlingt: Vincent, der den Käufern allzu-
heftig seine eigenen Überzeugungen aufdrängt,
taugt nicht zum Kunsthändler. Im April 1876
tritt er aus dem Geschäft aus, um den Armen
das Evangelium zu predigen. Er arbeitet als
Hilfsprediger in der Londoner Gegend, bereitet
sich dann, da das eigentliche Theologiestudium
zu lange dauert, an der Brüsseler Missionsschule
zum Missionsdienst vor. Dann geht er ins Bori-
nage, zu den Kohlenarbeitern, hält Bibelstunden
ab, besucht die Kranken, unterrichtet Kinder.
Er gibt alles weg, Kleider, Geld, Bett, verläßt
zuletzt sein gutes Kosthaus und wohnt in einer
armseligen Hütte. Solcher Eifer scheint den
Vorgesetzten übertrieben. Und in ihm selbst
wachsen die Zweifel am Glauben der Prediger.
Er beginnt in diesen Tagen zu zeichnen, zuerst
die Bergarbeiter, ihre Hütten, ihre Landschaft.
Der erlösende Ausweg ist gefunden. „Ich kann
Dir nicht sagen, wie glücklich ich mich fühle, seit-
demich dasZeicbnenwiederaufgenommenhabe",
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
XXV. Min 19M. I
VINCENT VAN GOGH.
Vincent hat die Geschichte seines Lebens
selbst niedergeschrieben. In den Briefen
an den Bruder Theo, mehr als 600 Briefen, die
Tausende von Blättern umfassen. DerNeunzehn-
jährige, der noch nicht an künstlerische Arbeit
denkt, beginnt und der letzte Brief wurde wenige
Tage vor dem Tode geschrieben.
Immer sind es die gleichen kleinen, wie mit
der Nadel gravierten Buchstaben, und erst in
den letzten Tagen kommt es wie fliehende,
wehende Angst über sie.
Diese Briefe sind Beichte, Bekenntnis und
Rechenschaftsbericht: von den kleinen Sorgen
des täglichen Lebens, aber auch von den tiefen
Erschütterungen und schöpferischen Taten. Er,
der sonst keinen Freund hatte, zu dem er reden,
keine Frau, der er sich ergießen konnte, schrieb
in diesen Briefen, was ihn bewegte, nieder.
Dies sind die Umrisse des Daseins: Vincent
wird am 30. März 1853 als Sohn eines kal-
vinischenPfarrers zu Zundert inHolland geboren.
Nach der Schulzeit soll er Kunsthändler werden
und tritt (1869) in das Geschäft des Onkels im
Haag ein, kommt später auch in die Londoner
und Pariser Zweigstellen der Firma. Der Ver-
such mißlingt: Vincent, der den Käufern allzu-
heftig seine eigenen Überzeugungen aufdrängt,
taugt nicht zum Kunsthändler. Im April 1876
tritt er aus dem Geschäft aus, um den Armen
das Evangelium zu predigen. Er arbeitet als
Hilfsprediger in der Londoner Gegend, bereitet
sich dann, da das eigentliche Theologiestudium
zu lange dauert, an der Brüsseler Missionsschule
zum Missionsdienst vor. Dann geht er ins Bori-
nage, zu den Kohlenarbeitern, hält Bibelstunden
ab, besucht die Kranken, unterrichtet Kinder.
Er gibt alles weg, Kleider, Geld, Bett, verläßt
zuletzt sein gutes Kosthaus und wohnt in einer
armseligen Hütte. Solcher Eifer scheint den
Vorgesetzten übertrieben. Und in ihm selbst
wachsen die Zweifel am Glauben der Prediger.
Er beginnt in diesen Tagen zu zeichnen, zuerst
die Bergarbeiter, ihre Hütten, ihre Landschaft.
Der erlösende Ausweg ist gefunden. „Ich kann
Dir nicht sagen, wie glücklich ich mich fühle, seit-
demich dasZeicbnenwiederaufgenommenhabe",
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
XXV. Min 19M. I