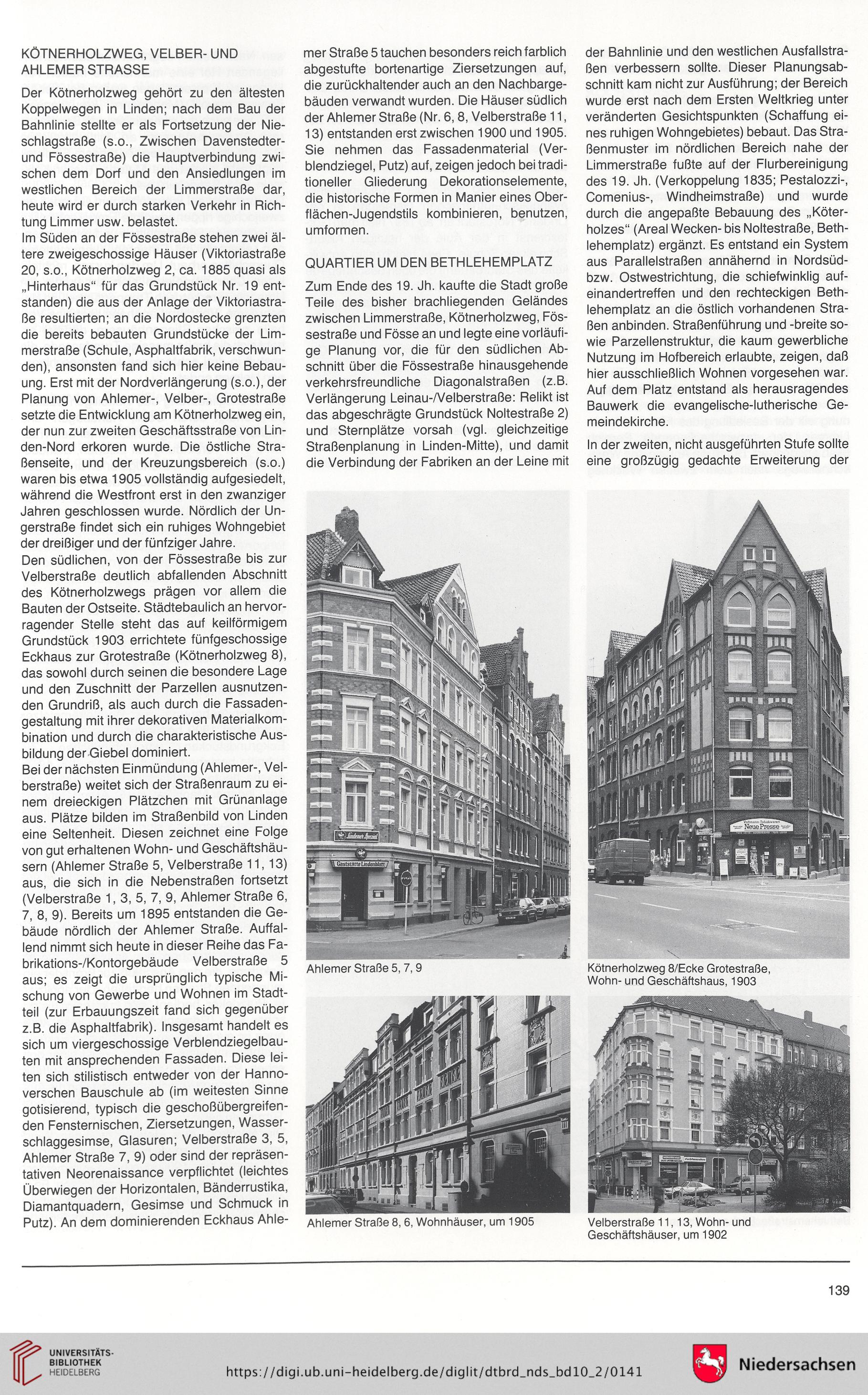KÖTNERHOLZWEG, VELBER- UND
AHLEMERSTRASSE
Der Kötnerholzweg gehört zu den ältesten
Koppelwegen in Linden; nach dem Bau der
Bahnlinie stellte er als Fortsetzung der Nie-
schlagstraße (s.o., Zwischen Davenstedter-
und Fössestraße) die Hauptverbindung zwi-
schen dem Dorf und den Ansiedlungen im
westlichen Bereich der Limmerstraße dar,
heute wird er durch starken Verkehr in Rich-
tung Limmer usw. belastet.
Im Süden an der Fössestraße stehen zwei äl-
tere zweigeschossige Häuser (Viktoriastraße
20, s.o., Kötnerholzweg 2, ca. 1885 quasi als
„Hinterhaus“ für das Grundstück Nr. 19 ent-
standen) die aus der Anlage der Viktoriastra-
ße resultierten; an die Nordostecke grenzten
die bereits bebauten Grundstücke der Lim-
merstraße (Schule, Asphaltfabrik, verschwun-
den), ansonsten fand sich hier keine Bebau-
ung. Erst mit der Nordverlängerung (s.o.), der
Planung von Ahlemer-, Velber-, Grotestraße
setzte die Entwicklung am Kötnerholzweg ein,
der nun zur zweiten Geschäftsstraße von Lin-
den-Nord erkoren wurde. Die östliche Stra-
ßenseite, und der Kreuzungsbereich (s.o.)
waren bis etwa 1905 vollständig aufgesiedelt,
während die Westfront erst in den zwanziger
Jahren geschlossen wurde. Nördlich der Un-
gerstraße findet sich ein ruhiges Wohngebiet
der dreißiger und der fünfziger Jahre.
Den südlichen, von der Fössestraße bis zur
Velberstraße deutlich abfallenden Abschnitt
des Kötnerholzwegs prägen vor allem die
Bauten der Ostseite. Städtebaulich an hervor-
ragender Stelle steht das auf keilförmigem
Grundstück 1903 errichtete fünfgeschossige
Eckhaus zur Grotestraße (Kötnerholzweg 8),
das sowohl durch seinen die besondere Lage
und den Zuschnitt der Parzellen ausnutzen-
den Grundriß, als auch durch die Fassaden-
gestaltung mit ihrer dekorativen Materialkom-
bination und durch die charakteristische Aus-
bildung der Giebel dominiert.
Bei der nächsten Einmündung (Ahlemer-, Vel-
berstraße) weitet sich der Straßenraum zu ei-
nem dreieckigen Plätzchen mit Grünanlage
aus. Plätze bilden im Straßenbild von Linden
eine Seltenheit. Diesen zeichnet eine Folge
von gut erhaltenen Wohn- und Geschäftshäu-
sern (Ahlemer Straße 5, Velberstraße 11, 13)
aus, die sich in die Nebenstraßen fortsetzt
(Velberstraße 1,3,5, 7, 9, Ahlemer Straße 6,
7, 8, 9). Bereits um 1895 entstanden die Ge-
bäude nördlich der Ahlemer Straße. Auffal-
lend nimmt sich heute in dieser Reihe das Fa-
brikations-/Kontorgebäude Velberstraße 5
aus; es zeigt die ursprünglich typische Mi-
schung von Gewerbe und Wohnen im Stadt-
teil (zur Erbauungszeit fand sich gegenüber
z.B. die Asphaltfabrik). Insgesamt handelt es
sich um viergeschossige Verblendziegelbau-
ten mit ansprechenden Fassaden. Diese lei-
ten sich stilistisch entweder von der Hanno-
verschen Bauschule ab (im weitesten Sinne
gotisierend, typisch die geschoßübergreifen-
den Fensternischen, Ziersetzungen, Wasser-
schlaggesimse, Glasuren; Velberstraße 3, 5,
Ahlemer Straße 7, 9) oder sind der repräsen-
tativen Neorenaissance verpflichtet (leichtes
Überwiegen der Horizontalen, Bänderrustika,
Diamantquadern, Gesimse und Schmuck in
Putz). An dem dominierenden Eckhaus Ahle-
mer Straße 5 tauchen besonders reich farblich
abgestufte bortenartige Ziersetzungen auf,
die zurückhaltender auch an den Nachbarge-
bäuden verwandt wurden. Die Häuser südlich
der Ahlemer Straße (Nr. 6, 8, Velberstraße 11,
13) entstanden erst zwischen 1900 und 1905.
Sie nehmen das Fassadenmaterial (Ver-
blendziegel, Putz) auf, zeigen jedoch bei tradi-
tioneller Gliederung Dekorationselemente,
die historische Formen in Manier eines Ober-
flächen-Jugendstils kombinieren, benutzen,
umformen.
QUARTIER UM DEN BETHLEHEMPLATZ
Zum Ende des 19. Jh. kaufte die Stadt große
Teile des bisher brachliegenden Geländes
zwischen Limmerstraße, Kötnerholzweg, Fös-
sestraße und Fösse an und legte eine vorläufi-
ge Planung vor, die für den südlichen Ab-
schnitt über die Fössestraße hinausgehende
verkehrsfreundliche Diagonalstraßen (z.B.
Verlängerung Leinau-/Velberstraße: Relikt ist
das abgeschrägte Grundstück Noltestraße 2)
und Sternplätze vorsah (vgl. gleichzeitige
Straßenplanung in Linden-Mitte), und damit
die Verbindung der Fabriken an der Leine mit
der Bahnlinie und den westlichen Ausfallstra-
ßen verbessern sollte. Dieser Planungsab-
schnitt kam nicht zur Ausführung; der Bereich
wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg unter
veränderten Gesichtspunkten (Schaffung ei-
nes ruhigen Wohngebietes) bebaut. Das Stra-
ßenmuster im nördlichen Bereich nahe der
Limmerstraße fußte auf der Flurbereinigung
des 19. Jh. (Verkoppelung 1835; Pestalozzi-,
Comenius-, Windheimstraße) und wurde
durch die angepaßte Bebauung des „Köter-
holzes“ (Areal Wecken- bis Noltestraße, Beth-
lehemplatz) ergänzt. Es entstand ein System
aus Parallelstraßen annähernd in Nordsüd-
bzw. Ostwestrichtung, die schiefwinklig auf-
einandertreffen und den rechteckigen Beth-
lehemplatz an die östlich vorhandenen Stra-
ßen anbinden. Straßenführung und -breite so-
wie Parzellenstruktur, die kaum gewerbliche
Nutzung im Hofbereich erlaubte, zeigen, daß
hier ausschließlich Wohnen vorgesehen war.
Auf dem Platz entstand als herausragendes
Bauwerk die evangelische-lutherische Ge-
meindekirche.
In der zweiten, nicht ausgeführten Stufe sollte
eine großzügig gedachte Erweiterung der
Ahlemer Straße 5, 7, 9
Ahlemer Straße 8, 6, Wohnhäuser, um 1905
Kötnerholzweg 8/Ecke Grotestraße,
Wohn- und Geschäftshaus, 1903
Velberstraße 11,13, Wohn- und
Geschäftshäuser, um 1902
139
AHLEMERSTRASSE
Der Kötnerholzweg gehört zu den ältesten
Koppelwegen in Linden; nach dem Bau der
Bahnlinie stellte er als Fortsetzung der Nie-
schlagstraße (s.o., Zwischen Davenstedter-
und Fössestraße) die Hauptverbindung zwi-
schen dem Dorf und den Ansiedlungen im
westlichen Bereich der Limmerstraße dar,
heute wird er durch starken Verkehr in Rich-
tung Limmer usw. belastet.
Im Süden an der Fössestraße stehen zwei äl-
tere zweigeschossige Häuser (Viktoriastraße
20, s.o., Kötnerholzweg 2, ca. 1885 quasi als
„Hinterhaus“ für das Grundstück Nr. 19 ent-
standen) die aus der Anlage der Viktoriastra-
ße resultierten; an die Nordostecke grenzten
die bereits bebauten Grundstücke der Lim-
merstraße (Schule, Asphaltfabrik, verschwun-
den), ansonsten fand sich hier keine Bebau-
ung. Erst mit der Nordverlängerung (s.o.), der
Planung von Ahlemer-, Velber-, Grotestraße
setzte die Entwicklung am Kötnerholzweg ein,
der nun zur zweiten Geschäftsstraße von Lin-
den-Nord erkoren wurde. Die östliche Stra-
ßenseite, und der Kreuzungsbereich (s.o.)
waren bis etwa 1905 vollständig aufgesiedelt,
während die Westfront erst in den zwanziger
Jahren geschlossen wurde. Nördlich der Un-
gerstraße findet sich ein ruhiges Wohngebiet
der dreißiger und der fünfziger Jahre.
Den südlichen, von der Fössestraße bis zur
Velberstraße deutlich abfallenden Abschnitt
des Kötnerholzwegs prägen vor allem die
Bauten der Ostseite. Städtebaulich an hervor-
ragender Stelle steht das auf keilförmigem
Grundstück 1903 errichtete fünfgeschossige
Eckhaus zur Grotestraße (Kötnerholzweg 8),
das sowohl durch seinen die besondere Lage
und den Zuschnitt der Parzellen ausnutzen-
den Grundriß, als auch durch die Fassaden-
gestaltung mit ihrer dekorativen Materialkom-
bination und durch die charakteristische Aus-
bildung der Giebel dominiert.
Bei der nächsten Einmündung (Ahlemer-, Vel-
berstraße) weitet sich der Straßenraum zu ei-
nem dreieckigen Plätzchen mit Grünanlage
aus. Plätze bilden im Straßenbild von Linden
eine Seltenheit. Diesen zeichnet eine Folge
von gut erhaltenen Wohn- und Geschäftshäu-
sern (Ahlemer Straße 5, Velberstraße 11, 13)
aus, die sich in die Nebenstraßen fortsetzt
(Velberstraße 1,3,5, 7, 9, Ahlemer Straße 6,
7, 8, 9). Bereits um 1895 entstanden die Ge-
bäude nördlich der Ahlemer Straße. Auffal-
lend nimmt sich heute in dieser Reihe das Fa-
brikations-/Kontorgebäude Velberstraße 5
aus; es zeigt die ursprünglich typische Mi-
schung von Gewerbe und Wohnen im Stadt-
teil (zur Erbauungszeit fand sich gegenüber
z.B. die Asphaltfabrik). Insgesamt handelt es
sich um viergeschossige Verblendziegelbau-
ten mit ansprechenden Fassaden. Diese lei-
ten sich stilistisch entweder von der Hanno-
verschen Bauschule ab (im weitesten Sinne
gotisierend, typisch die geschoßübergreifen-
den Fensternischen, Ziersetzungen, Wasser-
schlaggesimse, Glasuren; Velberstraße 3, 5,
Ahlemer Straße 7, 9) oder sind der repräsen-
tativen Neorenaissance verpflichtet (leichtes
Überwiegen der Horizontalen, Bänderrustika,
Diamantquadern, Gesimse und Schmuck in
Putz). An dem dominierenden Eckhaus Ahle-
mer Straße 5 tauchen besonders reich farblich
abgestufte bortenartige Ziersetzungen auf,
die zurückhaltender auch an den Nachbarge-
bäuden verwandt wurden. Die Häuser südlich
der Ahlemer Straße (Nr. 6, 8, Velberstraße 11,
13) entstanden erst zwischen 1900 und 1905.
Sie nehmen das Fassadenmaterial (Ver-
blendziegel, Putz) auf, zeigen jedoch bei tradi-
tioneller Gliederung Dekorationselemente,
die historische Formen in Manier eines Ober-
flächen-Jugendstils kombinieren, benutzen,
umformen.
QUARTIER UM DEN BETHLEHEMPLATZ
Zum Ende des 19. Jh. kaufte die Stadt große
Teile des bisher brachliegenden Geländes
zwischen Limmerstraße, Kötnerholzweg, Fös-
sestraße und Fösse an und legte eine vorläufi-
ge Planung vor, die für den südlichen Ab-
schnitt über die Fössestraße hinausgehende
verkehrsfreundliche Diagonalstraßen (z.B.
Verlängerung Leinau-/Velberstraße: Relikt ist
das abgeschrägte Grundstück Noltestraße 2)
und Sternplätze vorsah (vgl. gleichzeitige
Straßenplanung in Linden-Mitte), und damit
die Verbindung der Fabriken an der Leine mit
der Bahnlinie und den westlichen Ausfallstra-
ßen verbessern sollte. Dieser Planungsab-
schnitt kam nicht zur Ausführung; der Bereich
wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg unter
veränderten Gesichtspunkten (Schaffung ei-
nes ruhigen Wohngebietes) bebaut. Das Stra-
ßenmuster im nördlichen Bereich nahe der
Limmerstraße fußte auf der Flurbereinigung
des 19. Jh. (Verkoppelung 1835; Pestalozzi-,
Comenius-, Windheimstraße) und wurde
durch die angepaßte Bebauung des „Köter-
holzes“ (Areal Wecken- bis Noltestraße, Beth-
lehemplatz) ergänzt. Es entstand ein System
aus Parallelstraßen annähernd in Nordsüd-
bzw. Ostwestrichtung, die schiefwinklig auf-
einandertreffen und den rechteckigen Beth-
lehemplatz an die östlich vorhandenen Stra-
ßen anbinden. Straßenführung und -breite so-
wie Parzellenstruktur, die kaum gewerbliche
Nutzung im Hofbereich erlaubte, zeigen, daß
hier ausschließlich Wohnen vorgesehen war.
Auf dem Platz entstand als herausragendes
Bauwerk die evangelische-lutherische Ge-
meindekirche.
In der zweiten, nicht ausgeführten Stufe sollte
eine großzügig gedachte Erweiterung der
Ahlemer Straße 5, 7, 9
Ahlemer Straße 8, 6, Wohnhäuser, um 1905
Kötnerholzweg 8/Ecke Grotestraße,
Wohn- und Geschäftshaus, 1903
Velberstraße 11,13, Wohn- und
Geschäftshäuser, um 1902
139