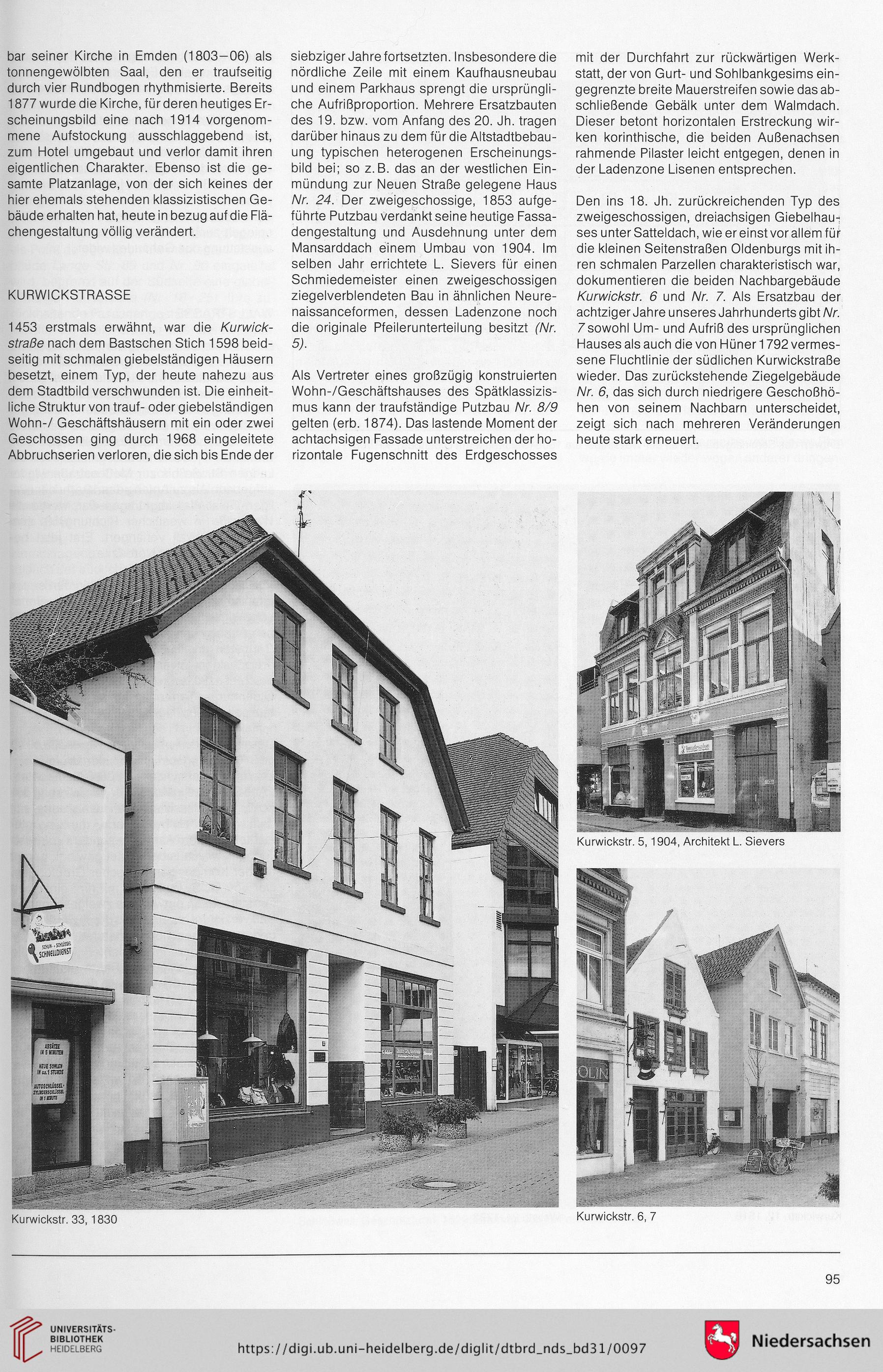bar seiner Kirche in Emden (1803-06) als
tonnengewölbten Saal, den er traufseitig
durch vier Rundbogen rhythmisierte. Bereits
1877 wurde die Kirche, förderen heutiges Er-
scheinungsbild eine nach 1914 vorgenom-
mene Aufstockung ausschlaggebend ist,
zum Hotel umgebaut und verlor damit ihren
eigentlichen Charakter. Ebenso ist die ge-
samte Platzanlage, von der sich keines der
hier ehemals stehenden klassizistischen Ge-
bäude erhalten hat, heute in bezug auf die Flä-
chengestaltung völlig verändert.
KURWICKSTRASSE
1453 erstmals erwähnt, war die Kurwick-
straße nach dem Bastschen Stich 1598 beid-
seitig mit schmalen giebelständigen Häusern
besetzt, einem Typ, der heute nahezu aus
dem Stadtbild verschwunden ist. Die einheit-
liche Struktur von traut- oder giebelständigen
Wohn-/ Geschäftshäusern mit ein oder zwei
Geschossen ging durch 1968 eingeleitete
Abbruchserien verloren, die sich bis Ende der
siebziger Jahre fortsetzten. Insbesondere die
nördliche Zeile mit einem Kaufhausneubau
und einem Parkhaus sprengt die ursprüngli-
che Aufrißproportion. Mehrere Ersatzbauten
des 19. bzw. vom Anfang des 20. Jh. tragen
darüber hinaus zu dem für die Altstadtbebau-
ung typischen heterogenen Erscheinungs-
bild bei; so z.B. das an der westlichen Ein-
mündung zur Neuen Straße gelegene Haus
Nr. 24. Der zweigeschossige, 1853 aufge-
führte Putzbau verdankt seine heutige Fassa-
dengestaltung und Ausdehnung unter dem
Mansarddach einem Umbau von 1904. Im
selben Jahr errichtete L. Sievers für einen
Schmiedemeister einen zweigeschossigen
ziegelverblendeten Bau in ähnlichen Neure-
naissanceformen, dessen Ladenzone noch
die originale Pfeilerunterteilung besitzt (Nr.
5).
Als Vertreter eines großzügig konstruierten
Wohn-/Geschäftshauses des Spätklassizis-
mus kann der traufständige Putzbau Nr. 8/9
gelten (erb. 1874). Das lastende Moment der
achtachsigen Fassade unterstreichen der ho-
rizontale Fugenschnitt des Erdgeschosses
Kurwickstr. 33, 1830
mit der Durchfahrt zur rückwärtigen Werk-
statt, der von Gurt- und Sohlbankgesims ein-
gegrenzte breite Mauerstreifen sowie das ab-
schließende Gebälk unter dem Walmdach.
Dieser betont horizontalen Erstreckung wir-
ken korinthische, die beiden Außenachsen
rahmende Pilaster leicht entgegen, denen in
der Ladenzone Lisenen entsprechen.
Den ins 18. Jh. zurückreichenden Typ des
zweigeschossigen, dreiachsigen Giebelhau-
ses unter Satteldach, wie er einst vor allem für
die kleinen Seitenstraßen Oldenburgs mit ih-
ren schmalen Parzellen charakteristisch war,
dokumentieren die beiden Nachbargebäude
Kurwickstr. 6 und Nr. 7. Als Ersatzbau der
achtziger Jahre unseres Jahrhunderts gibt Nr.
7sowohl Um- und Aufriß des ursprünglichen
Hauses als auch die von Hüner 1792 vermes-
sene Fluchtlinie der südlichen Kurwickstraße
wieder. Das zurückstehende Ziegelgebäude
Nr. 6, das sich durch niedrigere Geschoßhö-
hen von seinem Nachbarn unterscheidet,
zeigt sich nach mehreren Veränderungen
heute stark erneuert.
Kurwickstr. 5,1904, Architekt L. Sievers
Kurwickstr. 6, 7
95
tonnengewölbten Saal, den er traufseitig
durch vier Rundbogen rhythmisierte. Bereits
1877 wurde die Kirche, förderen heutiges Er-
scheinungsbild eine nach 1914 vorgenom-
mene Aufstockung ausschlaggebend ist,
zum Hotel umgebaut und verlor damit ihren
eigentlichen Charakter. Ebenso ist die ge-
samte Platzanlage, von der sich keines der
hier ehemals stehenden klassizistischen Ge-
bäude erhalten hat, heute in bezug auf die Flä-
chengestaltung völlig verändert.
KURWICKSTRASSE
1453 erstmals erwähnt, war die Kurwick-
straße nach dem Bastschen Stich 1598 beid-
seitig mit schmalen giebelständigen Häusern
besetzt, einem Typ, der heute nahezu aus
dem Stadtbild verschwunden ist. Die einheit-
liche Struktur von traut- oder giebelständigen
Wohn-/ Geschäftshäusern mit ein oder zwei
Geschossen ging durch 1968 eingeleitete
Abbruchserien verloren, die sich bis Ende der
siebziger Jahre fortsetzten. Insbesondere die
nördliche Zeile mit einem Kaufhausneubau
und einem Parkhaus sprengt die ursprüngli-
che Aufrißproportion. Mehrere Ersatzbauten
des 19. bzw. vom Anfang des 20. Jh. tragen
darüber hinaus zu dem für die Altstadtbebau-
ung typischen heterogenen Erscheinungs-
bild bei; so z.B. das an der westlichen Ein-
mündung zur Neuen Straße gelegene Haus
Nr. 24. Der zweigeschossige, 1853 aufge-
führte Putzbau verdankt seine heutige Fassa-
dengestaltung und Ausdehnung unter dem
Mansarddach einem Umbau von 1904. Im
selben Jahr errichtete L. Sievers für einen
Schmiedemeister einen zweigeschossigen
ziegelverblendeten Bau in ähnlichen Neure-
naissanceformen, dessen Ladenzone noch
die originale Pfeilerunterteilung besitzt (Nr.
5).
Als Vertreter eines großzügig konstruierten
Wohn-/Geschäftshauses des Spätklassizis-
mus kann der traufständige Putzbau Nr. 8/9
gelten (erb. 1874). Das lastende Moment der
achtachsigen Fassade unterstreichen der ho-
rizontale Fugenschnitt des Erdgeschosses
Kurwickstr. 33, 1830
mit der Durchfahrt zur rückwärtigen Werk-
statt, der von Gurt- und Sohlbankgesims ein-
gegrenzte breite Mauerstreifen sowie das ab-
schließende Gebälk unter dem Walmdach.
Dieser betont horizontalen Erstreckung wir-
ken korinthische, die beiden Außenachsen
rahmende Pilaster leicht entgegen, denen in
der Ladenzone Lisenen entsprechen.
Den ins 18. Jh. zurückreichenden Typ des
zweigeschossigen, dreiachsigen Giebelhau-
ses unter Satteldach, wie er einst vor allem für
die kleinen Seitenstraßen Oldenburgs mit ih-
ren schmalen Parzellen charakteristisch war,
dokumentieren die beiden Nachbargebäude
Kurwickstr. 6 und Nr. 7. Als Ersatzbau der
achtziger Jahre unseres Jahrhunderts gibt Nr.
7sowohl Um- und Aufriß des ursprünglichen
Hauses als auch die von Hüner 1792 vermes-
sene Fluchtlinie der südlichen Kurwickstraße
wieder. Das zurückstehende Ziegelgebäude
Nr. 6, das sich durch niedrigere Geschoßhö-
hen von seinem Nachbarn unterscheidet,
zeigt sich nach mehreren Veränderungen
heute stark erneuert.
Kurwickstr. 5,1904, Architekt L. Sievers
Kurwickstr. 6, 7
95