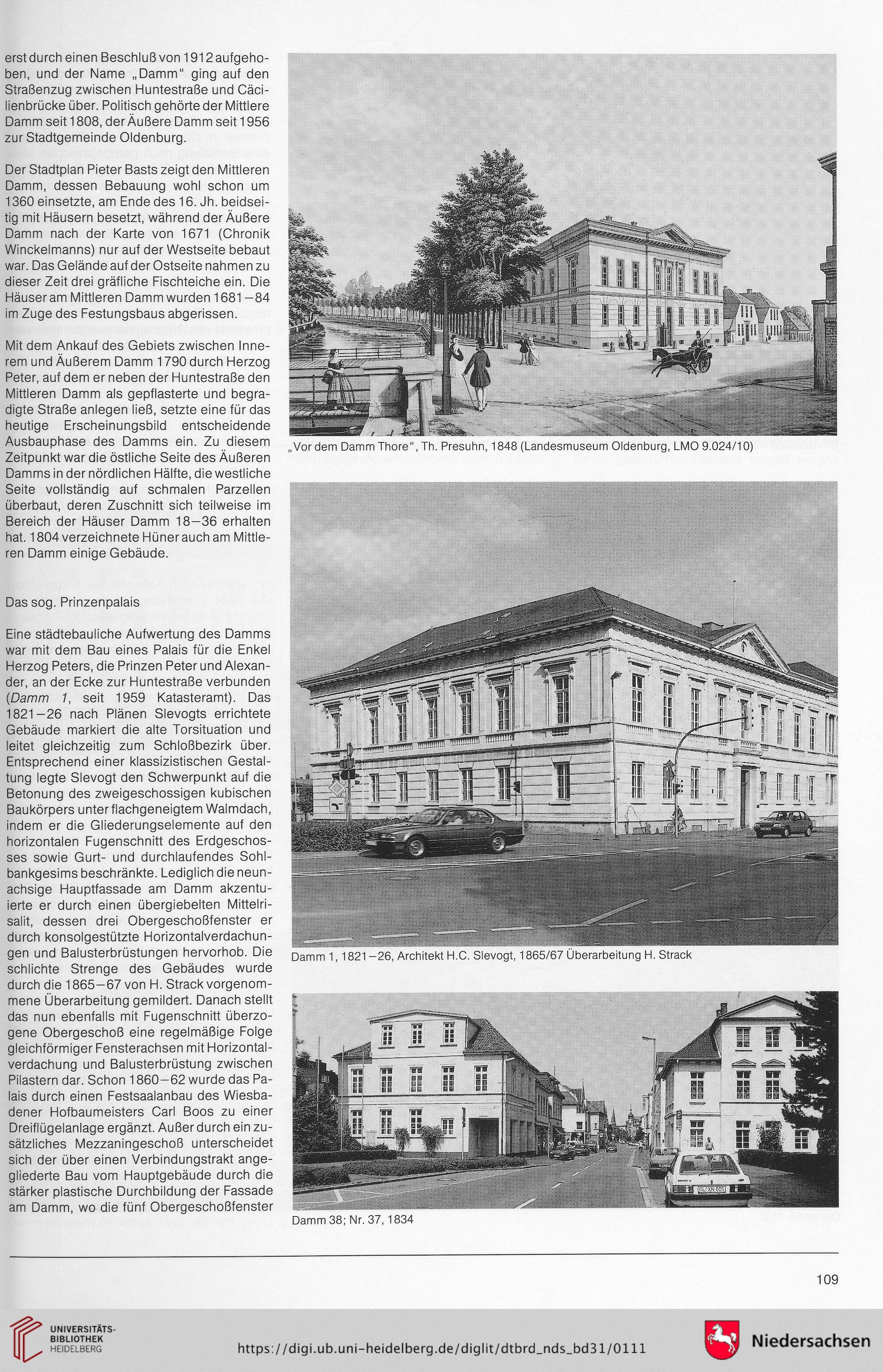erstdurch einen Beschluß von 1912 aufgeho-
ben, und der Name „Damm“ ging auf den
Straßenzug zwischen Huntestraße und Cäci-
lienbrücke über. Politisch gehörte der Mittlere
Damm seit 1808, der Äußere Damm seit 1956
zur Stadtgemeinde Oldenburg.
Der Stadtplan Pieter Basts zeigt den Mittleren
Damm, dessen Bebauung wohl schon um
1360 einsetzte, am Ende des 16. Jh. beidsei-
tig mit Häusern besetzt, während der Äußere
Damm nach der Karte von 1671 (Chronik
Winckelmanns) nur auf der Westseite bebaut
war. Das Gelände auf der Ostseite nahmen zu
dieser Zeit drei gräfliche Fischteiche ein. Die
Häuser am Mittleren Damm wurden 1681 -84
im Zuge des Festungsbaus abgerissen.
Mit dem Ankauf des Gebiets zwischen Inne-
rem und Äußerem Damm 1790 durch Herzog
Peter, auf dem er neben der Huntestraße den
Mittleren Damm als gepflasterte und begra-
digte Straße anlegen ließ, setzte eine für das
heutige Erscheinungsbild entscheidende
Ausbauphase des Damms ein. Zu diesem
Zeitpunkt war die östliche Seite des Äußeren
Damms in der nördlichen Hälfte, die westliche
Seite vollständig auf schmalen Parzellen
überbaut, deren Zuschnitt sich teilweise im
Bereich der Häuser Damm 18-36 erhalten
hat. 1804 verzeichnete Hüner auch am Mittle-
ren Damm einige Gebäude.
Das sog. Prinzenpalais
Eine städtebauliche Aufwertung des Damms
war mit dem Bau eines Palais für die Enkel
Herzog Peters, die Prinzen Peter und Alexan-
der, an der Ecke zur Huntestraße verbunden
(Damm 1, seit 1959 Katasteramt). Das
1821-26 nach Plänen Slevogts errichtete
Gebäude markiert die alte Torsituation und
leitet gleichzeitig zum Schloßbezirk über.
Entsprechend einer klassizistischen Gestal-
tung legte Slevogt den Schwerpunkt auf die
Betonung des zweigeschossigen kubischen
Baukörpers unterflachgeneigtem Walmdach,
indem er die Gliederungselemente auf den
horizontalen Fugenschnitt des Erdgeschos-
ses sowie Gurt- und durchlaufendes Sohl-
bankgesims beschränkte. Lediglich die neun-
achsige Hauptfassade am Damm akzentu-
ierte er durch einen übergiebelten Mittelri-
salit, dessen drei Obergeschoßfenster er
durch konsolgestützte Horizontalverdachun-
gen und Balusterbrüstungen hervorhob. Die
schlichte Strenge des Gebäudes wurde
durch die 1865-67 von H. Strack vorgenom-
mene Überarbeitung gemildert. Danach stellt
das nun ebenfalls mit Fugenschnitt überzo-
gene Obergeschoß eine regelmäßige Folge
gleichförmiger Fensterachsen mit Horizontal-
verdachung und Balusterbrüstung zwischen
Pilastern dar. Schon 1860-62 wurde das Pa-
lais durch einen Festsaalanbau des Wiesba-
dener Hofbaumeisters Carl Boos zu einer
Dreiflügelanlage ergänzt. Außer durch ein zu-
sätzliches Mezzaningeschoß unterscheidet
sich der über einen Verbindungstrakt ange-
gliederte Bau vom Hauptgebäude durch die
stärker plastische Durchbildung der Fassade
am Damm, wo die fünf Obergeschoßfenster
„Vordem Damm Thore“, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/10)
Damm 1, 1821 -26, Architekt H.C. Slevogt, 1865/67 Überarbeitung H. Strack
Damm 38; Nr. 37,1834
109
ben, und der Name „Damm“ ging auf den
Straßenzug zwischen Huntestraße und Cäci-
lienbrücke über. Politisch gehörte der Mittlere
Damm seit 1808, der Äußere Damm seit 1956
zur Stadtgemeinde Oldenburg.
Der Stadtplan Pieter Basts zeigt den Mittleren
Damm, dessen Bebauung wohl schon um
1360 einsetzte, am Ende des 16. Jh. beidsei-
tig mit Häusern besetzt, während der Äußere
Damm nach der Karte von 1671 (Chronik
Winckelmanns) nur auf der Westseite bebaut
war. Das Gelände auf der Ostseite nahmen zu
dieser Zeit drei gräfliche Fischteiche ein. Die
Häuser am Mittleren Damm wurden 1681 -84
im Zuge des Festungsbaus abgerissen.
Mit dem Ankauf des Gebiets zwischen Inne-
rem und Äußerem Damm 1790 durch Herzog
Peter, auf dem er neben der Huntestraße den
Mittleren Damm als gepflasterte und begra-
digte Straße anlegen ließ, setzte eine für das
heutige Erscheinungsbild entscheidende
Ausbauphase des Damms ein. Zu diesem
Zeitpunkt war die östliche Seite des Äußeren
Damms in der nördlichen Hälfte, die westliche
Seite vollständig auf schmalen Parzellen
überbaut, deren Zuschnitt sich teilweise im
Bereich der Häuser Damm 18-36 erhalten
hat. 1804 verzeichnete Hüner auch am Mittle-
ren Damm einige Gebäude.
Das sog. Prinzenpalais
Eine städtebauliche Aufwertung des Damms
war mit dem Bau eines Palais für die Enkel
Herzog Peters, die Prinzen Peter und Alexan-
der, an der Ecke zur Huntestraße verbunden
(Damm 1, seit 1959 Katasteramt). Das
1821-26 nach Plänen Slevogts errichtete
Gebäude markiert die alte Torsituation und
leitet gleichzeitig zum Schloßbezirk über.
Entsprechend einer klassizistischen Gestal-
tung legte Slevogt den Schwerpunkt auf die
Betonung des zweigeschossigen kubischen
Baukörpers unterflachgeneigtem Walmdach,
indem er die Gliederungselemente auf den
horizontalen Fugenschnitt des Erdgeschos-
ses sowie Gurt- und durchlaufendes Sohl-
bankgesims beschränkte. Lediglich die neun-
achsige Hauptfassade am Damm akzentu-
ierte er durch einen übergiebelten Mittelri-
salit, dessen drei Obergeschoßfenster er
durch konsolgestützte Horizontalverdachun-
gen und Balusterbrüstungen hervorhob. Die
schlichte Strenge des Gebäudes wurde
durch die 1865-67 von H. Strack vorgenom-
mene Überarbeitung gemildert. Danach stellt
das nun ebenfalls mit Fugenschnitt überzo-
gene Obergeschoß eine regelmäßige Folge
gleichförmiger Fensterachsen mit Horizontal-
verdachung und Balusterbrüstung zwischen
Pilastern dar. Schon 1860-62 wurde das Pa-
lais durch einen Festsaalanbau des Wiesba-
dener Hofbaumeisters Carl Boos zu einer
Dreiflügelanlage ergänzt. Außer durch ein zu-
sätzliches Mezzaningeschoß unterscheidet
sich der über einen Verbindungstrakt ange-
gliederte Bau vom Hauptgebäude durch die
stärker plastische Durchbildung der Fassade
am Damm, wo die fünf Obergeschoßfenster
„Vordem Damm Thore“, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/10)
Damm 1, 1821 -26, Architekt H.C. Slevogt, 1865/67 Überarbeitung H. Strack
Damm 38; Nr. 37,1834
109