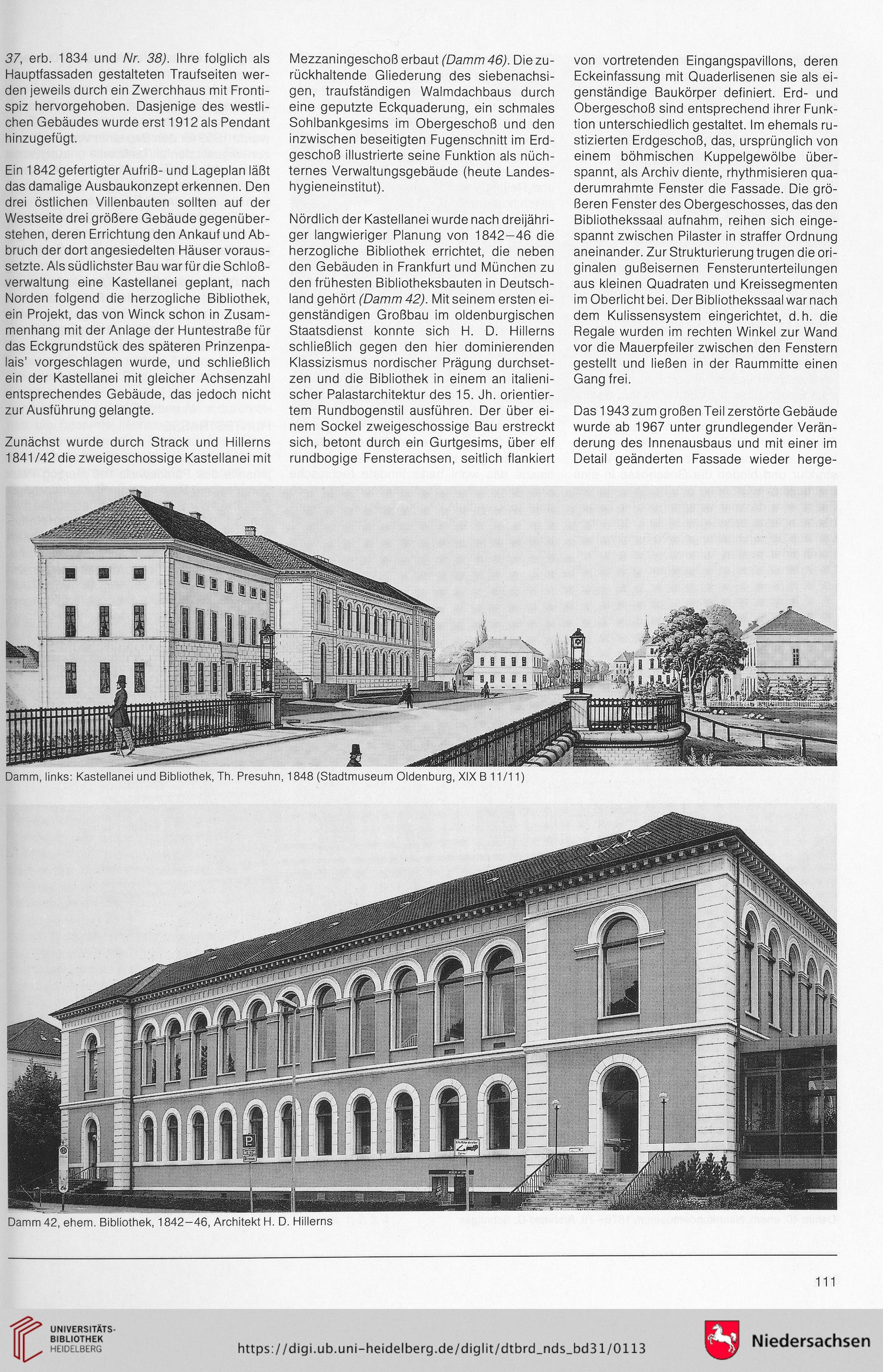37, erb. 1834 und Nr. 38). Ihre folglich als
Hauptfassaden gestalteten Traufseiten wer-
den jeweils durch ein Zwerchhaus mit Fronti-
spiz hervorgehoben. Dasjenige des westli-
chen Gebäudes wurde erst 1912 als Pendant
hinzugefügt.
Ein 1842 gefertigter Aufriß- und Lageplan läßt
das damalige Ausbaukonzept erkennen. Den
drei östlichen Villenbauten sollten auf der
Westseite drei größere Gebäude gegenüber-
stehen, deren Errichtung den Ankauf und Ab-
bruch der dort angesiedelten Häuser voraus-
setzte. Als südlichster Bau war für die Schloß-
verwaltung eine Kastellanei geplant, nach
Norden folgend die herzogliche Bibliothek,
ein Projekt, das von Winck schon in Zusam-
menhang mit der Anlage der Huntestraße für
das Eckgrundstück des späteren Prinzenpa-
lais’ vorgeschlagen wurde, und schließlich
ein der Kastellanei mit gleicher Achsenzahl
entsprechendes Gebäude, das jedoch nicht
zur Ausführung gelangte.
Zunächst wurde durch Strack und Hillerns
1841 /42 die zweigeschossige Kastellanei mit
Mezzaningeschoß erbaut (Damm 46). Die zu-
rückhaltende Gliederung des siebenachsi-
gen, traufständigen Walmdachbaus durch
eine geputzte Eckquaderung, ein schmales
Sohlbankgesims im Obergeschoß und den
inzwischen beseitigten Fugenschnitt im Erd-
geschoß illustrierte seine Funktion als nüch-
ternes Verwaltungsgebäude (heute Landes-
hygieneinstitut).
Nördlich der Kastellanei wurde nach dreijähri-
ger langwieriger Planung von 1842-46 die
herzogliche Bibliothek errichtet, die neben
den Gebäuden in Frankfurt und München zu
den frühesten Bibliotheksbauten in Deutsch-
land gehört (Damm 42). Mit seinem ersten ei-
genständigen Großbau im oldenburgischen
Staatsdienst konnte sich H. D. Hillerns
schließlich gegen den hier dominierenden
Klassizismus nordischer Prägung durchset-
zen und die Bibliothek in einem an italieni-
scher Palastarchitektur des 15. Jh. orientier-
tem Rundbogenstil ausführen. Der über ei-
nem Sockel zweigeschossige Bau erstreckt
sich, betont durch ein Gurtgesims, über elf
rundbogige Fensterachsen, seitlich flankiert
von vortretenden Eingangspavillons, deren
Eckeinfassung mit Quaderlisenen sie als ei-
genständige Baukörper definiert. Erd- und
Obergeschoß sind entsprechend ihrer Funk-
tion unterschiedlich gestaltet. Im ehemals ru-
stizierten Erdgeschoß, das, ursprünglich von
einem böhmischen Kuppelgewölbe über-
spannt, als Archiv diente, rhythmisieren qua-
derumrahmte Fenster die Fassade. Die grö-
ßeren Fenster des Obergeschosses, das den
Bibliothekssaal aufnahm, reihen sich einge-
spannt zwischen Pilaster in straffer Ordnung
aneinander. Zur Strukturierung trugen die ori-
ginalen gußeisernen Fensterunterteilungen
aus kleinen Quadraten und Kreissegmenten
im Oberlicht bei. Der Bibliothekssaal war nach
dem Kulissensystem eingerichtet, d.h. die
Regale wurden im rechten Winkel zur Wand
vor die Mauerpfeiler zwischen den Fenstern
gestellt und ließen in der Raummitte einen
Gang frei.
Das 1943 zum großen Teil zerstörte Gebäude
wurde ab 1967 unter grundlegender Verän-
derung des Innenausbaus und mit einer im
Detail geänderten Fassade wieder herge-
111
Hauptfassaden gestalteten Traufseiten wer-
den jeweils durch ein Zwerchhaus mit Fronti-
spiz hervorgehoben. Dasjenige des westli-
chen Gebäudes wurde erst 1912 als Pendant
hinzugefügt.
Ein 1842 gefertigter Aufriß- und Lageplan läßt
das damalige Ausbaukonzept erkennen. Den
drei östlichen Villenbauten sollten auf der
Westseite drei größere Gebäude gegenüber-
stehen, deren Errichtung den Ankauf und Ab-
bruch der dort angesiedelten Häuser voraus-
setzte. Als südlichster Bau war für die Schloß-
verwaltung eine Kastellanei geplant, nach
Norden folgend die herzogliche Bibliothek,
ein Projekt, das von Winck schon in Zusam-
menhang mit der Anlage der Huntestraße für
das Eckgrundstück des späteren Prinzenpa-
lais’ vorgeschlagen wurde, und schließlich
ein der Kastellanei mit gleicher Achsenzahl
entsprechendes Gebäude, das jedoch nicht
zur Ausführung gelangte.
Zunächst wurde durch Strack und Hillerns
1841 /42 die zweigeschossige Kastellanei mit
Mezzaningeschoß erbaut (Damm 46). Die zu-
rückhaltende Gliederung des siebenachsi-
gen, traufständigen Walmdachbaus durch
eine geputzte Eckquaderung, ein schmales
Sohlbankgesims im Obergeschoß und den
inzwischen beseitigten Fugenschnitt im Erd-
geschoß illustrierte seine Funktion als nüch-
ternes Verwaltungsgebäude (heute Landes-
hygieneinstitut).
Nördlich der Kastellanei wurde nach dreijähri-
ger langwieriger Planung von 1842-46 die
herzogliche Bibliothek errichtet, die neben
den Gebäuden in Frankfurt und München zu
den frühesten Bibliotheksbauten in Deutsch-
land gehört (Damm 42). Mit seinem ersten ei-
genständigen Großbau im oldenburgischen
Staatsdienst konnte sich H. D. Hillerns
schließlich gegen den hier dominierenden
Klassizismus nordischer Prägung durchset-
zen und die Bibliothek in einem an italieni-
scher Palastarchitektur des 15. Jh. orientier-
tem Rundbogenstil ausführen. Der über ei-
nem Sockel zweigeschossige Bau erstreckt
sich, betont durch ein Gurtgesims, über elf
rundbogige Fensterachsen, seitlich flankiert
von vortretenden Eingangspavillons, deren
Eckeinfassung mit Quaderlisenen sie als ei-
genständige Baukörper definiert. Erd- und
Obergeschoß sind entsprechend ihrer Funk-
tion unterschiedlich gestaltet. Im ehemals ru-
stizierten Erdgeschoß, das, ursprünglich von
einem böhmischen Kuppelgewölbe über-
spannt, als Archiv diente, rhythmisieren qua-
derumrahmte Fenster die Fassade. Die grö-
ßeren Fenster des Obergeschosses, das den
Bibliothekssaal aufnahm, reihen sich einge-
spannt zwischen Pilaster in straffer Ordnung
aneinander. Zur Strukturierung trugen die ori-
ginalen gußeisernen Fensterunterteilungen
aus kleinen Quadraten und Kreissegmenten
im Oberlicht bei. Der Bibliothekssaal war nach
dem Kulissensystem eingerichtet, d.h. die
Regale wurden im rechten Winkel zur Wand
vor die Mauerpfeiler zwischen den Fenstern
gestellt und ließen in der Raummitte einen
Gang frei.
Das 1943 zum großen Teil zerstörte Gebäude
wurde ab 1967 unter grundlegender Verän-
derung des Innenausbaus und mit einer im
Detail geänderten Fassade wieder herge-
111