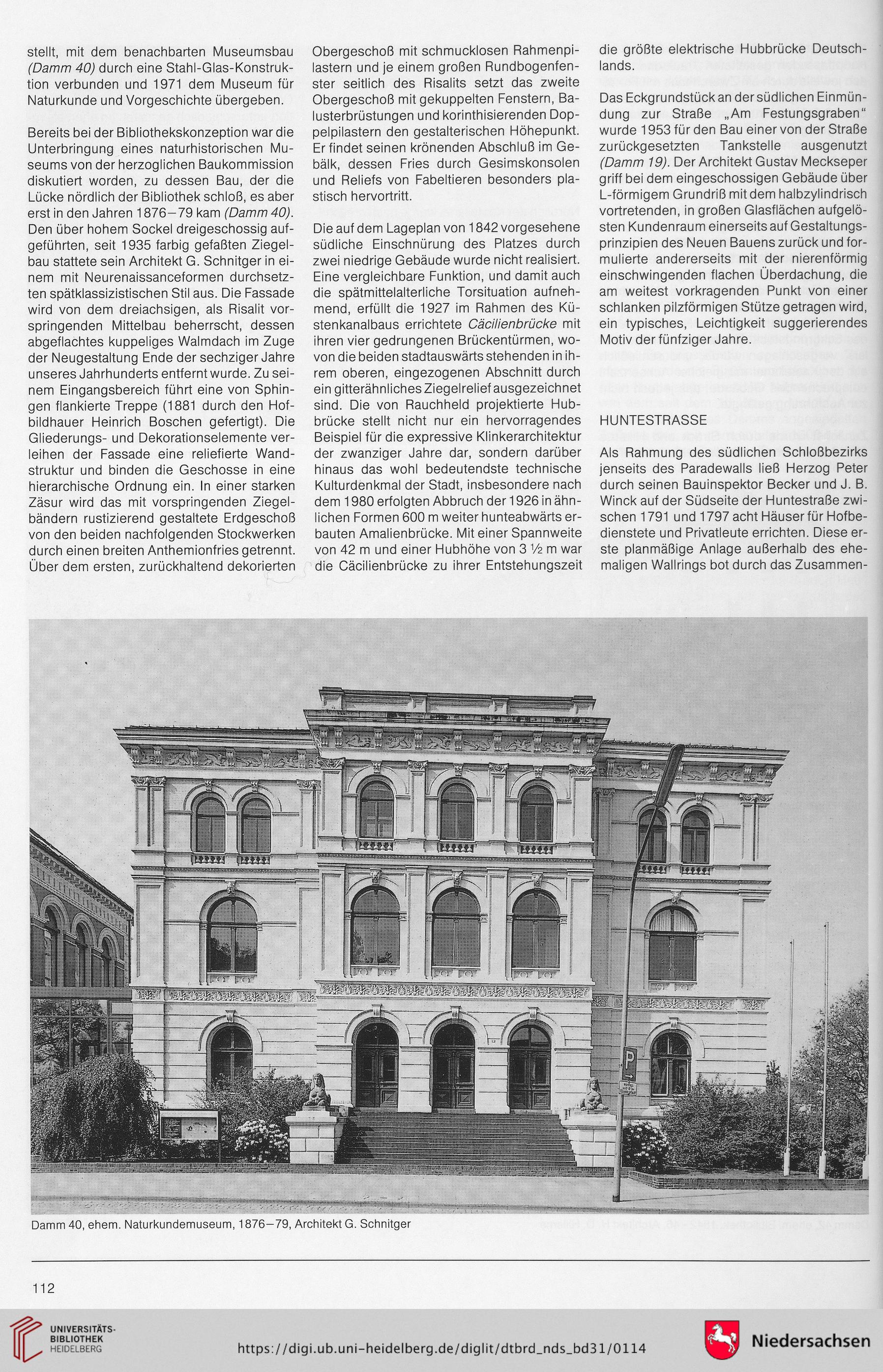stellt, mit dem benachbarten Museumsbau
(Damm 40) durch eine Stahl-Glas-Konstruk-
tion verbunden und 1971 dem Museum für
Naturkunde und Vorgeschichte übergeben.
Bereits bei der Bibliothekskonzeption war die
Unterbringung eines naturhistorischen Mu-
seums von der herzoglichen Baukommission
diskutiert worden, zu dessen Bau, der die
Lücke nördlich der Bibliothek schloß, es aber
erst in den Jahren 1876-79 kam (Damm 40).
Den über hohem Sockel dreigeschossig auf-
geführten, seit 1935 farbig gefaßten Ziegel-
bau stattete sein Architekt G. Schnitger in ei-
nem mit Neurenaissanceformen durchsetz-
ten spätklassizistischen Stil aus. Die Fassade
wird von dem dreiachsigen, als Risalit vor-
springenden Mittelbau beherrscht, dessen
abgeflachtes kuppeiiges Walmdach im Zuge
der Neugestaltung Ende der sechziger Jahre
unseres Jahrhunderts entfernt wurde. Zu sei-
nem Eingangsbereich führt eine von Sphin-
gen flankierte Treppe (1881 durch den Hof-
bildhauer Heinrich Boschen gefertigt). Die
Gliederungs- und Dekorationselemente ver-
leihen der Fassade eine reliefierte Wand-
struktur und binden die Geschosse in eine
hierarchische Ordnung ein. In einer starken
Zäsur wird das mit vorspringenden Ziegel-
bändern rustizierend gestaltete Erdgeschoß
von den beiden nachfolgenden Stockwerken
durch einen breiten Anthemionfries getrennt.
Über dem ersten, zurückhaltend dekorierten
Obergeschoß mit schmucklosen Rahmenpi-
lastern und je einem großen Rundbogenfen-
ster seitlich des Risalits setzt das zweite
Obergeschoß mit gekuppelten Fenstern, Ba-
lusterbrüstungen und korinthisierenden Dop-
pelpilastern den gestalterischen Höhepunkt.
Er findet seinen krönenden Abschluß im Ge-
bälk, dessen Fries durch Gesimskonsolen
und Reliefs von Fabeltieren besonders pla-
stisch hervortritt.
Die auf dem Lageplan von 1842 vorgesehene
südliche Einschnürung des Platzes durch
zwei niedrige Gebäude wurde nicht realisiert.
Eine vergleichbare Funktion, und damit auch
die spätmittelalterliche Torsituation aufneh-
mend, erfüllt die 1927 im Rahmen des Kü-
stenkanalbaus errichtete Cäcilienbrücke mit
ihren vier gedrungenen Brückentürmen, wo-
von die beiden stadtauswärts stehenden in ih-
rem oberen, eingezogenen Abschnitt durch
ein gitterähnliches Ziegelreliefausgezeichnet
sind. Die von Rauchheld projektierte Hub-
brücke stellt nicht nur ein hervorragendes
Beispiel für die expressive Klinkerarchitektur
der zwanziger Jahre dar, sondern darüber
hinaus das wohl bedeutendste technische
Kulturdenkmal der Stadt, insbesondere nach
dem 1980 erfolgten Abbruch der 1926 in ähn-
lichen Formen 600 m weiter hunteabwärts er-
bauten Amalienbrücke. Mit einer Spannweite
von 42 m und einer Hubhöhe von 3 V2 m war
die Cäcilienbrücke zu ihrer Entstehungszeit
die größte elektrische Hubbrücke Deutsch-
lands.
Das Eckgrundstück an der südlichen Einmün-
dung zur Straße „Am Festungsgraben“
wurde 1953 für den Bau einer von der Straße
zurückgesetzten Tankstelle ausgenutzt
(Damm 19). Der Architekt Gustav Meckseper
griff bei dem eingeschossigen Gebäude über
L-förmigem Grundriß mit dem halbzylindrisch
vortretenden, in großen Glasflächen aufgelö-
sten Kundenraum einerseits auf Gestaltungs-
prinzipien des Neuen Bauens zurück und for-
mulierte andererseits mit der nierenförmig
einschwingenden flachen Überdachung, die
am weitest vorkragenden Punkt von einer
schlanken pilzförmigen Stütze getragen wird,
ein typisches, Leichtigkeit suggerierendes
Motiv der fünfziger Jahre.
HUNTESTRASSE
Als Rahmung des südlichen Schloßbezirks
jenseits des Paradewalls ließ Herzog Peter
durch seinen Bauinspektor Becker und J. B.
Winck auf der Südseite der Huntestraße zwi-
schen 1791 und 1797 acht Häuserfür Hofbe-
dienstete und Privatleute errichten. Diese er-
ste planmäßige Anlage außerhalb des ehe-
maligen Wallrings bot durch das Zusammen-
Damm 40, ehem. Naturkundemuseum, 1876-79, Architekt G. Schnitger
112
(Damm 40) durch eine Stahl-Glas-Konstruk-
tion verbunden und 1971 dem Museum für
Naturkunde und Vorgeschichte übergeben.
Bereits bei der Bibliothekskonzeption war die
Unterbringung eines naturhistorischen Mu-
seums von der herzoglichen Baukommission
diskutiert worden, zu dessen Bau, der die
Lücke nördlich der Bibliothek schloß, es aber
erst in den Jahren 1876-79 kam (Damm 40).
Den über hohem Sockel dreigeschossig auf-
geführten, seit 1935 farbig gefaßten Ziegel-
bau stattete sein Architekt G. Schnitger in ei-
nem mit Neurenaissanceformen durchsetz-
ten spätklassizistischen Stil aus. Die Fassade
wird von dem dreiachsigen, als Risalit vor-
springenden Mittelbau beherrscht, dessen
abgeflachtes kuppeiiges Walmdach im Zuge
der Neugestaltung Ende der sechziger Jahre
unseres Jahrhunderts entfernt wurde. Zu sei-
nem Eingangsbereich führt eine von Sphin-
gen flankierte Treppe (1881 durch den Hof-
bildhauer Heinrich Boschen gefertigt). Die
Gliederungs- und Dekorationselemente ver-
leihen der Fassade eine reliefierte Wand-
struktur und binden die Geschosse in eine
hierarchische Ordnung ein. In einer starken
Zäsur wird das mit vorspringenden Ziegel-
bändern rustizierend gestaltete Erdgeschoß
von den beiden nachfolgenden Stockwerken
durch einen breiten Anthemionfries getrennt.
Über dem ersten, zurückhaltend dekorierten
Obergeschoß mit schmucklosen Rahmenpi-
lastern und je einem großen Rundbogenfen-
ster seitlich des Risalits setzt das zweite
Obergeschoß mit gekuppelten Fenstern, Ba-
lusterbrüstungen und korinthisierenden Dop-
pelpilastern den gestalterischen Höhepunkt.
Er findet seinen krönenden Abschluß im Ge-
bälk, dessen Fries durch Gesimskonsolen
und Reliefs von Fabeltieren besonders pla-
stisch hervortritt.
Die auf dem Lageplan von 1842 vorgesehene
südliche Einschnürung des Platzes durch
zwei niedrige Gebäude wurde nicht realisiert.
Eine vergleichbare Funktion, und damit auch
die spätmittelalterliche Torsituation aufneh-
mend, erfüllt die 1927 im Rahmen des Kü-
stenkanalbaus errichtete Cäcilienbrücke mit
ihren vier gedrungenen Brückentürmen, wo-
von die beiden stadtauswärts stehenden in ih-
rem oberen, eingezogenen Abschnitt durch
ein gitterähnliches Ziegelreliefausgezeichnet
sind. Die von Rauchheld projektierte Hub-
brücke stellt nicht nur ein hervorragendes
Beispiel für die expressive Klinkerarchitektur
der zwanziger Jahre dar, sondern darüber
hinaus das wohl bedeutendste technische
Kulturdenkmal der Stadt, insbesondere nach
dem 1980 erfolgten Abbruch der 1926 in ähn-
lichen Formen 600 m weiter hunteabwärts er-
bauten Amalienbrücke. Mit einer Spannweite
von 42 m und einer Hubhöhe von 3 V2 m war
die Cäcilienbrücke zu ihrer Entstehungszeit
die größte elektrische Hubbrücke Deutsch-
lands.
Das Eckgrundstück an der südlichen Einmün-
dung zur Straße „Am Festungsgraben“
wurde 1953 für den Bau einer von der Straße
zurückgesetzten Tankstelle ausgenutzt
(Damm 19). Der Architekt Gustav Meckseper
griff bei dem eingeschossigen Gebäude über
L-förmigem Grundriß mit dem halbzylindrisch
vortretenden, in großen Glasflächen aufgelö-
sten Kundenraum einerseits auf Gestaltungs-
prinzipien des Neuen Bauens zurück und for-
mulierte andererseits mit der nierenförmig
einschwingenden flachen Überdachung, die
am weitest vorkragenden Punkt von einer
schlanken pilzförmigen Stütze getragen wird,
ein typisches, Leichtigkeit suggerierendes
Motiv der fünfziger Jahre.
HUNTESTRASSE
Als Rahmung des südlichen Schloßbezirks
jenseits des Paradewalls ließ Herzog Peter
durch seinen Bauinspektor Becker und J. B.
Winck auf der Südseite der Huntestraße zwi-
schen 1791 und 1797 acht Häuserfür Hofbe-
dienstete und Privatleute errichten. Diese er-
ste planmäßige Anlage außerhalb des ehe-
maligen Wallrings bot durch das Zusammen-
Damm 40, ehem. Naturkundemuseum, 1876-79, Architekt G. Schnitger
112