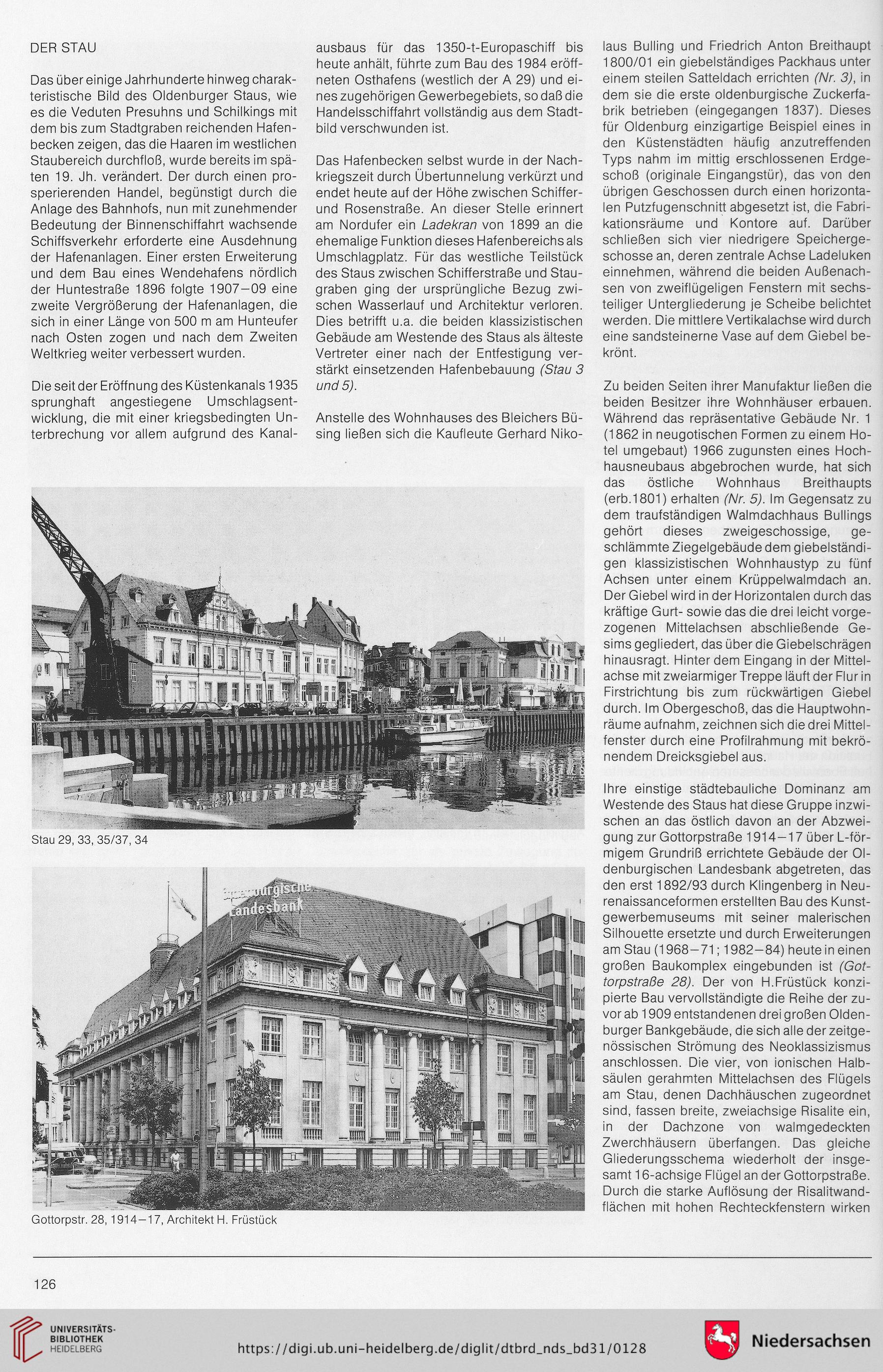DER STAU
Das über einige Jahrhunderte hinweg charak-
teristische Bild des Oldenburger Staus, wie
es die Veduten Presuhns und Schiikings mit
dem bis zum Stadtgraben reichenden Hafen-
becken zeigen, das die Haaren im westlichen
Staubereich durchfloß, wurde bereits im spä-
ten 19. Jh. verändert. Der durch einen pro-
sperierenden Handel, begünstigt durch die
Anlage des Bahnhofs, nun mit zunehmender
Bedeutung der Binnenschiffahrt wachsende
Schiffsverkehr erforderte eine Ausdehnung
der Hafenanlagen. Einer ersten Erweiterung
und dem Bau eines Wendehafens nördlich
der Huntestraße 1896 folgte 1907-09 eine
zweite Vergrößerung der Hafenanlagen, die
sich in einer Länge von 500 m am Hunteufer
nach Osten zogen und nach dem Zweiten
Weltkrieg weiter verbessert wurden.
Die seit der Eröffnung des Küstenkanals 1935
sprunghaft angestiegene Umschlagsent-
wicklung, die mit einer kriegsbedingten Un-
terbrechung vor allem aufgrund des Kanal-
ausbaus für das 1350-t-Europaschiff bis
heute anhält, führte zum Bau des 1984 eröff-
neten Osthafens (westlich der A 29) und ei-
neszugehörigen Gewerbegebiets, so daß die
Handelsschiffahrt vollständig aus dem Stadt-
bild verschwunden ist.
Das Hafenbecken selbst wurde in der Nach-
kriegszeit durch Übertunnelung verkürzt und
endet heute auf der Höhe zwischen Schiffer-
und Rosenstraße. An dieser Stelle erinnert
am Nordufer ein Ladekran von 1899 an die
ehemalige Funktion dieses Hafenbereichs als
Umschlagplatz. Für das westliche Teilstück
des Staus zwischen Schifferstraße und Stau-
graben ging der ursprüngliche Bezug zwi-
schen Wasserlauf und Architektur verloren.
Dies betrifft u.a. die beiden klassizistischen
Gebäude am Westende des Staus als älteste
Vertreter einer nach der Entfestigung ver-
stärkt einsetzenden Hafenbebauung (Stau 3
und 5).
Anstelle des Wohnhauses des Bleichers Bü-
sing ließen sich die Kaufleute Gerhard Niko-
Stau 29, 33, 35/37, 34
Gottorpstr. 28,1914-17, Architekt H. Früstück
laus Bulling und Friedrich Anton Breithaupt
1800/01 ein giebelständiges Packhaus unter
einem steilen Satteldach errichten (Nr. 3), in
dem sie die erste oldenburgische Zuckerfa-
brik betrieben (eingegangen 1837). Dieses
für Oldenburg einzigartige Beispiel eines in
den Küstenstädten häufig anzutreffenden
Typs nahm im mittig erschlossenen Erdge-
schoß (originale Eingangstür), das von den
übrigen Geschossen durch einen horizonta-
len Putzfugenschnitt abgesetzt ist, die Fabri-
kationsräume und Kontore auf. Darüber
schließen sich vier niedrigere Speicherge-
schosse an, deren zentrale Achse Ladeluken
einnehmen, während die beiden Außenach-
sen von zweiflügeligen Fenstern mit sechs-
teiliger Untergliederung je Scheibe belichtet
werden. Die mittlere Vertikalachse wird durch
eine sandsteinerne Vase auf dem Giebel be-
krönt.
Zu beiden Seiten ihrer Manufaktur ließen die
beiden Besitzer ihre Wohnhäuser erbauen.
Während das repräsentative Gebäude Nr. 1
(1862 in neugotischen Formen zu einem Ho-
tel umgebaut) 1966 zugunsten eines Hoch-
hausneubaus abgebrochen wurde, hat sich
das östliche Wohnhaus Breithaupts
(erb.1801) erhalten (Nr. 5). Im Gegensatz zu
dem traufständigen Walmdachhaus Bullings
gehört dieses zweigeschossige, ge-
schlämmte Ziegelgebäude dem giebelständi-
gen klassizistischen Wohnhaustyp zu fünf
Achsen unter einem Krüppelwalmdach an.
Der Giebel wird in der Horizontalen durch das
kräftige Gurt- sowie das die drei leicht vorge-
zogenen Mittelachsen abschließende Ge-
sims gegliedert, das über die Giebelschrägen
hinausragt. Hinter dem Eingang in der Mittel-
achse mit zweiarmiger Treppe läuft der Flur in
Firstrichtung bis zum rückwärtigen Giebel
durch. Im Obergeschoß, das die Hauptwohn-
räume aufnahm, zeichnen sich die drei Mittel-
fenster durch eine Profilrahmung mit bekrö-
nendem Dreicksgiebel aus.
Ihre einstige städtebauliche Dominanz am
Westende des Staus hat diese Gruppe inzwi-
schen an das östlich davon an der Abzwei-
gung zur Gottorpstraße 1914-17 über L-för-
migem Grundriß errichtete Gebäude der Ol-
denburgischen Landesbank abgetreten, das
den erst 1892/93 durch Klingenberg in Neu-
renaissanceformen erstellten Bau des Kunst-
gewerbemuseums mit seiner malerischen
Silhouette ersetzte und durch Erweiterungen
am Stau (1968-71; 1982-84) heute in einen
großen Baukomplex eingebunden ist (Got-
torpstraße 28). Der von H.Früstück konzi-
pierte Bau vervollständigte die Reihe der zu-
vor ab 1909 entstandenen drei großen Olden-
burger Bankgebäude, die sich alle der zeitge-
nössischen Strömung des Neoklassizismus
anschlossen. Die vier, von ionischen Halb-
säulen gerahmten Mittelachsen des Flügels
am Stau, denen Dachhäuschen zugeordnet
sind, fassen breite, zweiachsige Risalite ein,
in der Dachzone von walmgedeckten
Zwerchhäusern überfangen. Das gleiche
Gliederungsschema wiederholt der insge-
samt 16-achsige Flügel an der Gottorpstraße.
Durch die starke Auflösung der Risalitwand-
flächen mit hohen Rechteckfenstern wirken
126
Das über einige Jahrhunderte hinweg charak-
teristische Bild des Oldenburger Staus, wie
es die Veduten Presuhns und Schiikings mit
dem bis zum Stadtgraben reichenden Hafen-
becken zeigen, das die Haaren im westlichen
Staubereich durchfloß, wurde bereits im spä-
ten 19. Jh. verändert. Der durch einen pro-
sperierenden Handel, begünstigt durch die
Anlage des Bahnhofs, nun mit zunehmender
Bedeutung der Binnenschiffahrt wachsende
Schiffsverkehr erforderte eine Ausdehnung
der Hafenanlagen. Einer ersten Erweiterung
und dem Bau eines Wendehafens nördlich
der Huntestraße 1896 folgte 1907-09 eine
zweite Vergrößerung der Hafenanlagen, die
sich in einer Länge von 500 m am Hunteufer
nach Osten zogen und nach dem Zweiten
Weltkrieg weiter verbessert wurden.
Die seit der Eröffnung des Küstenkanals 1935
sprunghaft angestiegene Umschlagsent-
wicklung, die mit einer kriegsbedingten Un-
terbrechung vor allem aufgrund des Kanal-
ausbaus für das 1350-t-Europaschiff bis
heute anhält, führte zum Bau des 1984 eröff-
neten Osthafens (westlich der A 29) und ei-
neszugehörigen Gewerbegebiets, so daß die
Handelsschiffahrt vollständig aus dem Stadt-
bild verschwunden ist.
Das Hafenbecken selbst wurde in der Nach-
kriegszeit durch Übertunnelung verkürzt und
endet heute auf der Höhe zwischen Schiffer-
und Rosenstraße. An dieser Stelle erinnert
am Nordufer ein Ladekran von 1899 an die
ehemalige Funktion dieses Hafenbereichs als
Umschlagplatz. Für das westliche Teilstück
des Staus zwischen Schifferstraße und Stau-
graben ging der ursprüngliche Bezug zwi-
schen Wasserlauf und Architektur verloren.
Dies betrifft u.a. die beiden klassizistischen
Gebäude am Westende des Staus als älteste
Vertreter einer nach der Entfestigung ver-
stärkt einsetzenden Hafenbebauung (Stau 3
und 5).
Anstelle des Wohnhauses des Bleichers Bü-
sing ließen sich die Kaufleute Gerhard Niko-
Stau 29, 33, 35/37, 34
Gottorpstr. 28,1914-17, Architekt H. Früstück
laus Bulling und Friedrich Anton Breithaupt
1800/01 ein giebelständiges Packhaus unter
einem steilen Satteldach errichten (Nr. 3), in
dem sie die erste oldenburgische Zuckerfa-
brik betrieben (eingegangen 1837). Dieses
für Oldenburg einzigartige Beispiel eines in
den Küstenstädten häufig anzutreffenden
Typs nahm im mittig erschlossenen Erdge-
schoß (originale Eingangstür), das von den
übrigen Geschossen durch einen horizonta-
len Putzfugenschnitt abgesetzt ist, die Fabri-
kationsräume und Kontore auf. Darüber
schließen sich vier niedrigere Speicherge-
schosse an, deren zentrale Achse Ladeluken
einnehmen, während die beiden Außenach-
sen von zweiflügeligen Fenstern mit sechs-
teiliger Untergliederung je Scheibe belichtet
werden. Die mittlere Vertikalachse wird durch
eine sandsteinerne Vase auf dem Giebel be-
krönt.
Zu beiden Seiten ihrer Manufaktur ließen die
beiden Besitzer ihre Wohnhäuser erbauen.
Während das repräsentative Gebäude Nr. 1
(1862 in neugotischen Formen zu einem Ho-
tel umgebaut) 1966 zugunsten eines Hoch-
hausneubaus abgebrochen wurde, hat sich
das östliche Wohnhaus Breithaupts
(erb.1801) erhalten (Nr. 5). Im Gegensatz zu
dem traufständigen Walmdachhaus Bullings
gehört dieses zweigeschossige, ge-
schlämmte Ziegelgebäude dem giebelständi-
gen klassizistischen Wohnhaustyp zu fünf
Achsen unter einem Krüppelwalmdach an.
Der Giebel wird in der Horizontalen durch das
kräftige Gurt- sowie das die drei leicht vorge-
zogenen Mittelachsen abschließende Ge-
sims gegliedert, das über die Giebelschrägen
hinausragt. Hinter dem Eingang in der Mittel-
achse mit zweiarmiger Treppe läuft der Flur in
Firstrichtung bis zum rückwärtigen Giebel
durch. Im Obergeschoß, das die Hauptwohn-
räume aufnahm, zeichnen sich die drei Mittel-
fenster durch eine Profilrahmung mit bekrö-
nendem Dreicksgiebel aus.
Ihre einstige städtebauliche Dominanz am
Westende des Staus hat diese Gruppe inzwi-
schen an das östlich davon an der Abzwei-
gung zur Gottorpstraße 1914-17 über L-för-
migem Grundriß errichtete Gebäude der Ol-
denburgischen Landesbank abgetreten, das
den erst 1892/93 durch Klingenberg in Neu-
renaissanceformen erstellten Bau des Kunst-
gewerbemuseums mit seiner malerischen
Silhouette ersetzte und durch Erweiterungen
am Stau (1968-71; 1982-84) heute in einen
großen Baukomplex eingebunden ist (Got-
torpstraße 28). Der von H.Früstück konzi-
pierte Bau vervollständigte die Reihe der zu-
vor ab 1909 entstandenen drei großen Olden-
burger Bankgebäude, die sich alle der zeitge-
nössischen Strömung des Neoklassizismus
anschlossen. Die vier, von ionischen Halb-
säulen gerahmten Mittelachsen des Flügels
am Stau, denen Dachhäuschen zugeordnet
sind, fassen breite, zweiachsige Risalite ein,
in der Dachzone von walmgedeckten
Zwerchhäusern überfangen. Das gleiche
Gliederungsschema wiederholt der insge-
samt 16-achsige Flügel an der Gottorpstraße.
Durch die starke Auflösung der Risalitwand-
flächen mit hohen Rechteckfenstern wirken
126