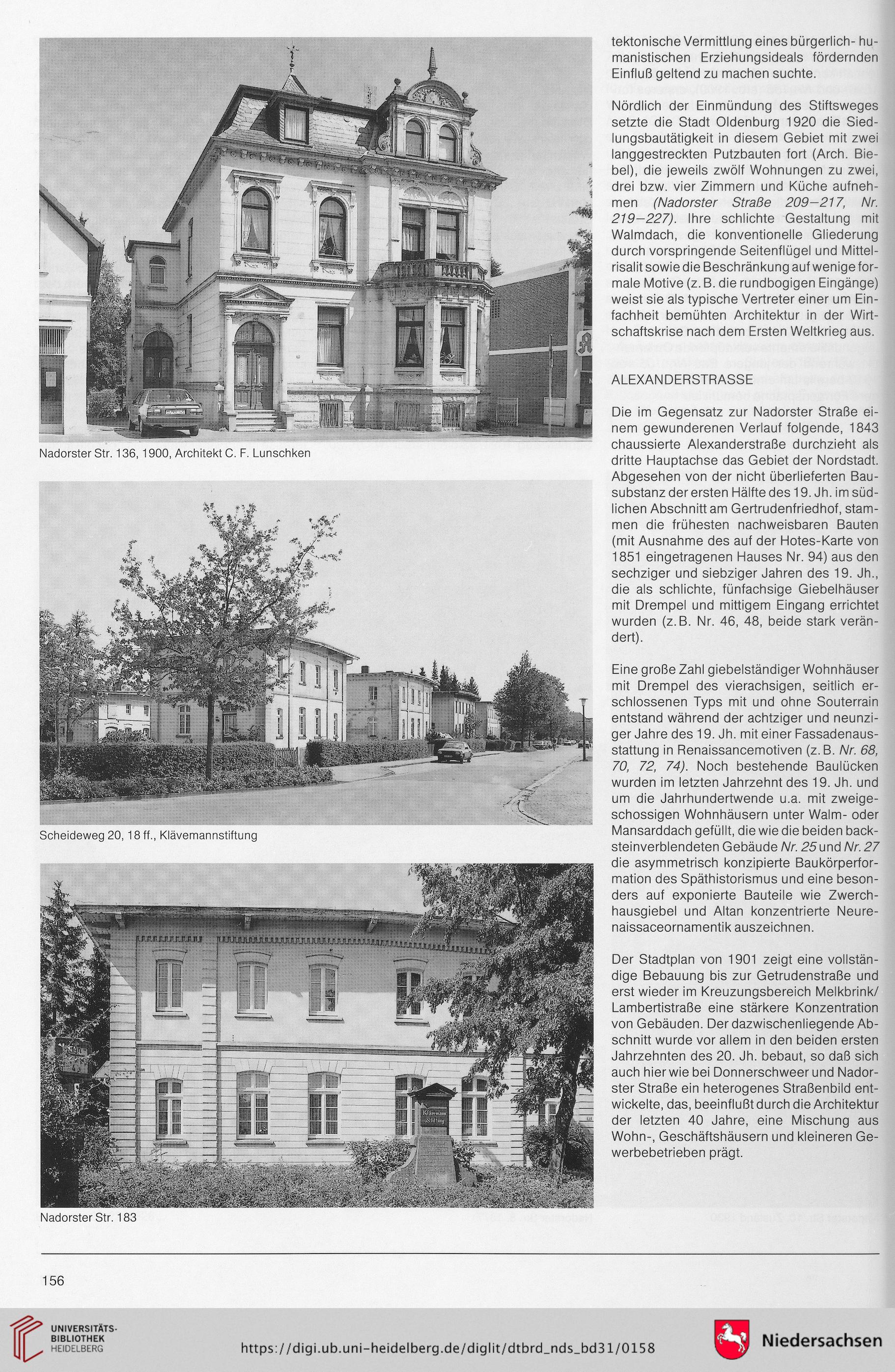Nadorster Str. 136,1900, Architekt C. F. Lunschken
Nadorster Str. 183
tektonische Vermittlung eines bürgerlich- hu-
manistischen Erziehungsideals fördernden
Einfluß geltend zu machen suchte.
Nördlich der Einmündung des Stiftsweges
setzte die Stadt Oldenburg 1920 die Sied-
lungsbautätigkeit in diesem Gebiet mit zwei
langgestreckten Putzbauten fort (Arch. Bie-
bel), die jeweils zwölf Wohnungen zu zwei,
drei bzw. vier Zimmern und Küche aufneh-
men (Nadorster Straße 209-217, Nr.
219-227). Ihre schlichte Gestaltung mit
Walmdach, die konventionelle Gliederung
durch vorspringende Seitenflügel und Mittel-
risalit sowie die Beschränkung auf wenige for-
male Motive (z. B. die rundbogigen Eingänge)
weist sie als typische Vertreter einer um Ein-
fachheit bemühten Architektur in der Wirt-
schaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg aus.
ALEXANDERSTRASSE
Die im Gegensatz zur Nadorster Straße ei-
nem gewunderenen Verlauf folgende, 1843
chaussierte Alexanderstraße durchzieht als
dritte Hauptachse das Gebiet der Nordstadt.
Abgesehen von der nicht überlieferten Bau-
substanz der ersten Hälfte des 19. Jh. im süd-
lichen Abschnitt am Gertrudenfriedhof, stam-
men die frühesten nachweisbaren Bauten
(mit Ausnahme des auf der Hotes-Karte von
1851 eingetragenen Hauses Nr. 94) aus den
sechziger und siebziger Jahren des 19. Jh.,
die als schlichte, fünfachsige Giebelhäuser
mit Drempel und mittigem Eingang errichtet
wurden (z.B. Nr. 46, 48, beide stark verän-
dert).
Eine große Zahl giebelständiger Wohnhäuser
mit Drempel des vierachsigen, seitlich er-
schlossenen Typs mit und ohne Souterrain
entstand während der achtziger und neunzi-
ger Jahre des 19. Jh. mit einer Fassadenaus-
stattung in Renaissancemotiven (z.B. Nr. 68,
70, 72, 74). Noch bestehende Baulücken
wurden im letzten Jahrzehnt des 19. Jh. und
um die Jahrhundertwende u.a. mit zweige-
schossigen Wohnhäusern unter Walm- oder
Mansarddach gefüllt, die wie die beiden back-
steinverblendeten Gebäude Nr. 25und Nr. 27
die asymmetrisch konzipierte Baukörperfor-
mation des Späthistorismus und eine beson-
ders auf exponierte Bauteile wie Zwerch-
hausgiebel und Altan konzentrierte Neure-
naissaceornamentik auszeichnen.
Der Stadtplan von 1901 zeigt eine vollstän-
dige Bebauung bis zur Getrudenstraße und
erst wieder im Kreuzungsbereich Melkbrink/
Lambertistraße eine stärkere Konzentration
von Gebäuden. Der dazwischenliegende Ab-
schnitt wurde vor allem in den beiden ersten
Jahrzehnten des 20. Jh. bebaut, so daß sich
auch hier wie bei Donnerschweerund Nador-
ster Straße ein heterogenes Straßenbild ent-
wickelte, das, beeinflußtdurch die Architektur
der letzten 40 Jahre, eine Mischung aus
Wohn-, Geschäftshäusern und kleineren Ge-
werbebetrieben prägt.
156
Nadorster Str. 183
tektonische Vermittlung eines bürgerlich- hu-
manistischen Erziehungsideals fördernden
Einfluß geltend zu machen suchte.
Nördlich der Einmündung des Stiftsweges
setzte die Stadt Oldenburg 1920 die Sied-
lungsbautätigkeit in diesem Gebiet mit zwei
langgestreckten Putzbauten fort (Arch. Bie-
bel), die jeweils zwölf Wohnungen zu zwei,
drei bzw. vier Zimmern und Küche aufneh-
men (Nadorster Straße 209-217, Nr.
219-227). Ihre schlichte Gestaltung mit
Walmdach, die konventionelle Gliederung
durch vorspringende Seitenflügel und Mittel-
risalit sowie die Beschränkung auf wenige for-
male Motive (z. B. die rundbogigen Eingänge)
weist sie als typische Vertreter einer um Ein-
fachheit bemühten Architektur in der Wirt-
schaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg aus.
ALEXANDERSTRASSE
Die im Gegensatz zur Nadorster Straße ei-
nem gewunderenen Verlauf folgende, 1843
chaussierte Alexanderstraße durchzieht als
dritte Hauptachse das Gebiet der Nordstadt.
Abgesehen von der nicht überlieferten Bau-
substanz der ersten Hälfte des 19. Jh. im süd-
lichen Abschnitt am Gertrudenfriedhof, stam-
men die frühesten nachweisbaren Bauten
(mit Ausnahme des auf der Hotes-Karte von
1851 eingetragenen Hauses Nr. 94) aus den
sechziger und siebziger Jahren des 19. Jh.,
die als schlichte, fünfachsige Giebelhäuser
mit Drempel und mittigem Eingang errichtet
wurden (z.B. Nr. 46, 48, beide stark verän-
dert).
Eine große Zahl giebelständiger Wohnhäuser
mit Drempel des vierachsigen, seitlich er-
schlossenen Typs mit und ohne Souterrain
entstand während der achtziger und neunzi-
ger Jahre des 19. Jh. mit einer Fassadenaus-
stattung in Renaissancemotiven (z.B. Nr. 68,
70, 72, 74). Noch bestehende Baulücken
wurden im letzten Jahrzehnt des 19. Jh. und
um die Jahrhundertwende u.a. mit zweige-
schossigen Wohnhäusern unter Walm- oder
Mansarddach gefüllt, die wie die beiden back-
steinverblendeten Gebäude Nr. 25und Nr. 27
die asymmetrisch konzipierte Baukörperfor-
mation des Späthistorismus und eine beson-
ders auf exponierte Bauteile wie Zwerch-
hausgiebel und Altan konzentrierte Neure-
naissaceornamentik auszeichnen.
Der Stadtplan von 1901 zeigt eine vollstän-
dige Bebauung bis zur Getrudenstraße und
erst wieder im Kreuzungsbereich Melkbrink/
Lambertistraße eine stärkere Konzentration
von Gebäuden. Der dazwischenliegende Ab-
schnitt wurde vor allem in den beiden ersten
Jahrzehnten des 20. Jh. bebaut, so daß sich
auch hier wie bei Donnerschweerund Nador-
ster Straße ein heterogenes Straßenbild ent-
wickelte, das, beeinflußtdurch die Architektur
der letzten 40 Jahre, eine Mischung aus
Wohn-, Geschäftshäusern und kleineren Ge-
werbebetrieben prägt.
156