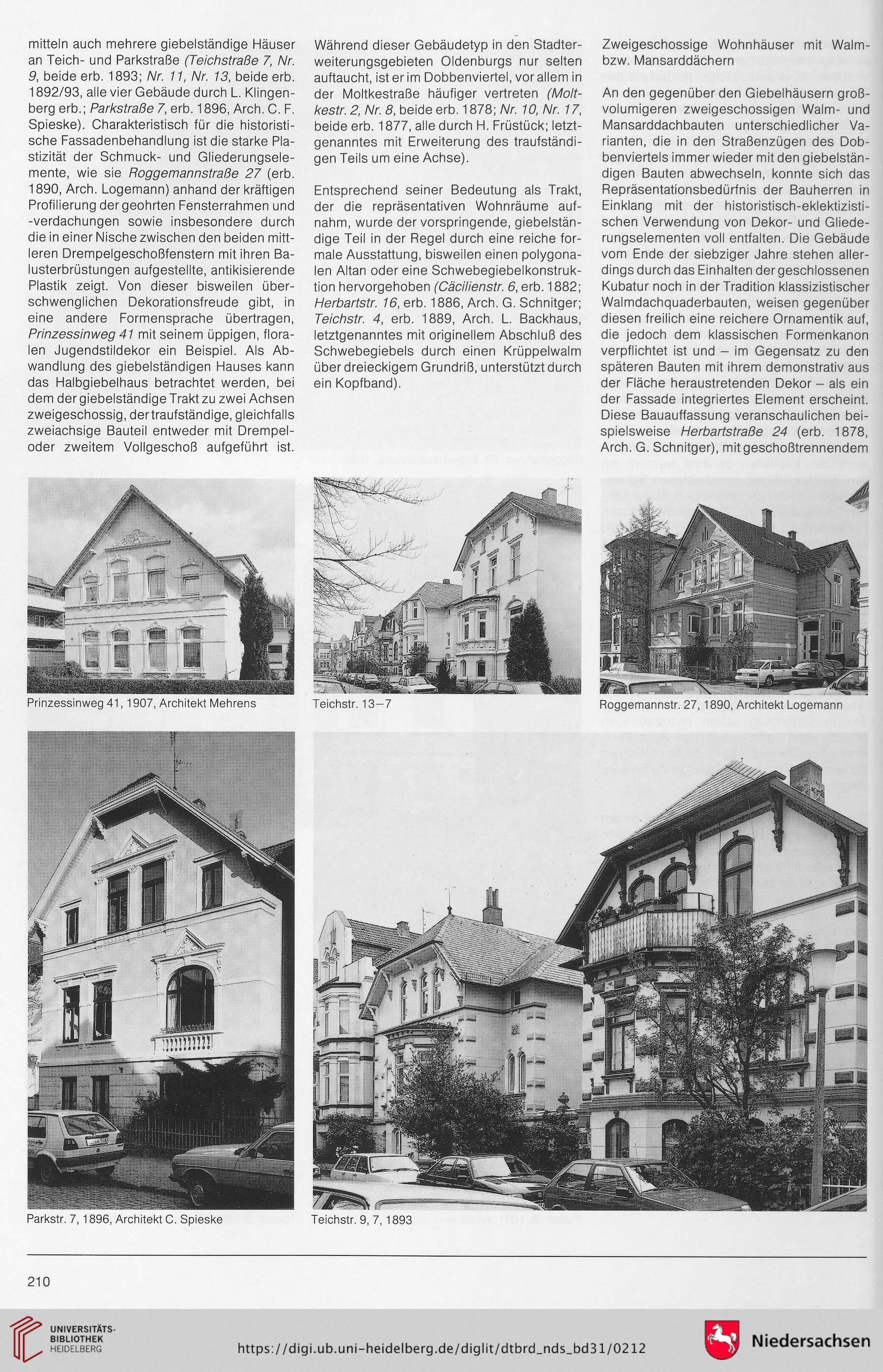mitteln auch mehrere giebelständige Häuser
an Teich- und Parkstraße (Teichstraße 7, Nr.
9, beide erb. 1893; Nr. 11, Nr. 13, beide erb.
1892/93, alle vier Gebäude durch L. Klingen-
berg erb.; Parkstraße 7, erb. 1896, Arch. C. F.
Spieske). Charakteristisch für die historisti-
sche Fassadenbehandlung ist die starke Pla-
stizität der Schmuck- und Gliederungsele-
mente, wie sie Poggemannstraße 27 (erb.
1890, Arch. Logemann) anhand der kräftigen
Profilierung dergeohrten Fensterrahmen und
-Verdachungen sowie insbesondere durch
die in einer Nische zwischen den beiden mitt-
leren Drempelgeschoßfenstern mit ihren Ba-
lusterbrüstungen aufgestellte, antikisierende
Plastik zeigt. Von dieser bisweilen über-
schwenglichen Dekorationsfreude gibt, in
eine andere Formensprache übertragen,
Prinzessinweg 41 mit seinem üppigen, flora-
len Jugendstildekor ein Beispiel. Als Ab-
wandlung des giebelständigen Hauses kann
das Halbgiebelhaus betrachtet werden, bei
dem dergiebelständigeTraktzu zwei Achsen
zweigeschossig, dertraufständige, gleichfalls
zweiachsige Bauteil entweder mit Drempel-
oder zweitem Vollgeschoß aufgeführt ist.
Parkstr. 7,1896, Architekt C. Spieske
Während dieser Gebäudetyp in den Stadter-
weiterungsgebieten Oldenburgs nur selten
auftaucht, ist er im Dobbenviertel, vor allem in
der Moltkestraße häufiger vertreten (Molt-
kestr. 2, Nr. 8, beide erb. 1878; Nr. 10, Nr. 17,
beide erb. 1877, alle durch H. Früstück; letzt-
genanntes mit Erweiterung des traufständi-
gen Teils um eine Achse).
Entsprechend seiner Bedeutung als Trakt,
der die repräsentativen Wohnräume auf-
nahm, wurde der vorspringende, giebelstän-
dige Teil in der Regel durch eine reiche for-
male Ausstattung, bisweilen einen polygona-
len Altan oder eine Schwebegiebelkonstruk-
tion hervorgehoben (Cäcilienstr. 6, erb. 1882;
Herbartstr. 16, erb. 1886, Arch. G. Schnitger;
Teichstr. 4, erb. 1889, Arch. L. Backhaus,
letztgenanntes mit originellem Abschluß des
Schwebegiebels durch einen Krüppelwalm
über dreieckigem Grundriß, unterstützt durch
ein Kopfband).
Zweigeschossige Wohnhäuser mit Walm-
bzw. Mansarddächern
An den gegenüber den Giebelhäusern groß-
volumigeren zweigeschossigen Walm- und
Mansarddachbauten unterschiedlicher Va-
rianten, die in den Straßenzügen des Dob-
benviertels immer wieder mit den giebelstän-
digen Bauten abwechseln, konnte sich das
Repräsentationsbedürfnis der Bauherren in
Einklang mit der historistisch-eklektizisti-
schen Verwendung von Dekor- und Gliede-
rungselementen voll entfalten. Die Gebäude
vom Ende der siebziger Jahre stehen aller-
dings durch das Einhalten der geschlossenen
Kubatur noch in der Tradition klassizistischer
Walmdachquaderbauten, weisen gegenüber
diesen freilich eine reichere Ornamentik auf,
die jedoch dem klassischen Formenkanon
verpflichtet ist und - im Gegensatz zu den
späteren Bauten mit ihrem demonstrativ aus
der Fläche heraustretenden Dekor - als ein
der Fassade integriertes Element erscheint.
Diese Bauauffassung veranschaulichen bei-
spielsweise Herbartstraße 24 (erb. 1878,
Arch. G. Schnitger), mit geschoßtrennendem
Teichstr. 13-7
Roggemannstr. 27, 1890, Architekt Logemann
Teichstr. 9, 7,1893
210
an Teich- und Parkstraße (Teichstraße 7, Nr.
9, beide erb. 1893; Nr. 11, Nr. 13, beide erb.
1892/93, alle vier Gebäude durch L. Klingen-
berg erb.; Parkstraße 7, erb. 1896, Arch. C. F.
Spieske). Charakteristisch für die historisti-
sche Fassadenbehandlung ist die starke Pla-
stizität der Schmuck- und Gliederungsele-
mente, wie sie Poggemannstraße 27 (erb.
1890, Arch. Logemann) anhand der kräftigen
Profilierung dergeohrten Fensterrahmen und
-Verdachungen sowie insbesondere durch
die in einer Nische zwischen den beiden mitt-
leren Drempelgeschoßfenstern mit ihren Ba-
lusterbrüstungen aufgestellte, antikisierende
Plastik zeigt. Von dieser bisweilen über-
schwenglichen Dekorationsfreude gibt, in
eine andere Formensprache übertragen,
Prinzessinweg 41 mit seinem üppigen, flora-
len Jugendstildekor ein Beispiel. Als Ab-
wandlung des giebelständigen Hauses kann
das Halbgiebelhaus betrachtet werden, bei
dem dergiebelständigeTraktzu zwei Achsen
zweigeschossig, dertraufständige, gleichfalls
zweiachsige Bauteil entweder mit Drempel-
oder zweitem Vollgeschoß aufgeführt ist.
Parkstr. 7,1896, Architekt C. Spieske
Während dieser Gebäudetyp in den Stadter-
weiterungsgebieten Oldenburgs nur selten
auftaucht, ist er im Dobbenviertel, vor allem in
der Moltkestraße häufiger vertreten (Molt-
kestr. 2, Nr. 8, beide erb. 1878; Nr. 10, Nr. 17,
beide erb. 1877, alle durch H. Früstück; letzt-
genanntes mit Erweiterung des traufständi-
gen Teils um eine Achse).
Entsprechend seiner Bedeutung als Trakt,
der die repräsentativen Wohnräume auf-
nahm, wurde der vorspringende, giebelstän-
dige Teil in der Regel durch eine reiche for-
male Ausstattung, bisweilen einen polygona-
len Altan oder eine Schwebegiebelkonstruk-
tion hervorgehoben (Cäcilienstr. 6, erb. 1882;
Herbartstr. 16, erb. 1886, Arch. G. Schnitger;
Teichstr. 4, erb. 1889, Arch. L. Backhaus,
letztgenanntes mit originellem Abschluß des
Schwebegiebels durch einen Krüppelwalm
über dreieckigem Grundriß, unterstützt durch
ein Kopfband).
Zweigeschossige Wohnhäuser mit Walm-
bzw. Mansarddächern
An den gegenüber den Giebelhäusern groß-
volumigeren zweigeschossigen Walm- und
Mansarddachbauten unterschiedlicher Va-
rianten, die in den Straßenzügen des Dob-
benviertels immer wieder mit den giebelstän-
digen Bauten abwechseln, konnte sich das
Repräsentationsbedürfnis der Bauherren in
Einklang mit der historistisch-eklektizisti-
schen Verwendung von Dekor- und Gliede-
rungselementen voll entfalten. Die Gebäude
vom Ende der siebziger Jahre stehen aller-
dings durch das Einhalten der geschlossenen
Kubatur noch in der Tradition klassizistischer
Walmdachquaderbauten, weisen gegenüber
diesen freilich eine reichere Ornamentik auf,
die jedoch dem klassischen Formenkanon
verpflichtet ist und - im Gegensatz zu den
späteren Bauten mit ihrem demonstrativ aus
der Fläche heraustretenden Dekor - als ein
der Fassade integriertes Element erscheint.
Diese Bauauffassung veranschaulichen bei-
spielsweise Herbartstraße 24 (erb. 1878,
Arch. G. Schnitger), mit geschoßtrennendem
Teichstr. 13-7
Roggemannstr. 27, 1890, Architekt Logemann
Teichstr. 9, 7,1893
210