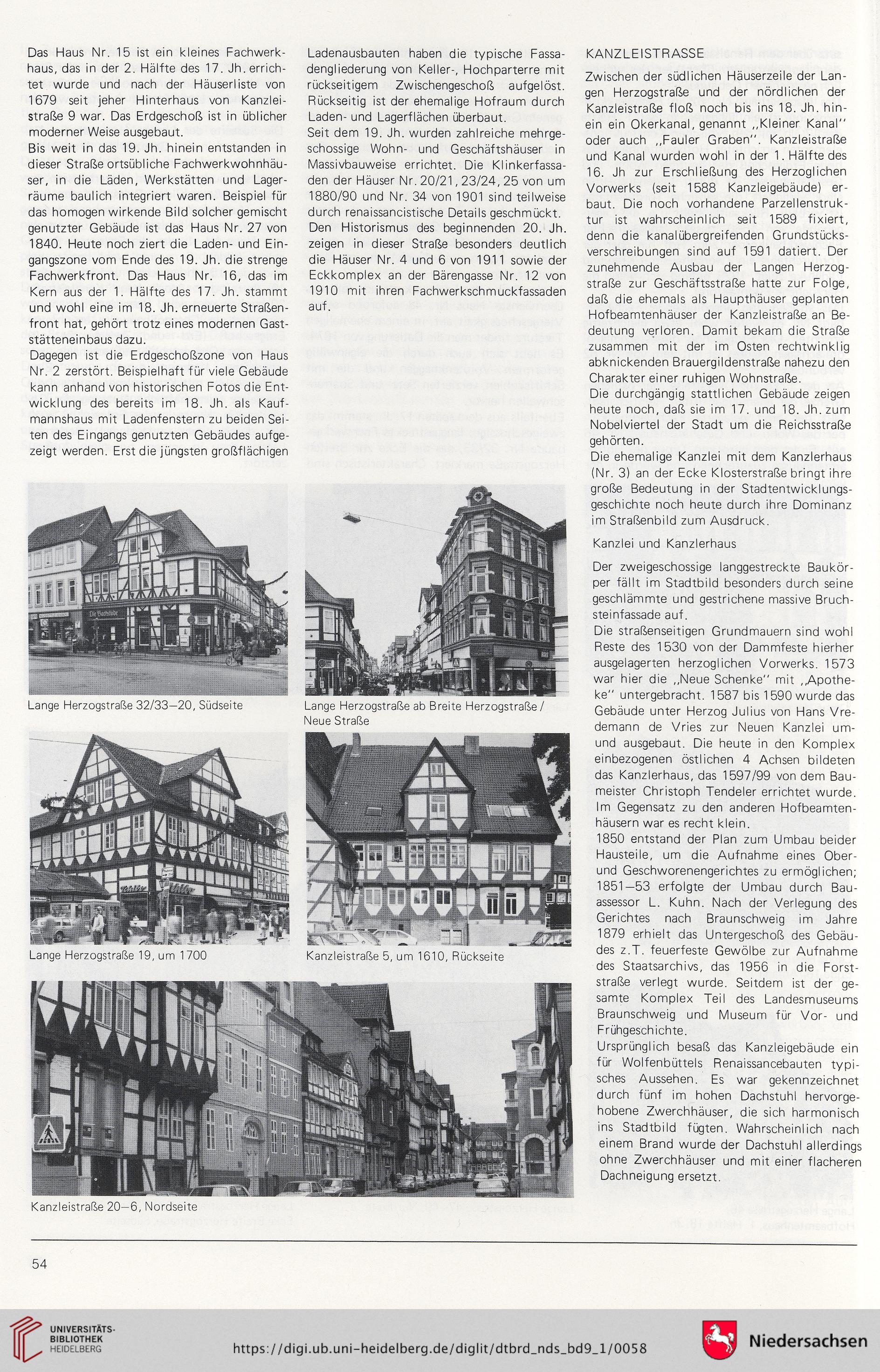Das Haus Nr. 15 ist ein kleines Fachwerk-
haus, das in der 2. Hälfte des 17. Jh. errich-
tet wurde und nach der Häuserliste von
1679 seit jeher Hinterhaus von Kanzlei-
straße 9 war. Das Erdgeschoß ist in üblicher
moderner Weise ausgebaut.
Bis weit in das 19. Jh. hinein entstanden in
dieser Straße ortsübliche Fachwerkwohnhäu-
ser, in die Läden, Werkstätten und Lager-
räume baulich integriert waren. Beispiel für
das homogen wirkende Bild solcher gemischt
genutzter Gebäude ist das Haus Nr. 27 von
1840. Heute noch ziert die Laden- und Ein-
gangszone vom Ende des 19. Jh. die strenge
Fachwerkfront. Das Haus Nr. 16, das im
Kern aus der 1. Hälfte des 17. Jh. stammt
und wohl eine im 18. Jh. erneuerte Straßen-
front hat, gehört trotz eines modernen Gast-
stätteneinbaus dazu.
Dagegen ist die Erdgeschoßzone von Haus
Nr. 2 zerstört. Beispielhaft für viele Gebäude
kann anhand von historischen Fotos die Ent-
wicklung des bereits im 18. Jh. als Kauf-
mannshaus mit Ladenfenstern zu beiden Sei-
ten des Eingangs genutzten Gebäudes aufge-
zeigt werden. Erst die jüngsten großflächigen
Ladenausbauten haben die typische Fassa-
dengliederung von Keller-, Hochparterre mit
rückseitigem Zwischengeschoß aufgelöst.
Rückseitig ist der ehemalige Hofraum durch
Laden- und Lagerflächen überbaut.
Seit dem 19. Jh. wurden zahlreiche mehrge-
schossige Wohn- und Geschäftshäuser in
Massivbauweise errichtet. Die Klinkerfassa-
den der Häuser Nr. 20/21,23/24, 25 von um
1880/90 und Nr. 34 von 1901 sind teilweise
durch renaissancistische Details geschmückt.
Den Historismus des beginnenden 20. Jh.
zeigen in dieser Straße besonders deutlich
die Häuser Nr. 4 und 6 von 1911 sowie der
Eckkomplex an der Bärengasse Nr. 12 von
1910 mit ihren Fachwerkschmuckfassaden
auf.
Lange Herzogstraße 32/33—20, Südseite
Lange Herzogstraße 19, um 1700
Lange Herzogstraße ab Breite Herzogstraße/
Neue Straße
Kanzleistraße 5, um 1610, Rückseite
Kanzleistraße 20-6, Nordseite
KANZLEISTRASSE
Zwischen der südlichen Häuserzeile der Lan-
gen Herzogstraße und der nördlichen der
Kanzleistraße floß noch bis ins 18. Jh. hin-
ein ein Okerkanal, genannt „Kleiner Kanal”
oder auch „Fauler Graben". Kanzleistraße
und Kanal wurden wohl in der 1. Hälfte des
16. Jh zur Erschließung des Herzoglichen
Vorwerks (seit 1588 Kanzleigebäude) er-
baut. Die noch vorhandene Parzellenstruk-
tur ist wahrscheinlich seit 1589 fixiert,
denn die kanalübergreifenden Grundstücks-
verschreibungen sind auf 1591 datiert. Der
zunehmende Ausbau der Langen Herzog-
straße zur Geschäftsstraße hatte zur Folge,
daß die ehemals als Haupthäuser geplanten
Hofbeamtenhäuser der Kanzleistraße an Be-
deutung verloren. Damit bekam die Straße
zusammen mit der im Osten rechtwinklig
abknickenden Brauergildenstraße nahezu den
Charakter einer ruhigen Wohnstraße.
Die durchgängig stattlichen Gebäude zeigen
heute noch, daß sie im 17. und 18. Jh. zum
Nobelviertel der Stadt um die Reichsstraße
gehörten.
Die ehemalige Kanzlei mit dem Kanzlerhaus
(Nr. 3) an der Ecke Klosterstraße bringt ihre
große Bedeutung in der Stadtentwicklungs-
geschichte noch heute durch ihre Dominanz
im Straßenbild zum Ausdruck.
Kanzlei und Kanzlerhaus
Der zweigeschossige langgestreckte Baukör-
per fällt im Stadtbild besonders durch seine
geschlämmte und gestrichene massive Bruch-
steinfassade auf.
Die straßenseitigen Grundmauern sind wohl
Reste des 1530 von der Dammfeste hierher
ausgelagerten herzoglichen Vorwerks. 1573
war hier die „Neue Schenke" mit „Apothe-
ke" untergebracht. 1587 bis 1590 wurde das
Gebäude unter Herzog Julius von Hans Vre-
demann de Vries zur Neuen Kanzlei um-
und ausgebaut. Die heute in den Komplex
einbezogenen östlichen 4 Achsen bildeten
das Kanzlerhaus, das 1597/99 von dem Bau-
meister Christoph Tendeler errichtet wurde.
Im Gegensatz zu den anderen Hofbeamten-
häusern war es recht klein.
1850 entstand der Plan zum Umbau beider
Hausteile, um die Aufnahme eines Ober-
und Geschworenengerichtes zu ermöglichen;
1851—53 erfolgte der Umbau durch Bau-
assessor L. Kuhn. Nach der Verlegung des
Gerichtes nach Braunschweig im Jahre
1879 erhielt das Untergeschoß des Gebäu-
des z.T. feuerfeste Gewölbe zur Aufnahme
des Staatsarchivs, das 1956 in die Forst-
straße verlegt wurde. Seitdem ist der ge-
samte Komplex Teil des Landesmuseums
Braunschweig und Museum für Vor- und
Frühgeschichte.
Ursprünglich besaß das Kanzleigebäude ein
für Wolfenbüttels Renaissancebauten typi-
sches Aussehen. Es war gekennzeichnet
durch fünf im hohen Dachstuhl hervorge-
hobene Zwerchhäuser, die sich harmonisch
ins Stadtbild fügten. Wahrscheinlich nach
einem Brand wurde der Dachstuhl allerdings
ohne Zwerchhäuser und mit einer flacheren
Dachneigung ersetzt.
54
haus, das in der 2. Hälfte des 17. Jh. errich-
tet wurde und nach der Häuserliste von
1679 seit jeher Hinterhaus von Kanzlei-
straße 9 war. Das Erdgeschoß ist in üblicher
moderner Weise ausgebaut.
Bis weit in das 19. Jh. hinein entstanden in
dieser Straße ortsübliche Fachwerkwohnhäu-
ser, in die Läden, Werkstätten und Lager-
räume baulich integriert waren. Beispiel für
das homogen wirkende Bild solcher gemischt
genutzter Gebäude ist das Haus Nr. 27 von
1840. Heute noch ziert die Laden- und Ein-
gangszone vom Ende des 19. Jh. die strenge
Fachwerkfront. Das Haus Nr. 16, das im
Kern aus der 1. Hälfte des 17. Jh. stammt
und wohl eine im 18. Jh. erneuerte Straßen-
front hat, gehört trotz eines modernen Gast-
stätteneinbaus dazu.
Dagegen ist die Erdgeschoßzone von Haus
Nr. 2 zerstört. Beispielhaft für viele Gebäude
kann anhand von historischen Fotos die Ent-
wicklung des bereits im 18. Jh. als Kauf-
mannshaus mit Ladenfenstern zu beiden Sei-
ten des Eingangs genutzten Gebäudes aufge-
zeigt werden. Erst die jüngsten großflächigen
Ladenausbauten haben die typische Fassa-
dengliederung von Keller-, Hochparterre mit
rückseitigem Zwischengeschoß aufgelöst.
Rückseitig ist der ehemalige Hofraum durch
Laden- und Lagerflächen überbaut.
Seit dem 19. Jh. wurden zahlreiche mehrge-
schossige Wohn- und Geschäftshäuser in
Massivbauweise errichtet. Die Klinkerfassa-
den der Häuser Nr. 20/21,23/24, 25 von um
1880/90 und Nr. 34 von 1901 sind teilweise
durch renaissancistische Details geschmückt.
Den Historismus des beginnenden 20. Jh.
zeigen in dieser Straße besonders deutlich
die Häuser Nr. 4 und 6 von 1911 sowie der
Eckkomplex an der Bärengasse Nr. 12 von
1910 mit ihren Fachwerkschmuckfassaden
auf.
Lange Herzogstraße 32/33—20, Südseite
Lange Herzogstraße 19, um 1700
Lange Herzogstraße ab Breite Herzogstraße/
Neue Straße
Kanzleistraße 5, um 1610, Rückseite
Kanzleistraße 20-6, Nordseite
KANZLEISTRASSE
Zwischen der südlichen Häuserzeile der Lan-
gen Herzogstraße und der nördlichen der
Kanzleistraße floß noch bis ins 18. Jh. hin-
ein ein Okerkanal, genannt „Kleiner Kanal”
oder auch „Fauler Graben". Kanzleistraße
und Kanal wurden wohl in der 1. Hälfte des
16. Jh zur Erschließung des Herzoglichen
Vorwerks (seit 1588 Kanzleigebäude) er-
baut. Die noch vorhandene Parzellenstruk-
tur ist wahrscheinlich seit 1589 fixiert,
denn die kanalübergreifenden Grundstücks-
verschreibungen sind auf 1591 datiert. Der
zunehmende Ausbau der Langen Herzog-
straße zur Geschäftsstraße hatte zur Folge,
daß die ehemals als Haupthäuser geplanten
Hofbeamtenhäuser der Kanzleistraße an Be-
deutung verloren. Damit bekam die Straße
zusammen mit der im Osten rechtwinklig
abknickenden Brauergildenstraße nahezu den
Charakter einer ruhigen Wohnstraße.
Die durchgängig stattlichen Gebäude zeigen
heute noch, daß sie im 17. und 18. Jh. zum
Nobelviertel der Stadt um die Reichsstraße
gehörten.
Die ehemalige Kanzlei mit dem Kanzlerhaus
(Nr. 3) an der Ecke Klosterstraße bringt ihre
große Bedeutung in der Stadtentwicklungs-
geschichte noch heute durch ihre Dominanz
im Straßenbild zum Ausdruck.
Kanzlei und Kanzlerhaus
Der zweigeschossige langgestreckte Baukör-
per fällt im Stadtbild besonders durch seine
geschlämmte und gestrichene massive Bruch-
steinfassade auf.
Die straßenseitigen Grundmauern sind wohl
Reste des 1530 von der Dammfeste hierher
ausgelagerten herzoglichen Vorwerks. 1573
war hier die „Neue Schenke" mit „Apothe-
ke" untergebracht. 1587 bis 1590 wurde das
Gebäude unter Herzog Julius von Hans Vre-
demann de Vries zur Neuen Kanzlei um-
und ausgebaut. Die heute in den Komplex
einbezogenen östlichen 4 Achsen bildeten
das Kanzlerhaus, das 1597/99 von dem Bau-
meister Christoph Tendeler errichtet wurde.
Im Gegensatz zu den anderen Hofbeamten-
häusern war es recht klein.
1850 entstand der Plan zum Umbau beider
Hausteile, um die Aufnahme eines Ober-
und Geschworenengerichtes zu ermöglichen;
1851—53 erfolgte der Umbau durch Bau-
assessor L. Kuhn. Nach der Verlegung des
Gerichtes nach Braunschweig im Jahre
1879 erhielt das Untergeschoß des Gebäu-
des z.T. feuerfeste Gewölbe zur Aufnahme
des Staatsarchivs, das 1956 in die Forst-
straße verlegt wurde. Seitdem ist der ge-
samte Komplex Teil des Landesmuseums
Braunschweig und Museum für Vor- und
Frühgeschichte.
Ursprünglich besaß das Kanzleigebäude ein
für Wolfenbüttels Renaissancebauten typi-
sches Aussehen. Es war gekennzeichnet
durch fünf im hohen Dachstuhl hervorge-
hobene Zwerchhäuser, die sich harmonisch
ins Stadtbild fügten. Wahrscheinlich nach
einem Brand wurde der Dachstuhl allerdings
ohne Zwerchhäuser und mit einer flacheren
Dachneigung ersetzt.
54