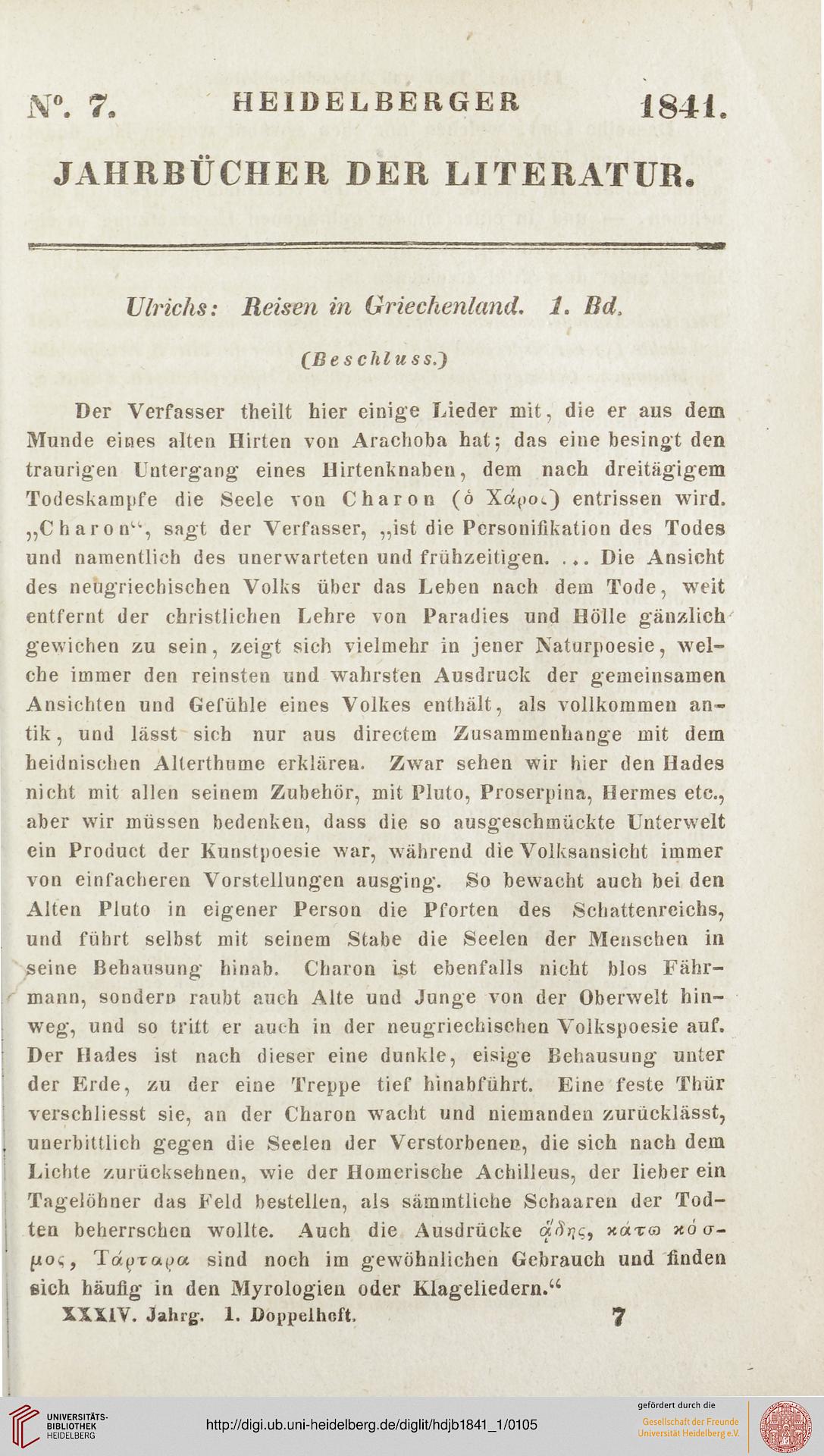N°. 7. HEIDELBERGER 1841.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Ulrichs: Reisen in Griechenland. 1. Rd,
(Beschluss.)
Der Verfasser theilt hier einige Lieder mit, die er aus dem
Munde eines alten Hirten von Arachoba hat; das eine besingt den
traurigen Untergang eines Hirtenknaben, dem nach dreitägigem
Todeskampfe die Seele von Charon (6 Xctpot) entrissen wird.
„Charon“, sagt der Verfasser, „ist die Personifikation des Todes
und namentlich des unerwarteten und frühzeitigen. ... Die Ansicht
des neugriechischen Volks über das Leben nach dem Tode, weit
entfernt der christlichen Lehre von Paradies und Hölle gänzlich
gewichen zu sein, zeigt sich vielmehr in jener Naturpoesie, wel-
che immer den reinsten und wahrsten Ausdruck der gemeinsamen
Ansichten und Gefühle eines Volkes enthält, als vollkommen an-
tik, und lässt sich nur aus directem Zusammenhänge mit dem
heidnischen Alterthume erklären. Zwar sehen wir hier den Hades
nicht mit allen seinem Zubehör, mit Pluto, Proserpina, Hermes etc.,
aber wir müssen bedenken, dass die so ausgeschmückte Unterwelt
ein Product der Kunstpoesie war, während die Volksansicht immer
von einfacheren Vorstellungen ausging. So bewacht auch bei den
Alten Pluto in eigener Person die Pforten des Schattenreichs,
und führt selbst mit seinem Stabe die Seelen der Menschen in
seine Behausung hinab. Charon ist ebenfalls nicht blos Fähr-
mann, sondern raubt auch Alte und Junge von der Oberwelt hin-
weg, und so tritt er auch in der neugriechischen Volkspoesie auf.
Der Hades ist nach dieser eine dunkle, eisige Behausung unter
der Erde, zu der eine Treppe tief hinabführt. Eine feste Thür
verschliesst sie, an der Charon wacht und niemanden zurücklässt,
unerbittlich gegen die Seelen der Verstorbenen, die sich nach dem
Lichte zurücksehnen, wie der Homerische Achilleus, der lieber ein
Tagelöhner das Feld bestellen, als sämmtliche Sehaaren der Tod-
ten beherrschen wollte. Auch die Ausdrücke xara xdcr-
pos, Tapxapa sind noch im gewöhnlichen Gebrauch und finden
eich häufig in den Myrologien oder Klageliedern.“
X.XXJ.V. Jahrg. 1. Doppelheft.
7
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Ulrichs: Reisen in Griechenland. 1. Rd,
(Beschluss.)
Der Verfasser theilt hier einige Lieder mit, die er aus dem
Munde eines alten Hirten von Arachoba hat; das eine besingt den
traurigen Untergang eines Hirtenknaben, dem nach dreitägigem
Todeskampfe die Seele von Charon (6 Xctpot) entrissen wird.
„Charon“, sagt der Verfasser, „ist die Personifikation des Todes
und namentlich des unerwarteten und frühzeitigen. ... Die Ansicht
des neugriechischen Volks über das Leben nach dem Tode, weit
entfernt der christlichen Lehre von Paradies und Hölle gänzlich
gewichen zu sein, zeigt sich vielmehr in jener Naturpoesie, wel-
che immer den reinsten und wahrsten Ausdruck der gemeinsamen
Ansichten und Gefühle eines Volkes enthält, als vollkommen an-
tik, und lässt sich nur aus directem Zusammenhänge mit dem
heidnischen Alterthume erklären. Zwar sehen wir hier den Hades
nicht mit allen seinem Zubehör, mit Pluto, Proserpina, Hermes etc.,
aber wir müssen bedenken, dass die so ausgeschmückte Unterwelt
ein Product der Kunstpoesie war, während die Volksansicht immer
von einfacheren Vorstellungen ausging. So bewacht auch bei den
Alten Pluto in eigener Person die Pforten des Schattenreichs,
und führt selbst mit seinem Stabe die Seelen der Menschen in
seine Behausung hinab. Charon ist ebenfalls nicht blos Fähr-
mann, sondern raubt auch Alte und Junge von der Oberwelt hin-
weg, und so tritt er auch in der neugriechischen Volkspoesie auf.
Der Hades ist nach dieser eine dunkle, eisige Behausung unter
der Erde, zu der eine Treppe tief hinabführt. Eine feste Thür
verschliesst sie, an der Charon wacht und niemanden zurücklässt,
unerbittlich gegen die Seelen der Verstorbenen, die sich nach dem
Lichte zurücksehnen, wie der Homerische Achilleus, der lieber ein
Tagelöhner das Feld bestellen, als sämmtliche Sehaaren der Tod-
ten beherrschen wollte. Auch die Ausdrücke xara xdcr-
pos, Tapxapa sind noch im gewöhnlichen Gebrauch und finden
eich häufig in den Myrologien oder Klageliedern.“
X.XXJ.V. Jahrg. 1. Doppelheft.
7