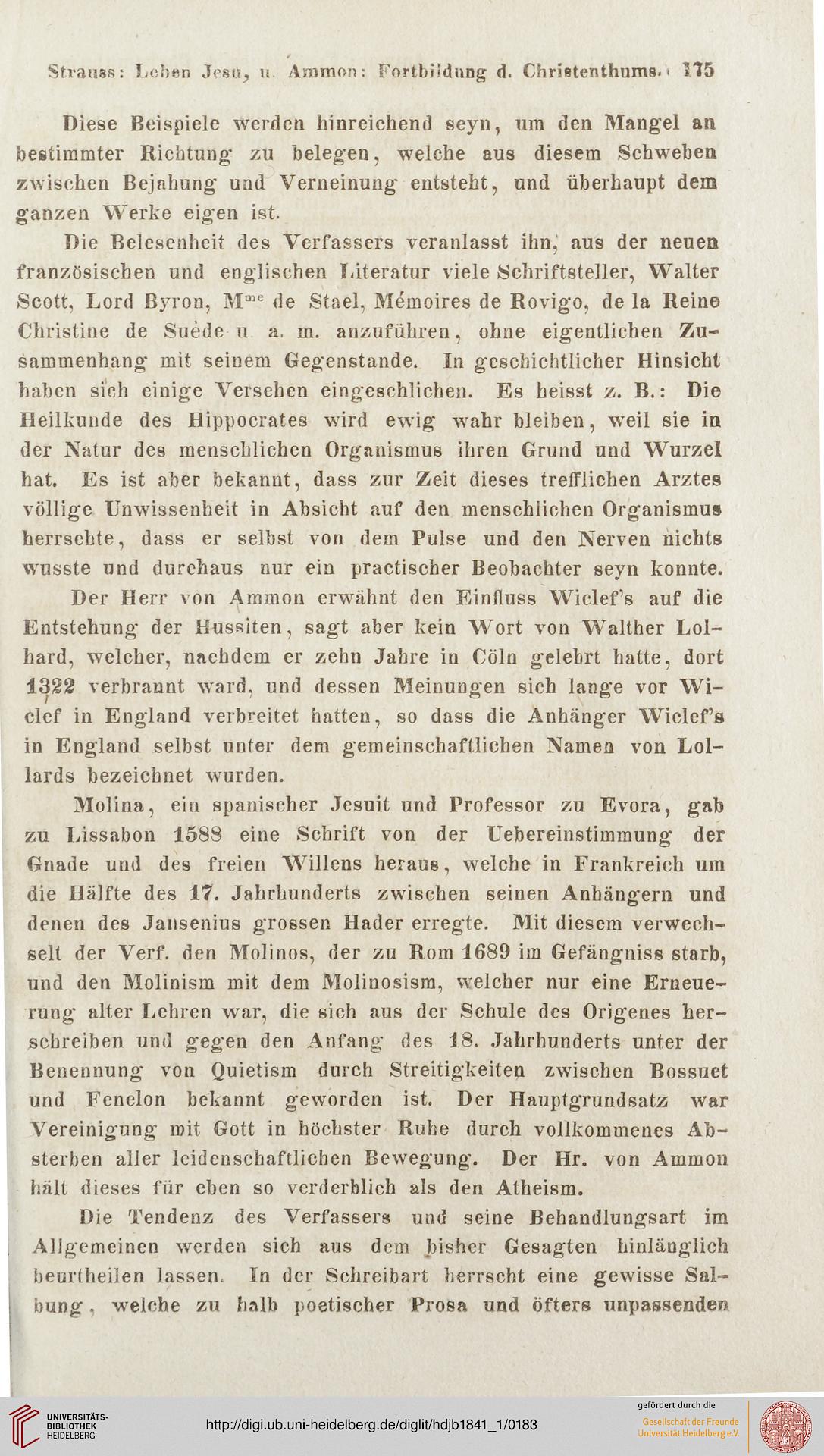Strangs: Lehen Jesu^ u Ammon: Fortbildung d. Christenthums. > 175
Diese Beispiele werden hinreichend seyn, um den Mangel an
bestimmter Richtung- zu belegen, welche aus diesem Schweben
zwischen Bejahung und Verneinung entsteht, und überhaupt dem
ganzen Werke eigen ist.
Die Belesenheit des Verfassers veranlasst ihn, aus der neuen
französischen und englischen Literatur viele Schriftsteller, Walter
Scott, Lord Byron, Mme de Stael, Memoires de Rovigo, de la Reine
Christine de Suede u a. m. anzuführen, ohne eigentlichen Zu-
sammenhang mit seinem Gegenstände. In geschichtlicher Hinsicht
haben sich einige Versehen eingeschlichen. Es heisst z. B.: Die
Heilkunde des Hippocrates wird ewig wahr bleiben, weil sie in
der Natur des menschlichen Organismus ihren Grund und Wurzel
hat. Es ist aber bekannt, dass zur Zeit dieses trefflichen Arztes
völlige Unwissenheit in Absicht auf den menschlichen Organismus
herrschte, dass er selbst von dem Pulse und den Nerven nichts
wusste und durchaus nur ein practischer Beobachter seyn konnte.
Der Herr von Ammon erwähnt den Einfluss Wiclef’s auf die
Entstehung der Hussiten, sagt aber kein Wort von Walther Lol-
hard, welcher, nachdem er zehn Jahre in Cöln gelehrt hatte, dort
1322 verbrannt ward, und dessen Meinungen sich lange vor Wi-
clef in England verbreitet hatten, so dass die Anhänger Wicleffs
in England selbst unter dem gemeinschaftlichen Namen von Lol-
lards bezeichnet wurden.
Molina, ein spanischer Jesuit und Professor zu Evora, gab
zu Lissabon 1588 eine Schrift von der Uebereinstimmung der
Gnade und des freien Willens heraus, welche in Frankreich um
die Hälfte des 17. Jahrhunderts zwischen seinen Anhängern und
denen des Jansenius grossen Hader erregte. Mit diesem verwech-
selt der Verf. den Molinos, der zu Rom 1689 im Gefängniss starb,
und den Molinism mit dem Molinosism, welcher nur eine Erneue-
rung alter Lehren war, die sich aus der Schule des Origenes her-
schreiben und gegen den Anfang des 18. Jahrhunderts unter der
Benennung von Quietism durch Streitigkeiten zwischen Bossuet
und Fenelon bekannt geworden ist. Der Hauptgrundsatz war
Vereinigung mit Gott in höchster Ruhe durch vollkommenes Ab-
sterben aller leidenschaftlichen Bewegung. Der Hr. von Ammon
hält dieses für eben so verderblich als den Atheism.
Die Tendenz des Verfassers und seine Behandlungsart im
Allgemeinen werden sich aus dem bisher Gesagten hinlänglich
beurtheilen lassen. In der Schreibart herrscht eine gewisse Sal-
bung , welche zu halb poetischer Prosa und öfters unpassenden
Diese Beispiele werden hinreichend seyn, um den Mangel an
bestimmter Richtung- zu belegen, welche aus diesem Schweben
zwischen Bejahung und Verneinung entsteht, und überhaupt dem
ganzen Werke eigen ist.
Die Belesenheit des Verfassers veranlasst ihn, aus der neuen
französischen und englischen Literatur viele Schriftsteller, Walter
Scott, Lord Byron, Mme de Stael, Memoires de Rovigo, de la Reine
Christine de Suede u a. m. anzuführen, ohne eigentlichen Zu-
sammenhang mit seinem Gegenstände. In geschichtlicher Hinsicht
haben sich einige Versehen eingeschlichen. Es heisst z. B.: Die
Heilkunde des Hippocrates wird ewig wahr bleiben, weil sie in
der Natur des menschlichen Organismus ihren Grund und Wurzel
hat. Es ist aber bekannt, dass zur Zeit dieses trefflichen Arztes
völlige Unwissenheit in Absicht auf den menschlichen Organismus
herrschte, dass er selbst von dem Pulse und den Nerven nichts
wusste und durchaus nur ein practischer Beobachter seyn konnte.
Der Herr von Ammon erwähnt den Einfluss Wiclef’s auf die
Entstehung der Hussiten, sagt aber kein Wort von Walther Lol-
hard, welcher, nachdem er zehn Jahre in Cöln gelehrt hatte, dort
1322 verbrannt ward, und dessen Meinungen sich lange vor Wi-
clef in England verbreitet hatten, so dass die Anhänger Wicleffs
in England selbst unter dem gemeinschaftlichen Namen von Lol-
lards bezeichnet wurden.
Molina, ein spanischer Jesuit und Professor zu Evora, gab
zu Lissabon 1588 eine Schrift von der Uebereinstimmung der
Gnade und des freien Willens heraus, welche in Frankreich um
die Hälfte des 17. Jahrhunderts zwischen seinen Anhängern und
denen des Jansenius grossen Hader erregte. Mit diesem verwech-
selt der Verf. den Molinos, der zu Rom 1689 im Gefängniss starb,
und den Molinism mit dem Molinosism, welcher nur eine Erneue-
rung alter Lehren war, die sich aus der Schule des Origenes her-
schreiben und gegen den Anfang des 18. Jahrhunderts unter der
Benennung von Quietism durch Streitigkeiten zwischen Bossuet
und Fenelon bekannt geworden ist. Der Hauptgrundsatz war
Vereinigung mit Gott in höchster Ruhe durch vollkommenes Ab-
sterben aller leidenschaftlichen Bewegung. Der Hr. von Ammon
hält dieses für eben so verderblich als den Atheism.
Die Tendenz des Verfassers und seine Behandlungsart im
Allgemeinen werden sich aus dem bisher Gesagten hinlänglich
beurtheilen lassen. In der Schreibart herrscht eine gewisse Sal-
bung , welche zu halb poetischer Prosa und öfters unpassenden