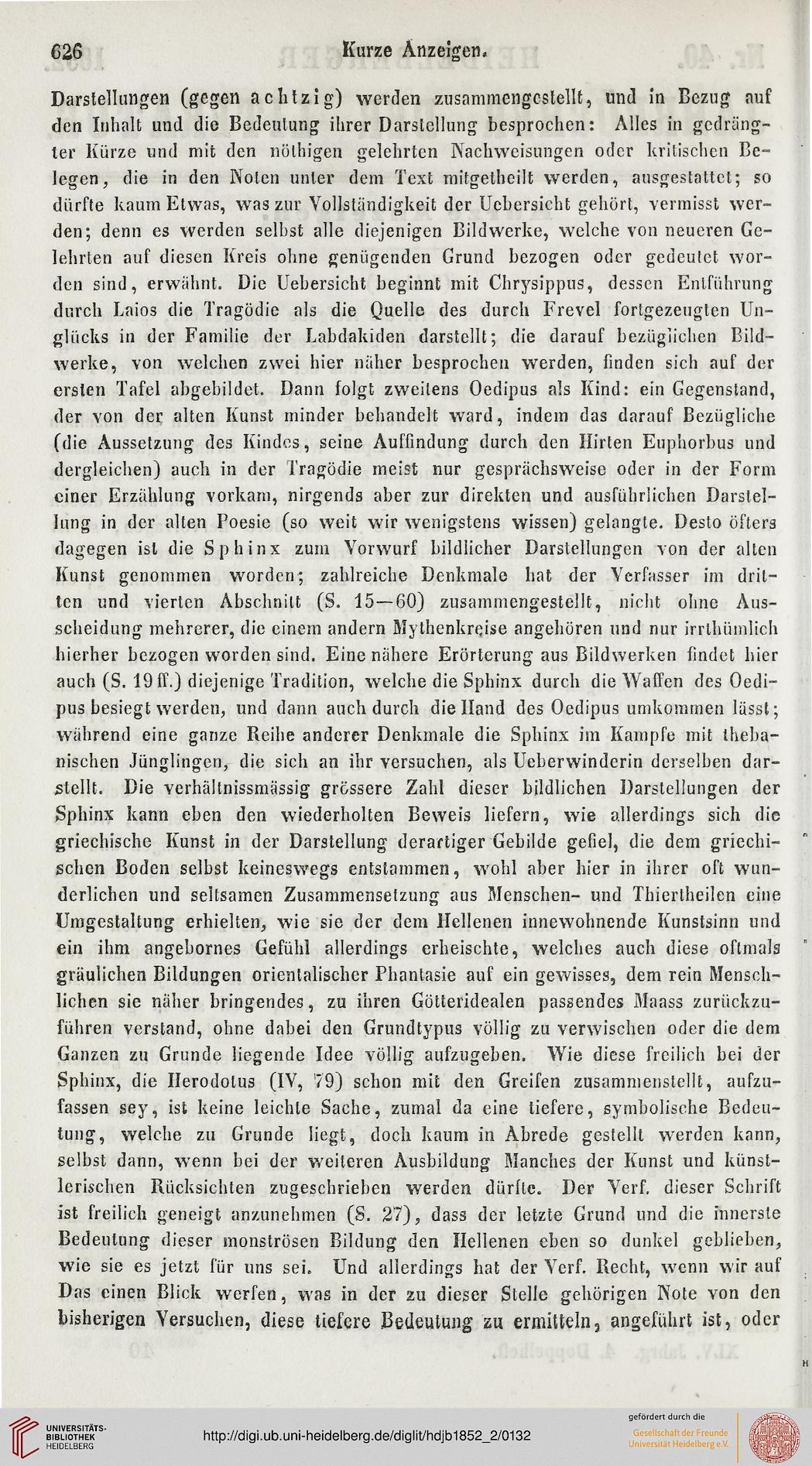626
Kurze Anzeigen.
Darstellungen (gegen achtzig) werden zusammengcstellt, und in Bezug auf
den Inhalt und die Bedeutung ihrer Darstellung besprochen: Alles in gedräng-
ter Kürze und mit den nölhigen gelehrten Nachweisungen oder kritischen Be-
legen, die in den Noten unter dem Text mitgethcilt werden, ausgestattet; so
dürfte kaum Etwas, was zur Vollständigkeit der Ucbersicht gehört, vermisst wer-
den; denn es werden selbst alle diejenigen Bildwerke, welche von neueren Ge-
lehrten auf diesen Kreis ohne genügenden Grund bezogen oder gedeutet wor-
den sind, erwähnt. Die Uebersicht beginnt mit Chrysippus, dessen Entführung
durch Laios die Tragödie als die Quelle des durch Frevel fortgezeugten Un-
glücks in der Familie der Labdakiden darstellt; die darauf bezüglichen Bild-
werke, von welchen zwei hier näher besprochen werden, finden sich auf der
ersten Tafel abgebildet. Dann folgt zweitens Oedipus als Kind: ein Gegenstand,
der von der alten Kunst minder behandelt ward, indem das darauf Bezügliche
(die Aussetzung des Kindes, seine Auffindung durch den Hirten Euphorbus und
dergleichen) auch in der Tragödie meist nur gesprächsweise oder in der Form
einer Erzählung vorkam, nirgends aber zur direkten und ausführlichen Darstel-
lung in der alten Poesie (so weit wir wenigstens wissen) gelangte. Desto öfters
dagegen ist die Sphinx zum Vorwurf bildlicher Darstellungen von der alten
Kunst genommen worden; zahlreiche Denkmale hat der Verfasser im drit-
ten und vierten Abschnitt (S. 15—60) zusammengestellt, nicht ohne Aus-
scheidung mehrerer, die einem andern Mythenkreise angehören und nur irrlhümlich
hierher bezogen worden sind. Eine nähere Erörterung aus Bildwerken findet hier
auch (S. 19 ff.) diejenige Tradition, welche die Sphinx durch die Waffen des Oedi-
pus besiegt werden, und dann auch durch die Hand des Oedipus umkommen lässt;
während eine ganze Reihe anderer Denkmale die Sphinx im Kampfe mit theba-
nischen Jünglingen, die sich an ihr versuchen, als Ueberwinderin derselben dar-
stellt. Die verhältnissmässig grössere Zahl dieser bildlichen Darstellungen der
Sphinx kann eben den wiederholten Beweis liefern, wie allerdings sich die
griechische Kunst in der Darstellung derartiger Gebilde gefiel, die dem griechi-
schen Boden selbst keineswegs entstammen, wohl aber hier in ihrer oft wun-
derlichen und seltsamen Zusammensetzung aus Menschen- und Thiertheilen eine
Umgestaltung erhielten, wie sie der dem Hellenen innewohnende Kunstsinn und
ein ihm angebornes Gefühl allerdings erheischte, welches auch diese oftmals
gräulichen Bildungen orientalischer Phantasie auf ein gewisses, dem rein Mensch-
lichen sie näher bringendes, zu ihren Götteridealen passendes Maass zurückzu-
führen verstand, ohne dabei den Grundtypus völlig zu verwischen oder die dem
Ganzen zu Grunde liegende Idee völlig aufzugeben. Wie diese freilich bei der
Sphinx, die Ilerodolus (IV, 79) schon mit den Greifen zusammenstellt, aufzu-
fassen sey, ist keine leichte Sache, zumal da eine tiefere, symbolische Bedeu-
tung, welche zu Grunde liegt, doch kaum in Abrede gestellt werden kann,
selbst dann, wenn bei der weiteren Ausbildung Manches der Kunst und künst-
lerischen Rücksichten zugeschrieben werden dürfte. Der Verf. dieser Schrift
ist freilich geneigt anzunehmen (S. 27), dass der letzte Grund und die innerste
Bedeutung dieser monströsen Bildung den Hellenen eben so dunkel geblieben,
wie sie es jetzt für uns sei. Und allerdings hat der Verf. Recht, wenn wir auf
Das einen Blick werfen, was in der zu dieser Stelle gehörigen Note von den
bisherigen Versuchen, diese tiefere Bedeutung zu ermitteln, angeführt ist, oder
Kurze Anzeigen.
Darstellungen (gegen achtzig) werden zusammengcstellt, und in Bezug auf
den Inhalt und die Bedeutung ihrer Darstellung besprochen: Alles in gedräng-
ter Kürze und mit den nölhigen gelehrten Nachweisungen oder kritischen Be-
legen, die in den Noten unter dem Text mitgethcilt werden, ausgestattet; so
dürfte kaum Etwas, was zur Vollständigkeit der Ucbersicht gehört, vermisst wer-
den; denn es werden selbst alle diejenigen Bildwerke, welche von neueren Ge-
lehrten auf diesen Kreis ohne genügenden Grund bezogen oder gedeutet wor-
den sind, erwähnt. Die Uebersicht beginnt mit Chrysippus, dessen Entführung
durch Laios die Tragödie als die Quelle des durch Frevel fortgezeugten Un-
glücks in der Familie der Labdakiden darstellt; die darauf bezüglichen Bild-
werke, von welchen zwei hier näher besprochen werden, finden sich auf der
ersten Tafel abgebildet. Dann folgt zweitens Oedipus als Kind: ein Gegenstand,
der von der alten Kunst minder behandelt ward, indem das darauf Bezügliche
(die Aussetzung des Kindes, seine Auffindung durch den Hirten Euphorbus und
dergleichen) auch in der Tragödie meist nur gesprächsweise oder in der Form
einer Erzählung vorkam, nirgends aber zur direkten und ausführlichen Darstel-
lung in der alten Poesie (so weit wir wenigstens wissen) gelangte. Desto öfters
dagegen ist die Sphinx zum Vorwurf bildlicher Darstellungen von der alten
Kunst genommen worden; zahlreiche Denkmale hat der Verfasser im drit-
ten und vierten Abschnitt (S. 15—60) zusammengestellt, nicht ohne Aus-
scheidung mehrerer, die einem andern Mythenkreise angehören und nur irrlhümlich
hierher bezogen worden sind. Eine nähere Erörterung aus Bildwerken findet hier
auch (S. 19 ff.) diejenige Tradition, welche die Sphinx durch die Waffen des Oedi-
pus besiegt werden, und dann auch durch die Hand des Oedipus umkommen lässt;
während eine ganze Reihe anderer Denkmale die Sphinx im Kampfe mit theba-
nischen Jünglingen, die sich an ihr versuchen, als Ueberwinderin derselben dar-
stellt. Die verhältnissmässig grössere Zahl dieser bildlichen Darstellungen der
Sphinx kann eben den wiederholten Beweis liefern, wie allerdings sich die
griechische Kunst in der Darstellung derartiger Gebilde gefiel, die dem griechi-
schen Boden selbst keineswegs entstammen, wohl aber hier in ihrer oft wun-
derlichen und seltsamen Zusammensetzung aus Menschen- und Thiertheilen eine
Umgestaltung erhielten, wie sie der dem Hellenen innewohnende Kunstsinn und
ein ihm angebornes Gefühl allerdings erheischte, welches auch diese oftmals
gräulichen Bildungen orientalischer Phantasie auf ein gewisses, dem rein Mensch-
lichen sie näher bringendes, zu ihren Götteridealen passendes Maass zurückzu-
führen verstand, ohne dabei den Grundtypus völlig zu verwischen oder die dem
Ganzen zu Grunde liegende Idee völlig aufzugeben. Wie diese freilich bei der
Sphinx, die Ilerodolus (IV, 79) schon mit den Greifen zusammenstellt, aufzu-
fassen sey, ist keine leichte Sache, zumal da eine tiefere, symbolische Bedeu-
tung, welche zu Grunde liegt, doch kaum in Abrede gestellt werden kann,
selbst dann, wenn bei der weiteren Ausbildung Manches der Kunst und künst-
lerischen Rücksichten zugeschrieben werden dürfte. Der Verf. dieser Schrift
ist freilich geneigt anzunehmen (S. 27), dass der letzte Grund und die innerste
Bedeutung dieser monströsen Bildung den Hellenen eben so dunkel geblieben,
wie sie es jetzt für uns sei. Und allerdings hat der Verf. Recht, wenn wir auf
Das einen Blick werfen, was in der zu dieser Stelle gehörigen Note von den
bisherigen Versuchen, diese tiefere Bedeutung zu ermitteln, angeführt ist, oder