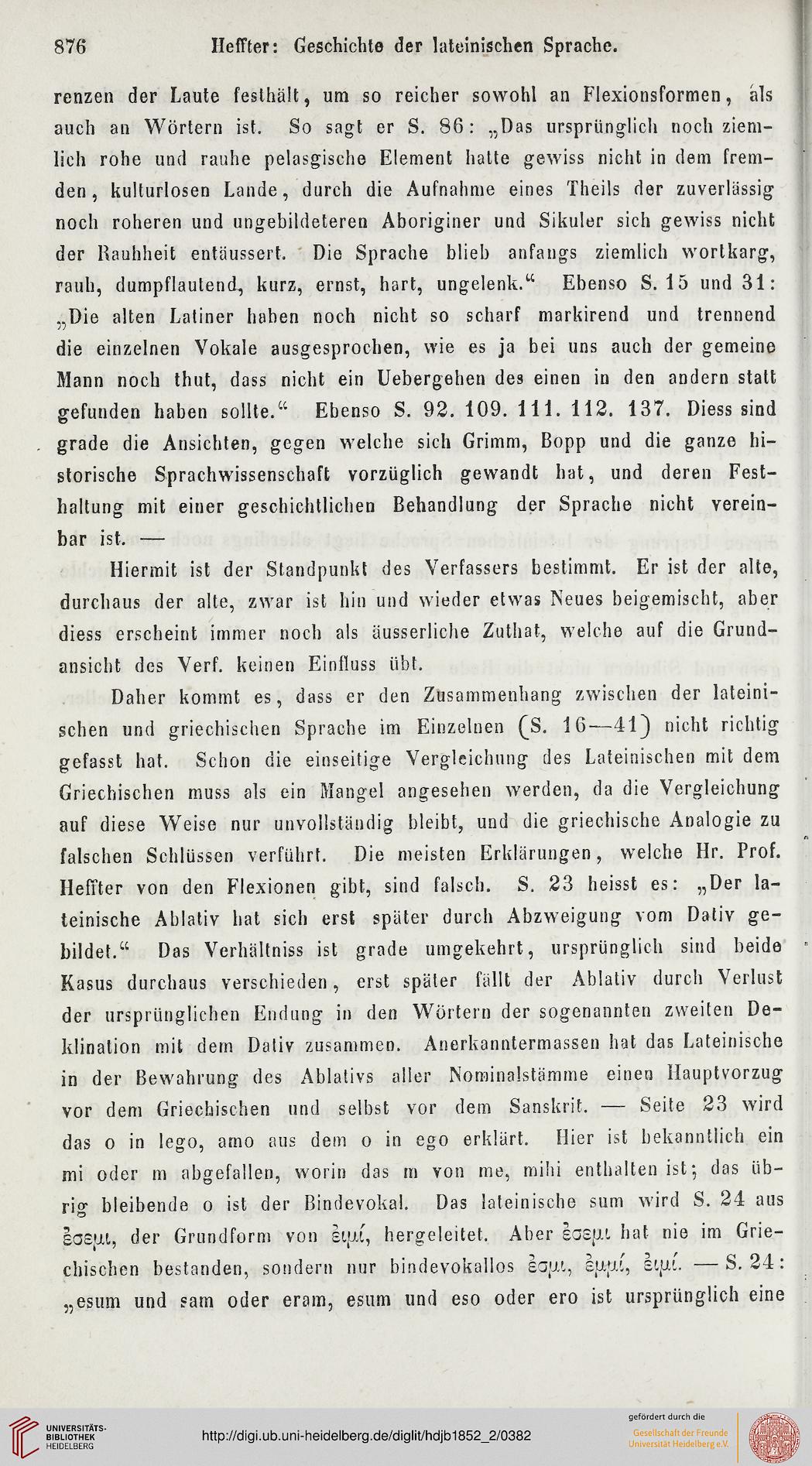876
Heffter: Geschichte der lateinischen Sprache.
renzen der Laute festhält, um so reicher sowohl an Flexionsformen, als
auch an Wörtern ist. So sagt er S. 86: „Das ursprünglich noch ziem-
lich rohe und rauhe pelasgische Element hatte gewiss nicht in dem frem-
den, kulturlosen Lande, durch die Aufnahme eines Theils der zuverlässig
noch roheren und ungebildeteren Aboriginer und Sikuler sich gewiss nicht
der Rauhheit entäussert. Die Sprache blieb anfangs ziemlich wortkarg,
rauh, dumpflautend, kurz, ernst, hart, ungelenk.“ Ebenso S. 15 und 31:
„Die alten Latiner haben noch nicht so scharf markirend und trennend
die einzelnen Vokale ausgesprochen, wie es ja bei uns auch der gemeine
Mann noch thut, dass nicht ein Uebergehen des einen in den andern statt
gefunden haben sollte.“ Ebenso S. 92. 109. 111. 112. 137. Diess sind
grade die Ansichten, gegen welche sich Grimm, Bopp und die ganze hi-
storische Sprachwissenschaft vorzüglich gewandt hat, und deren Fest-
haltung mit einer geschichtlichen Behandlung der Sprache nicht verein-
bar ist. —
Hiermit ist der Standpunkt des Verfassers bestimmt. Er ist der alte,
durchaus der alte, zwar ist hin und wieder etwas Neues beigemischt, aber
diess erscheint immer noch als äusserliche Zuthat, welche auf die Grund-
ansicht des Verf. keinen Einfluss übt.
Daher kommt es, dass er den Zusammenhang zwischen der lateini-
schen und griechischen Sprache im Einzelnen (^S. 16—41} nicht richtig
gefasst hat. Schon die einseitige Vergleichung des Lateinischen mit dem
Griechischen muss als ein Mangel angesehen werden, da die Vergleichung
auf diese Weise nur unvollständig bleibt, und die griechische Analogie zu
falschen Schlüssen verführt. Die meisten Erklärungen, welche Hr. Prof.
Heffter von den Flexionen gibt, sind falsch. S. 23 heisst es: „Der la-
teinische Ablativ hat sich erst später durch Abzweigung vom Dativ ge-
bildet.“ Das Verhältniss ist grade umgekehrt, ursprünglich sind beide
Kasus durchaus verschieden, erst später fällt der Ablativ durch Verlust
der ursprünglichen Endung in den Wörtern der sogenannten zweiten De-
klination mit dem Dativ zusammen. Anerkanntermassen hat das Lateinische
in der Bewahrung des Ablativs aller Nominalstämme einen Hauptvorzug
vor dem Griechischen und selbst vor dem Sanskrit. — Seite 23 wird
das o in lego, amo aus dem o in ego erklärt. Hier ist bekanntlich ein
mi oder m abgefallen, worin das m von nie, mihi enthalten ist; das üb-
rig bleibende o ist der Bindevokal. Das lateinische sum wird S. 24 aus
εσεμί, der Grundform von έΐμί, hergeleitet. Aber έσεμί hat nie im Grie-
chischen bestanden, sondern nur bindevokallos έσμι, εμμί, εψΛ. —S. 24:
„esum und sam oder eram, esum und eso oder ero ist ursprünglich eine
Heffter: Geschichte der lateinischen Sprache.
renzen der Laute festhält, um so reicher sowohl an Flexionsformen, als
auch an Wörtern ist. So sagt er S. 86: „Das ursprünglich noch ziem-
lich rohe und rauhe pelasgische Element hatte gewiss nicht in dem frem-
den, kulturlosen Lande, durch die Aufnahme eines Theils der zuverlässig
noch roheren und ungebildeteren Aboriginer und Sikuler sich gewiss nicht
der Rauhheit entäussert. Die Sprache blieb anfangs ziemlich wortkarg,
rauh, dumpflautend, kurz, ernst, hart, ungelenk.“ Ebenso S. 15 und 31:
„Die alten Latiner haben noch nicht so scharf markirend und trennend
die einzelnen Vokale ausgesprochen, wie es ja bei uns auch der gemeine
Mann noch thut, dass nicht ein Uebergehen des einen in den andern statt
gefunden haben sollte.“ Ebenso S. 92. 109. 111. 112. 137. Diess sind
grade die Ansichten, gegen welche sich Grimm, Bopp und die ganze hi-
storische Sprachwissenschaft vorzüglich gewandt hat, und deren Fest-
haltung mit einer geschichtlichen Behandlung der Sprache nicht verein-
bar ist. —
Hiermit ist der Standpunkt des Verfassers bestimmt. Er ist der alte,
durchaus der alte, zwar ist hin und wieder etwas Neues beigemischt, aber
diess erscheint immer noch als äusserliche Zuthat, welche auf die Grund-
ansicht des Verf. keinen Einfluss übt.
Daher kommt es, dass er den Zusammenhang zwischen der lateini-
schen und griechischen Sprache im Einzelnen (^S. 16—41} nicht richtig
gefasst hat. Schon die einseitige Vergleichung des Lateinischen mit dem
Griechischen muss als ein Mangel angesehen werden, da die Vergleichung
auf diese Weise nur unvollständig bleibt, und die griechische Analogie zu
falschen Schlüssen verführt. Die meisten Erklärungen, welche Hr. Prof.
Heffter von den Flexionen gibt, sind falsch. S. 23 heisst es: „Der la-
teinische Ablativ hat sich erst später durch Abzweigung vom Dativ ge-
bildet.“ Das Verhältniss ist grade umgekehrt, ursprünglich sind beide
Kasus durchaus verschieden, erst später fällt der Ablativ durch Verlust
der ursprünglichen Endung in den Wörtern der sogenannten zweiten De-
klination mit dem Dativ zusammen. Anerkanntermassen hat das Lateinische
in der Bewahrung des Ablativs aller Nominalstämme einen Hauptvorzug
vor dem Griechischen und selbst vor dem Sanskrit. — Seite 23 wird
das o in lego, amo aus dem o in ego erklärt. Hier ist bekanntlich ein
mi oder m abgefallen, worin das m von nie, mihi enthalten ist; das üb-
rig bleibende o ist der Bindevokal. Das lateinische sum wird S. 24 aus
εσεμί, der Grundform von έΐμί, hergeleitet. Aber έσεμί hat nie im Grie-
chischen bestanden, sondern nur bindevokallos έσμι, εμμί, εψΛ. —S. 24:
„esum und sam oder eram, esum und eso oder ero ist ursprünglich eine