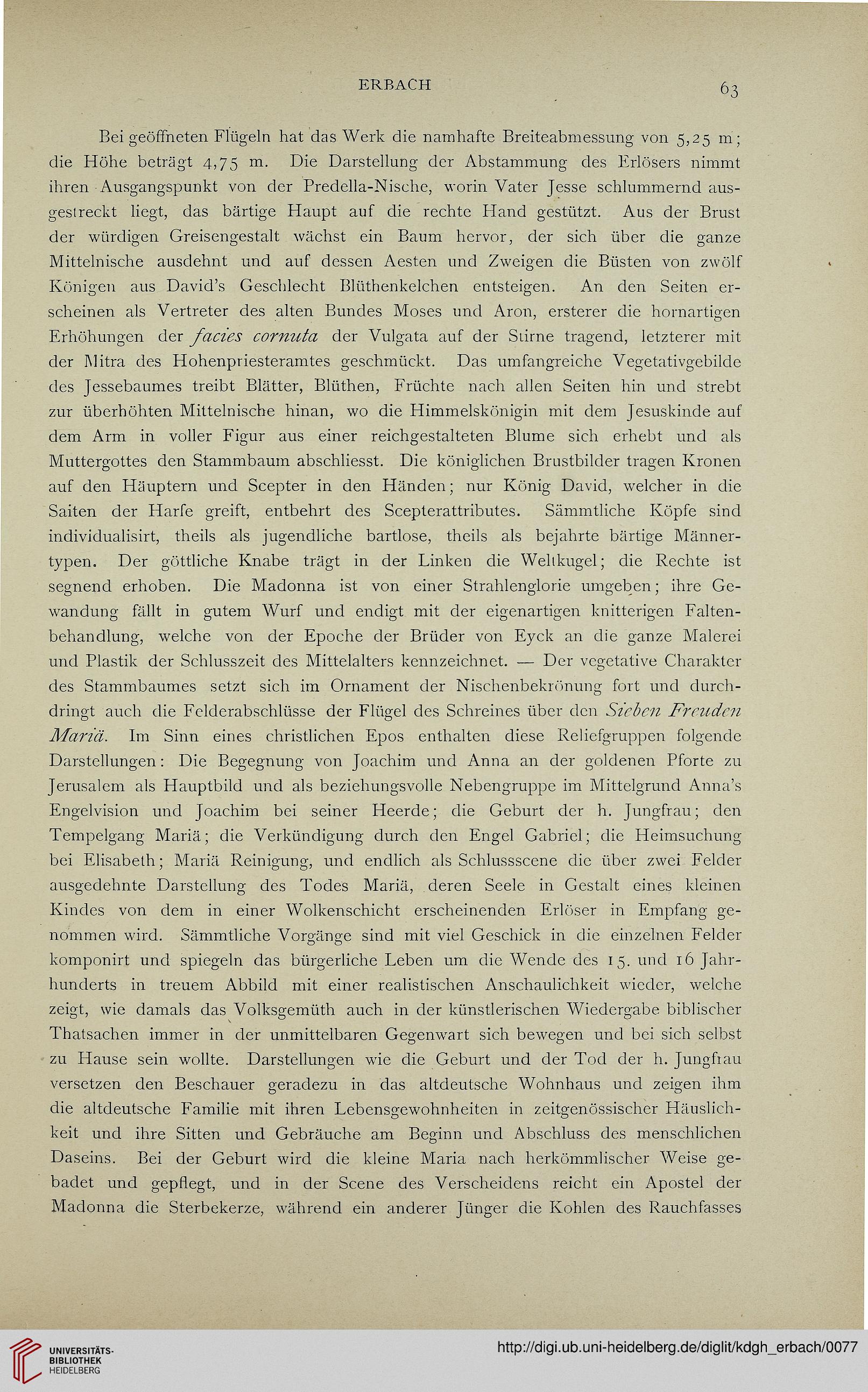ERBACH
63
Bei geöffneten Flügeln hat das Werk die namhafte Breiteabmessung von 5,25 m;
die Höhe beträgt 4,75 m. Die Darstellung der Abstammung des Erlösers nimmt
ihren Ausgangspunkt von der Predella-Nische, worin Vater Jesse schlummernd aus-
gestreckt liegt, das bärtige Haupt auf die rechte Hand gestützt. Aus der Brust
der würdigen Greisengestalt wächst ein Baum hervor, der sich über die ganze
Mittelnische ausdehnt und auf dessen Aesten und Zweigen die Büsten von zwölf
Königen aus David's Geschlecht Blüthenkelchen entsteigen. An den Seiten er-
scheinen als Vertreter des alten Bundes Moses und Aron, ersterer die hornartigen
' O
Erhöhungen der facies cornuta der Vulgata auf der Slirne tragend, letzterer mit
der Mitra des Hohenpriesteramtes geschmückt. Das umfangreiche Vegetativgebilde
des Jessebaumes treibt Blätter, Blüthen, Früchte nach allen Seiten hin und strebt
zur überhöhten Mittelnische hinan, wo die Himmelskönigin mit dem Jesuskinde auf
dem Arm in voller Figur aus einer reichgestalteten Blume sich erhebt und als
Muttergottes den Stammbaum abschliesst. Die königlichen Brustbilder tragen Kronen
auf den Häuptern und Scepter in den Händen; nur König David, welcher in die
Saiten der Harfe greift, entbehrt des Scepterattributes. Sämmtliche Köpfe sind
individualisirt, theils als jugendliche bartlose, theils als bejahrte bärtige Männer-
typen. Der göttliche Knabe trägt in der Linken die Wellkugel; die Rechte ist
segnend erhoben. Die Madonna ist von einer Strahlenglorie umgeben; ihre Ge-
wandung fällt in gutem Wurf und endigt mit der eigenartigen knitterigen Falten-
behandlung, welche von der Epoche der Brüder von Eyck an die ganze Malerei
und Plastik der Schlusszeit des Mittelalters kennzeichnet. — Der vegetative Charakter
des Stammbaumes setzt sich im Ornament der Nischenbekrönung fort und durch-
dringt auch die Felderabschlüsse der Flügel des Schreines über den Sieben Freuden
Maria. Im Sinn eines christlichen Epos enthalten diese Reliefgruppen folgende
Darstellungen: Die Begegnung von Joachim und Anna an der goldenen Pforte zu
Jerusalem als Hauptbild und als beziehungsvolle Nebengruppe im Mittelgrund Anna's
Engelvision und Joachim bei seiner Heerde; die Geburt der h. Jungfrau; den
Tempelgang Mariä; die Verkündigung durch den Engel Gabriel; die Heimsuchung
bei Elisabeth; Mariä Reinigung, und endlich als Schlussscene die über zwei Felder
ausgedehnte Darstellung des Todes Mariä, deren Seele in Gestalt eines kleinen
Kindes von dem in einer Wolkenschicht erscheinenden Erlöser in Empfang ge-
nommen wird. Sämmtliche Vorgänge sind mit viel Geschick in die einzelnen Felder
o o
komponirt und spiegeln das bürgerliche Leben um die Wende des 15. und 16 Jahr-
hunderts in treuem Abbild mit einer realistischen Anschaulichkeit wieder, welche
zeigt, wie damals das Volksgemüth auch in der künstlerischen Wiedergabe biblischer
Thatsachen immer in der unmittelbaren Gegenwart sich bewegen und bei sich selbst
zu Hause sein wollte. Darstellungen wie die Geburt und der Tod der h. Jungfiau
versetzen den Beschauer geradezu in das altdeutsche Wohnhaus und zeigen ihm
o o
die altdeutsche Familie mit ihren Lebensgewohnheiten in zeitgenössischer Häuslich-
keit und ihre Sitten und Gebräuche am Beginn und Abschluss des menschlichen
Daseins. Bei der Geburt wird die kleine Maria nach herkömmlischer Weise ge-
badet und gepflegt, und in der Scene des Verscheiclens reicht ein Apostel der
Madonna die Sterbekerze, während ein anderer Jünger die Kohlen des Rauchfasses
63
Bei geöffneten Flügeln hat das Werk die namhafte Breiteabmessung von 5,25 m;
die Höhe beträgt 4,75 m. Die Darstellung der Abstammung des Erlösers nimmt
ihren Ausgangspunkt von der Predella-Nische, worin Vater Jesse schlummernd aus-
gestreckt liegt, das bärtige Haupt auf die rechte Hand gestützt. Aus der Brust
der würdigen Greisengestalt wächst ein Baum hervor, der sich über die ganze
Mittelnische ausdehnt und auf dessen Aesten und Zweigen die Büsten von zwölf
Königen aus David's Geschlecht Blüthenkelchen entsteigen. An den Seiten er-
scheinen als Vertreter des alten Bundes Moses und Aron, ersterer die hornartigen
' O
Erhöhungen der facies cornuta der Vulgata auf der Slirne tragend, letzterer mit
der Mitra des Hohenpriesteramtes geschmückt. Das umfangreiche Vegetativgebilde
des Jessebaumes treibt Blätter, Blüthen, Früchte nach allen Seiten hin und strebt
zur überhöhten Mittelnische hinan, wo die Himmelskönigin mit dem Jesuskinde auf
dem Arm in voller Figur aus einer reichgestalteten Blume sich erhebt und als
Muttergottes den Stammbaum abschliesst. Die königlichen Brustbilder tragen Kronen
auf den Häuptern und Scepter in den Händen; nur König David, welcher in die
Saiten der Harfe greift, entbehrt des Scepterattributes. Sämmtliche Köpfe sind
individualisirt, theils als jugendliche bartlose, theils als bejahrte bärtige Männer-
typen. Der göttliche Knabe trägt in der Linken die Wellkugel; die Rechte ist
segnend erhoben. Die Madonna ist von einer Strahlenglorie umgeben; ihre Ge-
wandung fällt in gutem Wurf und endigt mit der eigenartigen knitterigen Falten-
behandlung, welche von der Epoche der Brüder von Eyck an die ganze Malerei
und Plastik der Schlusszeit des Mittelalters kennzeichnet. — Der vegetative Charakter
des Stammbaumes setzt sich im Ornament der Nischenbekrönung fort und durch-
dringt auch die Felderabschlüsse der Flügel des Schreines über den Sieben Freuden
Maria. Im Sinn eines christlichen Epos enthalten diese Reliefgruppen folgende
Darstellungen: Die Begegnung von Joachim und Anna an der goldenen Pforte zu
Jerusalem als Hauptbild und als beziehungsvolle Nebengruppe im Mittelgrund Anna's
Engelvision und Joachim bei seiner Heerde; die Geburt der h. Jungfrau; den
Tempelgang Mariä; die Verkündigung durch den Engel Gabriel; die Heimsuchung
bei Elisabeth; Mariä Reinigung, und endlich als Schlussscene die über zwei Felder
ausgedehnte Darstellung des Todes Mariä, deren Seele in Gestalt eines kleinen
Kindes von dem in einer Wolkenschicht erscheinenden Erlöser in Empfang ge-
nommen wird. Sämmtliche Vorgänge sind mit viel Geschick in die einzelnen Felder
o o
komponirt und spiegeln das bürgerliche Leben um die Wende des 15. und 16 Jahr-
hunderts in treuem Abbild mit einer realistischen Anschaulichkeit wieder, welche
zeigt, wie damals das Volksgemüth auch in der künstlerischen Wiedergabe biblischer
Thatsachen immer in der unmittelbaren Gegenwart sich bewegen und bei sich selbst
zu Hause sein wollte. Darstellungen wie die Geburt und der Tod der h. Jungfiau
versetzen den Beschauer geradezu in das altdeutsche Wohnhaus und zeigen ihm
o o
die altdeutsche Familie mit ihren Lebensgewohnheiten in zeitgenössischer Häuslich-
keit und ihre Sitten und Gebräuche am Beginn und Abschluss des menschlichen
Daseins. Bei der Geburt wird die kleine Maria nach herkömmlischer Weise ge-
badet und gepflegt, und in der Scene des Verscheiclens reicht ein Apostel der
Madonna die Sterbekerze, während ein anderer Jünger die Kohlen des Rauchfasses