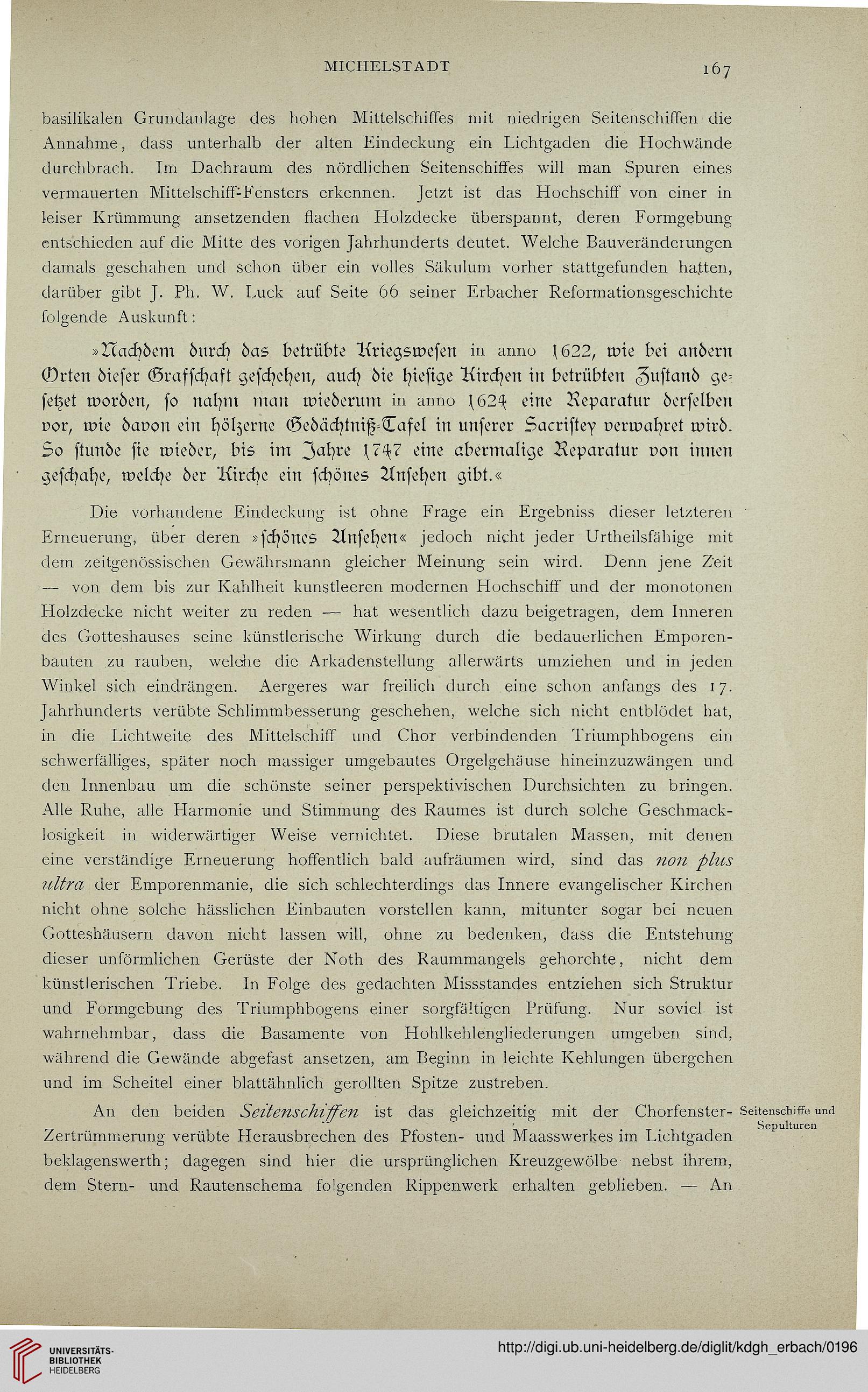MICHELSTADT
basilikalen Grundanlage des hohen Mittelschiffes mit niedrigen Seitenschiffen die
Annahme, dass unterhalb der alten Eindeckung ein Lichtgaden die Hochwände
durchbrach. Im Dachraum des nördlichen Seitenschiffes will man Spuren eines
vermauerten Mittelschiff-Fensters erkennen. Jetzt ist das Hochschiff von einer in
leiser Krümmung ansetzenden flachen Holzdecke überspannt, deren Formgebung
entschieden auf die Mitte des vorigen Jahrhunderts deutet. Welche Bauveränderungen
damals geschahen und schon über ein volles Säkulum vorher stattgefunden hatten,
darüber gibt J. Ph. W. Luck auf Seite 66 seiner Erbacher Reformationsgeschichte
folgende Auskunft:
»Xlacböem öurd) 6as betrübte "Kriegsroefen in anno \622, n?ie bei anöern
(Drten öiefer (Braffcfyaft gefcfyefyen, auefy 6ie fyieftge Kirchen in betrübten «^uftanö ge-
fettet tuoröen, fo nahm man tüieöerum in anno \62<{ eine Reparatur öerfelben
por, mie öapon ein fyöljerne (5eöäcfytnif=Cafel in unferer Sacriftey perroafyret tuirö.
So ftunöe fie roieber, bis im Ja^re eine abermalige Reparatur t>on innen
gefcfyafye, tüelcfye 6er Kircfye ein fcfyönes 2tnfefyen gibt.«
Die vorhandene Eindeckung ist ohne Frage ein Ergebniss dieser letzteren
Erneuerung, über deren »fcfjöncs 2tnfel)en« jedoch nicht jeder Urtheilsfähige mit
dem zeitgenössischen Gewährsmann gleicher Meinung sein wird. Denn jene Z'eit
— von dem bis zur Kahlheit kunstleeren modernen Hochschiff und der monotonen
Holzdecke nicht weiter zu reden — hat wesentlich dazu beigetragen, dem Inneren
des Gotteshauses seine künstlerische Wirkung durch die bedauerlichen Emporen-
bauten zu rauben, welche die Arkadenstellung allerwärts umziehen und in jeden
Winkel sich eindrängen. Aergeres war freilich durch eine schon anfangs des 17.
Jahrhunderts verübte Schlimmbesserurig geschehen, welche sich nicht entblödet hat,
in die Lichtweite des Mittelschiff und Chor verbindenden Triumphbogens ein
schwerfälliges, später noch massiger umgebautes Orgelgehäuse hineinzuzwängen und
den Innenbau um die schönste seiner perspektivischen Durchsichten zu bringen.
Alle Ruhe, alle Harmonie und Stimmung des Raumes ist durch solche Geschmack-
losigkeit in widerwärtiger Weise vernichtet. Diese brutalen Massen, mit denen
eine verständige Erneuerung hoffentlich bald aufräumen wird, sind das non plus
ultra der Emporenmanie, die sich schlechterdings das Innere evangelischer Kirchen
nicht ohne solche hässlichen Einbauten vorstellen kann, mitunter sogar bei neuen
Gotteshäusern davon nicht lassen will, ohne zu bedenken, dass die Entstehung
dieser unförmlichen Gerüste der Noth des Raummangels gehorchte, nicht dem
künstlerischen Triebe. In Folge des gedachten Missstandes entziehen sich Struktur
und Formgebung des Triumphbogens einer sorgfältigen Prüfung. Nur soviel ist
wahrnehmbar, dass die Basamente von Hohlkehlengliederungen umgeben sind,
während die Gewände abgefast ansetzen, am Beginn in leichte Kehlungen übergehen
und im Scheitel einer blattähnlich gerollten Spitze zustreben.
An den beiden Seitenschiffen ist das gleichzeitig mit der Chorfenster- Seitenschiffe und
" • Sepulturen
Zertrümmerung verübte Herausbrechen des Pfosten- und Maasswerkes im Lichtgaden
beklagenswerth; dagegen sind hier die ursprünglichen Kreuzgewölbe nebst ihrem,
dem Stern- und Rautenschema folgenden Rippenwerk erhalten geblieben. — An
basilikalen Grundanlage des hohen Mittelschiffes mit niedrigen Seitenschiffen die
Annahme, dass unterhalb der alten Eindeckung ein Lichtgaden die Hochwände
durchbrach. Im Dachraum des nördlichen Seitenschiffes will man Spuren eines
vermauerten Mittelschiff-Fensters erkennen. Jetzt ist das Hochschiff von einer in
leiser Krümmung ansetzenden flachen Holzdecke überspannt, deren Formgebung
entschieden auf die Mitte des vorigen Jahrhunderts deutet. Welche Bauveränderungen
damals geschahen und schon über ein volles Säkulum vorher stattgefunden hatten,
darüber gibt J. Ph. W. Luck auf Seite 66 seiner Erbacher Reformationsgeschichte
folgende Auskunft:
»Xlacböem öurd) 6as betrübte "Kriegsroefen in anno \622, n?ie bei anöern
(Drten öiefer (Braffcfyaft gefcfyefyen, auefy 6ie fyieftge Kirchen in betrübten «^uftanö ge-
fettet tuoröen, fo nahm man tüieöerum in anno \62<{ eine Reparatur öerfelben
por, mie öapon ein fyöljerne (5eöäcfytnif=Cafel in unferer Sacriftey perroafyret tuirö.
So ftunöe fie roieber, bis im Ja^re eine abermalige Reparatur t>on innen
gefcfyafye, tüelcfye 6er Kircfye ein fcfyönes 2tnfefyen gibt.«
Die vorhandene Eindeckung ist ohne Frage ein Ergebniss dieser letzteren
Erneuerung, über deren »fcfjöncs 2tnfel)en« jedoch nicht jeder Urtheilsfähige mit
dem zeitgenössischen Gewährsmann gleicher Meinung sein wird. Denn jene Z'eit
— von dem bis zur Kahlheit kunstleeren modernen Hochschiff und der monotonen
Holzdecke nicht weiter zu reden — hat wesentlich dazu beigetragen, dem Inneren
des Gotteshauses seine künstlerische Wirkung durch die bedauerlichen Emporen-
bauten zu rauben, welche die Arkadenstellung allerwärts umziehen und in jeden
Winkel sich eindrängen. Aergeres war freilich durch eine schon anfangs des 17.
Jahrhunderts verübte Schlimmbesserurig geschehen, welche sich nicht entblödet hat,
in die Lichtweite des Mittelschiff und Chor verbindenden Triumphbogens ein
schwerfälliges, später noch massiger umgebautes Orgelgehäuse hineinzuzwängen und
den Innenbau um die schönste seiner perspektivischen Durchsichten zu bringen.
Alle Ruhe, alle Harmonie und Stimmung des Raumes ist durch solche Geschmack-
losigkeit in widerwärtiger Weise vernichtet. Diese brutalen Massen, mit denen
eine verständige Erneuerung hoffentlich bald aufräumen wird, sind das non plus
ultra der Emporenmanie, die sich schlechterdings das Innere evangelischer Kirchen
nicht ohne solche hässlichen Einbauten vorstellen kann, mitunter sogar bei neuen
Gotteshäusern davon nicht lassen will, ohne zu bedenken, dass die Entstehung
dieser unförmlichen Gerüste der Noth des Raummangels gehorchte, nicht dem
künstlerischen Triebe. In Folge des gedachten Missstandes entziehen sich Struktur
und Formgebung des Triumphbogens einer sorgfältigen Prüfung. Nur soviel ist
wahrnehmbar, dass die Basamente von Hohlkehlengliederungen umgeben sind,
während die Gewände abgefast ansetzen, am Beginn in leichte Kehlungen übergehen
und im Scheitel einer blattähnlich gerollten Spitze zustreben.
An den beiden Seitenschiffen ist das gleichzeitig mit der Chorfenster- Seitenschiffe und
" • Sepulturen
Zertrümmerung verübte Herausbrechen des Pfosten- und Maasswerkes im Lichtgaden
beklagenswerth; dagegen sind hier die ursprünglichen Kreuzgewölbe nebst ihrem,
dem Stern- und Rautenschema folgenden Rippenwerk erhalten geblieben. — An