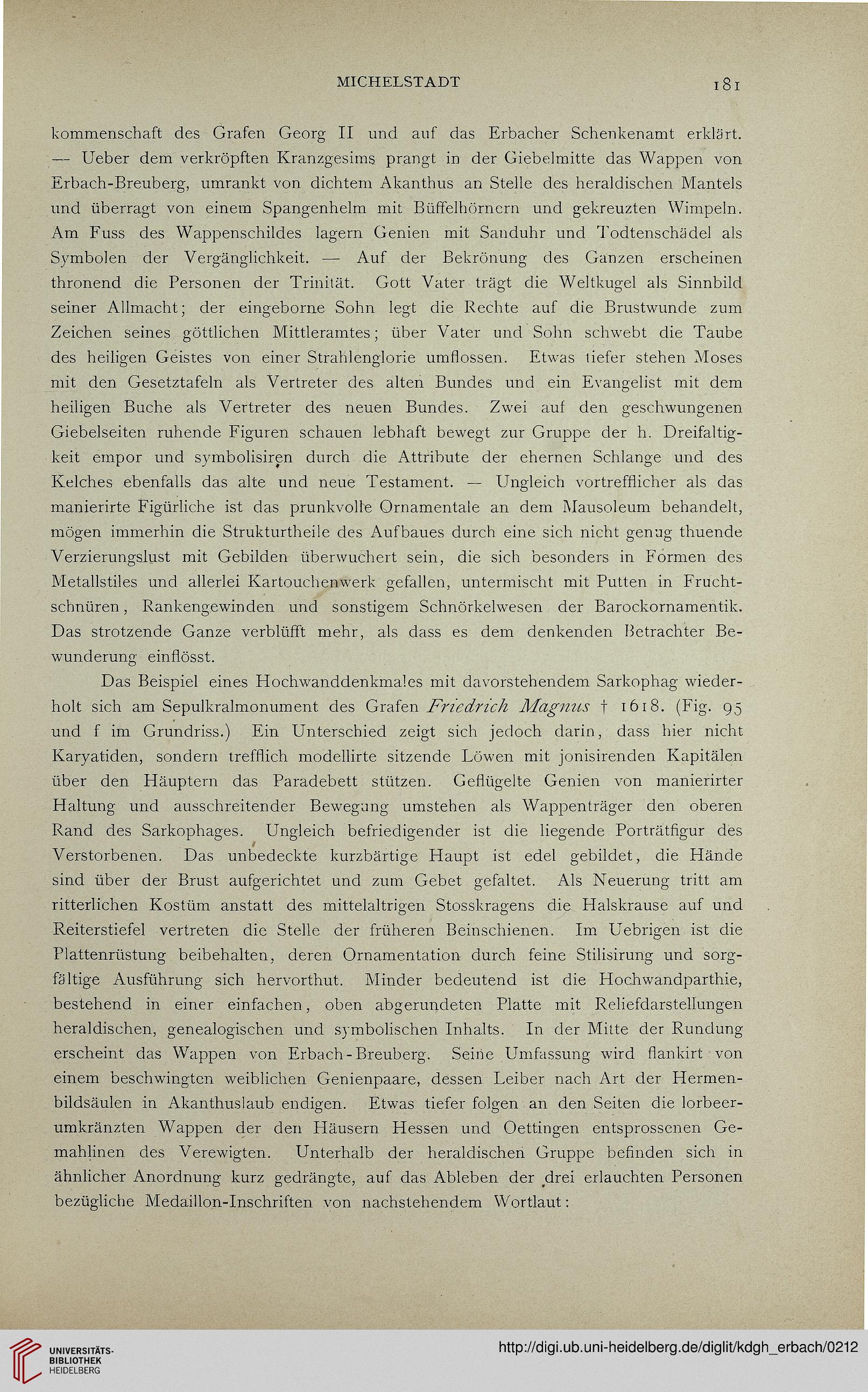MICHELSTADT
I 81
kommenschaft des Grafen Georg II und auf das Erbacher Schenkenamt erklärt.
— Ueber dem verkröpften Kranzgesims prangt in der Giebelmitte das Wappen von
Erbach-Breuberg, umrankt von dichtem Akanthus an Stelle des heraldischen Mantels
und überragt von einem Spangenhelm mit Büffelhörnern und gekreuzten Wimpeln.
Am Fuss des Wappenschildes lagern Genien mit Sanduhr und Todtenschädel als
Symbolen der Vergänglichkeit. — Auf der Bekrönung des Ganzen erscheinen
thronend die Personen der Trinität. Gott Vater trägt die Weltkugel als Sinnbild
seiner Allmacht; der eingeborne Sohn legt die Rechte auf die Brustwunde zum
Zeichen seines göttlichen Mittleramtes; über Vater und Sohn schwebt die Taube
des heiligen Geistes von einer Strahlemrlorie umflossen. Etwas liefer stehen Moses
o O
mit den Gesetztafeln als Vertreter des alten Bundes und ein Evangelist mit dem
heiligen Buche als Vertreter des neuen Bundes. Zwei auf den geschwungenen
Giebelseiten ruhende Figuren schauen lebhaft bewegt zur Gruppe der h. Dreifaltig-
keit empor und symbolisiren durch die Attribute der ehernen Schlange und des
Kelches ebenfalls das alte und neue Testament. — Ungleich vortrefflicher als das
manierirte Figürliche ist das prunkvolle Ornamentale an dem Mausoleum behandelt,
mögen immerhin die Strukturtheile des Aufbaues durch eine sich nicht genug thuende
Verzierungslust mit Gebilden überwuchert sein, die sich besonders in Formen des
Metallstiles und allerlei Kartouchenwerk gefallen, untermischt mit Putten in Frucht-
schnüren , Rankengewinden und sonstigem Schnörkelwesen der Barockornamentik.
Das strotzende Ganze verblüfft mehr, als dass es dem denkenden Betrachter Be-
wunderung einflösst.
Das Beispiel eines Hochwanddenkmales mit davorstehendem Sarkophag wieder-
holt sich am Sepulkralmonument des Grafen Friedrich Magnus f 1618. (Fig. 95
und f im Grundriss.) Ein Unterschied zeigt sich jedoch darin, dass hier nicht
Karyatiden, sondern trefflich modellirte sitzende Löwen mit jonisirenden Kapitalen
über den Häuptern das Paradebett stützen. Geflügelte Genien von manierirter
Haltung und ausschreitender Bewegung umstehen als Wappenträger den oberen
Rand des Sarkophages. Ungleich befriedigender ist die liegende Porträtfigur des
I
Verstorbenen. Das unbedeckte kurzbärtige Haupt ist edel gebildet, die Hände
sind über der Brust aufgerichtet und zum Gebet gefaltet. Als Neuerung tritt am
ritterlichen Kostüm anstatt des mittelaltrigen Stosskragens die Halskrause auf und
o o
Reiterstiefel vertreten die Stelle der früheren Beinschienen. Im Uebrigen ist die
Plattenrüstung beibehalten, deren Ornamentation durch feine Stilisirung und sorg-
fältige Ausführung sich hervorthut. Minder bedeutend ist die Hochwandparthie,
bestehend in einer einfachen, oben abgerundeten Platte mit Reliefdarstellungen
heraldischen, genealogischen und symbolischen Inhalts. In der Mitte der Rundung
erscheint das Wappen von Erbach-Breuberg. Seine Umfassung wird flankirt von
einem beschwingten weiblichen Genienpaare, dessen Leiber nach Art der Hermen-
bildsäulen in Akanthuslaub endigen. Etwas tiefer folgen an den Seiten die lorbeer-
umkränzten Wappen der den Häusern Hessen und Oettingen entsprossenen Ge-
mahlinen des Verewigten. Unterhalb der heraldischen Gruppe befinden sich in
ähnlicher Anordnung kurz gedrängte, auf das Ableben der drei erlauchten Personen
bezügliche Medaillon-Inschriften von nachstehendem Wortlaut:
I 81
kommenschaft des Grafen Georg II und auf das Erbacher Schenkenamt erklärt.
— Ueber dem verkröpften Kranzgesims prangt in der Giebelmitte das Wappen von
Erbach-Breuberg, umrankt von dichtem Akanthus an Stelle des heraldischen Mantels
und überragt von einem Spangenhelm mit Büffelhörnern und gekreuzten Wimpeln.
Am Fuss des Wappenschildes lagern Genien mit Sanduhr und Todtenschädel als
Symbolen der Vergänglichkeit. — Auf der Bekrönung des Ganzen erscheinen
thronend die Personen der Trinität. Gott Vater trägt die Weltkugel als Sinnbild
seiner Allmacht; der eingeborne Sohn legt die Rechte auf die Brustwunde zum
Zeichen seines göttlichen Mittleramtes; über Vater und Sohn schwebt die Taube
des heiligen Geistes von einer Strahlemrlorie umflossen. Etwas liefer stehen Moses
o O
mit den Gesetztafeln als Vertreter des alten Bundes und ein Evangelist mit dem
heiligen Buche als Vertreter des neuen Bundes. Zwei auf den geschwungenen
Giebelseiten ruhende Figuren schauen lebhaft bewegt zur Gruppe der h. Dreifaltig-
keit empor und symbolisiren durch die Attribute der ehernen Schlange und des
Kelches ebenfalls das alte und neue Testament. — Ungleich vortrefflicher als das
manierirte Figürliche ist das prunkvolle Ornamentale an dem Mausoleum behandelt,
mögen immerhin die Strukturtheile des Aufbaues durch eine sich nicht genug thuende
Verzierungslust mit Gebilden überwuchert sein, die sich besonders in Formen des
Metallstiles und allerlei Kartouchenwerk gefallen, untermischt mit Putten in Frucht-
schnüren , Rankengewinden und sonstigem Schnörkelwesen der Barockornamentik.
Das strotzende Ganze verblüfft mehr, als dass es dem denkenden Betrachter Be-
wunderung einflösst.
Das Beispiel eines Hochwanddenkmales mit davorstehendem Sarkophag wieder-
holt sich am Sepulkralmonument des Grafen Friedrich Magnus f 1618. (Fig. 95
und f im Grundriss.) Ein Unterschied zeigt sich jedoch darin, dass hier nicht
Karyatiden, sondern trefflich modellirte sitzende Löwen mit jonisirenden Kapitalen
über den Häuptern das Paradebett stützen. Geflügelte Genien von manierirter
Haltung und ausschreitender Bewegung umstehen als Wappenträger den oberen
Rand des Sarkophages. Ungleich befriedigender ist die liegende Porträtfigur des
I
Verstorbenen. Das unbedeckte kurzbärtige Haupt ist edel gebildet, die Hände
sind über der Brust aufgerichtet und zum Gebet gefaltet. Als Neuerung tritt am
ritterlichen Kostüm anstatt des mittelaltrigen Stosskragens die Halskrause auf und
o o
Reiterstiefel vertreten die Stelle der früheren Beinschienen. Im Uebrigen ist die
Plattenrüstung beibehalten, deren Ornamentation durch feine Stilisirung und sorg-
fältige Ausführung sich hervorthut. Minder bedeutend ist die Hochwandparthie,
bestehend in einer einfachen, oben abgerundeten Platte mit Reliefdarstellungen
heraldischen, genealogischen und symbolischen Inhalts. In der Mitte der Rundung
erscheint das Wappen von Erbach-Breuberg. Seine Umfassung wird flankirt von
einem beschwingten weiblichen Genienpaare, dessen Leiber nach Art der Hermen-
bildsäulen in Akanthuslaub endigen. Etwas tiefer folgen an den Seiten die lorbeer-
umkränzten Wappen der den Häusern Hessen und Oettingen entsprossenen Ge-
mahlinen des Verewigten. Unterhalb der heraldischen Gruppe befinden sich in
ähnlicher Anordnung kurz gedrängte, auf das Ableben der drei erlauchten Personen
bezügliche Medaillon-Inschriften von nachstehendem Wortlaut: