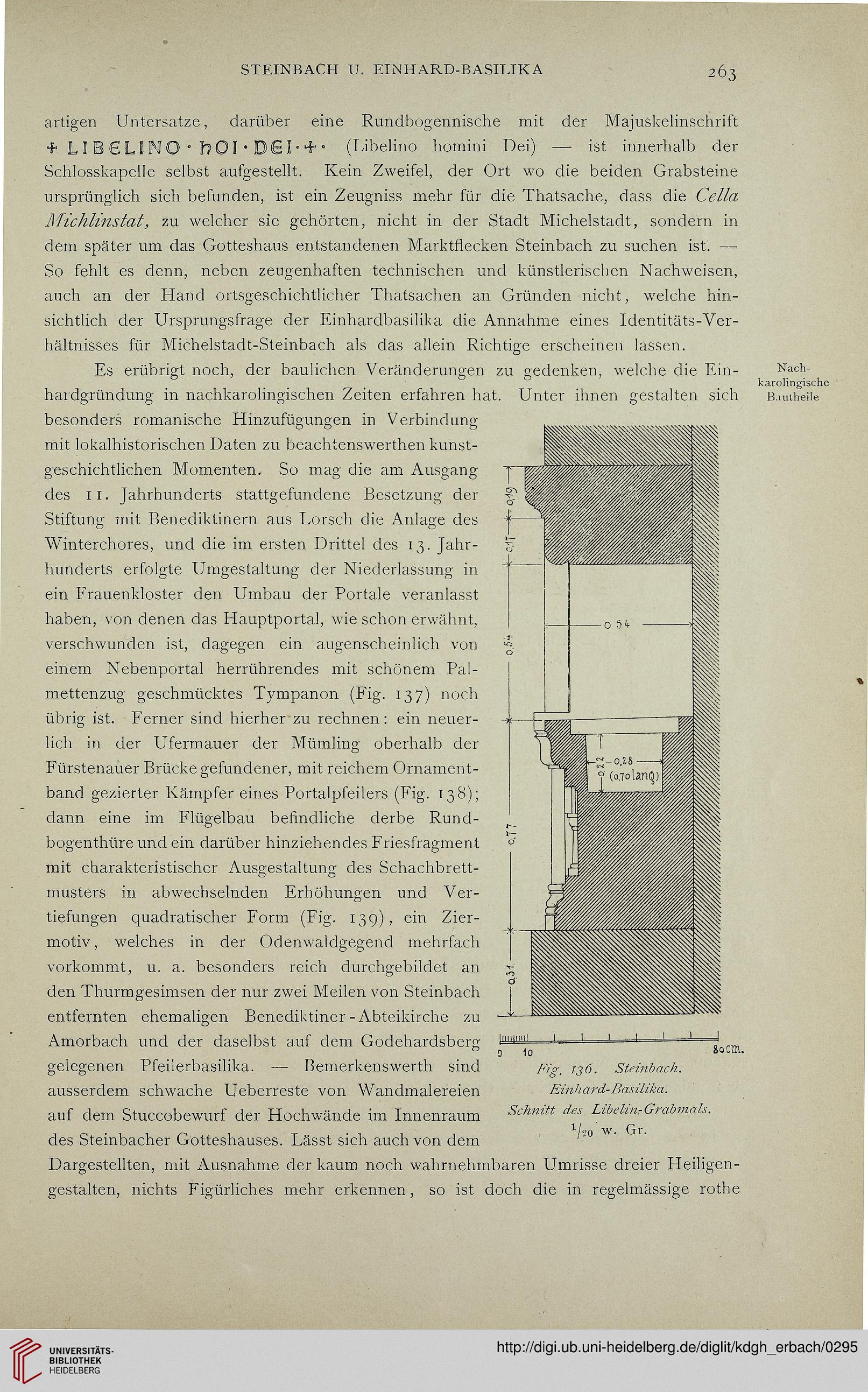STEINBACH U. EINHARD-BASILIKA
263
artigen Untersatze, darüber eine Rundbogennische mit der Majuskelinschrift
# LIB6LINO'f?QI*B<£I* + ° (Libelino homini Dei) —- ist innerhalb der
Schlosskapelle selbst aufgestellt. Kein Zweifel, der Ort wo die beiden Grabsteine
ursprünglich sich befunden, ist ein Zeugniss mehr für die Thatsache, dass die Cella
Michlinstat, zu welcher sie gehörten, nicht in der Stadt Michelstadt, sondern in
dem später um das Gotteshaus entstandenen Marktflecken Steinbach zu suchen ist. —
So fehlt es denn, neben zeugenhaften technischen und künstlerischen Nachweisen,
auch an der Hand ortsgeschichtlicher Thatsachen an Gründen nicht, welche hin-
sichtlich der Ursprungs frage der Einhardbasilika die Annahme eines Identitäts-Ver-
hältnisses für Michelstadt-Steinbach als das allein Richtige erscheinen lassen.
Es erübrigt noch, der baulichen Veränderungen zu gedenken, welche die Ein-
hai dgründung in nachkarolingischen Zeiten erfahren hat. Unter ihnen gestalten sich
besonders romanische Hinzufügungen in Verbindung
mit lokalhistorischen Daten zu beachtenswerthen kunst-
geschichtlichen Momenten. So mag die am Ausgang
des 11. Jahrhunderts stattgefundene Besetzung der
Stiftung mit Benediktinern aus Lorsch die Anlage des
Winterchores, und die im ersten Drittel des 13. Jahr-
hunderts erfolgte Umgestaltung der Niederlassung in
ein Frauenkloster den Umbau der Portale veranlasst
haben, von denen das Hauptportal, wie schon erwähnt,
verschwunden ist, dagegen ein augenscheinlich von
einem Nebenportal herrührendes mit schönem Pal-
mettenzug geschmücktes Tympanon (Fig. 137) noch
übrig ist. Ferner sind hierher zu rechnen: ein neuer-
lich in der Ufermauer der Mümling oberhalb der
Fürstenauer Brücke gefundener, mit reichem Ornament-
band gezierter Kämpfer eines Portalpfeilers (Fig. 138);
dann eine im Flügelbau befindliche derbe Rund-
bogenthüre und ein darüber hinziehendes Friesfragment
mit charakteristischer Ausgestaltung des Schachbrett-
musters in abwechselnden Erhöhungen und Ver-
tiefungen quadratischer Form (Fig. 139), ein Zier-
motiv, welches in der Odenwaldgegend mehrfach
vorkommt, u. a. besonders reich durchgebildet an
den Thurmgesimsen der nur zwei Meilen von Steinbach
entfernten ehemaligen Benediktiner-Abteikirche zu
Amorbach und der daselbst auf dem Godehardsberg
gelegenen Pfeilerbasilika. — Bemerkens werth sind
ausserdem schwache Ueberreste von Wandmalereien
auf dem Stuccobewurf der Hochwände im Innenraum
des Steinbacher Gotteshauses. Lässt sich auch von dem
Dargestellten, mit Ausnahme der kaum noch wahrnehmbaren Umrisse dreier Heiligen-
gestalten, nichts Figürliches mehr erkennen, so ist doch die in regelmässige rothe
eo
w. Gr.
Nach-
karolingische
B.iutheile
10 80cm.
Fig. 136. Steinbach.
Einhard-Basilika.
Schnitt des Libelin-Grabmals.
263
artigen Untersatze, darüber eine Rundbogennische mit der Majuskelinschrift
# LIB6LINO'f?QI*B<£I* + ° (Libelino homini Dei) —- ist innerhalb der
Schlosskapelle selbst aufgestellt. Kein Zweifel, der Ort wo die beiden Grabsteine
ursprünglich sich befunden, ist ein Zeugniss mehr für die Thatsache, dass die Cella
Michlinstat, zu welcher sie gehörten, nicht in der Stadt Michelstadt, sondern in
dem später um das Gotteshaus entstandenen Marktflecken Steinbach zu suchen ist. —
So fehlt es denn, neben zeugenhaften technischen und künstlerischen Nachweisen,
auch an der Hand ortsgeschichtlicher Thatsachen an Gründen nicht, welche hin-
sichtlich der Ursprungs frage der Einhardbasilika die Annahme eines Identitäts-Ver-
hältnisses für Michelstadt-Steinbach als das allein Richtige erscheinen lassen.
Es erübrigt noch, der baulichen Veränderungen zu gedenken, welche die Ein-
hai dgründung in nachkarolingischen Zeiten erfahren hat. Unter ihnen gestalten sich
besonders romanische Hinzufügungen in Verbindung
mit lokalhistorischen Daten zu beachtenswerthen kunst-
geschichtlichen Momenten. So mag die am Ausgang
des 11. Jahrhunderts stattgefundene Besetzung der
Stiftung mit Benediktinern aus Lorsch die Anlage des
Winterchores, und die im ersten Drittel des 13. Jahr-
hunderts erfolgte Umgestaltung der Niederlassung in
ein Frauenkloster den Umbau der Portale veranlasst
haben, von denen das Hauptportal, wie schon erwähnt,
verschwunden ist, dagegen ein augenscheinlich von
einem Nebenportal herrührendes mit schönem Pal-
mettenzug geschmücktes Tympanon (Fig. 137) noch
übrig ist. Ferner sind hierher zu rechnen: ein neuer-
lich in der Ufermauer der Mümling oberhalb der
Fürstenauer Brücke gefundener, mit reichem Ornament-
band gezierter Kämpfer eines Portalpfeilers (Fig. 138);
dann eine im Flügelbau befindliche derbe Rund-
bogenthüre und ein darüber hinziehendes Friesfragment
mit charakteristischer Ausgestaltung des Schachbrett-
musters in abwechselnden Erhöhungen und Ver-
tiefungen quadratischer Form (Fig. 139), ein Zier-
motiv, welches in der Odenwaldgegend mehrfach
vorkommt, u. a. besonders reich durchgebildet an
den Thurmgesimsen der nur zwei Meilen von Steinbach
entfernten ehemaligen Benediktiner-Abteikirche zu
Amorbach und der daselbst auf dem Godehardsberg
gelegenen Pfeilerbasilika. — Bemerkens werth sind
ausserdem schwache Ueberreste von Wandmalereien
auf dem Stuccobewurf der Hochwände im Innenraum
des Steinbacher Gotteshauses. Lässt sich auch von dem
Dargestellten, mit Ausnahme der kaum noch wahrnehmbaren Umrisse dreier Heiligen-
gestalten, nichts Figürliches mehr erkennen, so ist doch die in regelmässige rothe
eo
w. Gr.
Nach-
karolingische
B.iutheile
10 80cm.
Fig. 136. Steinbach.
Einhard-Basilika.
Schnitt des Libelin-Grabmals.