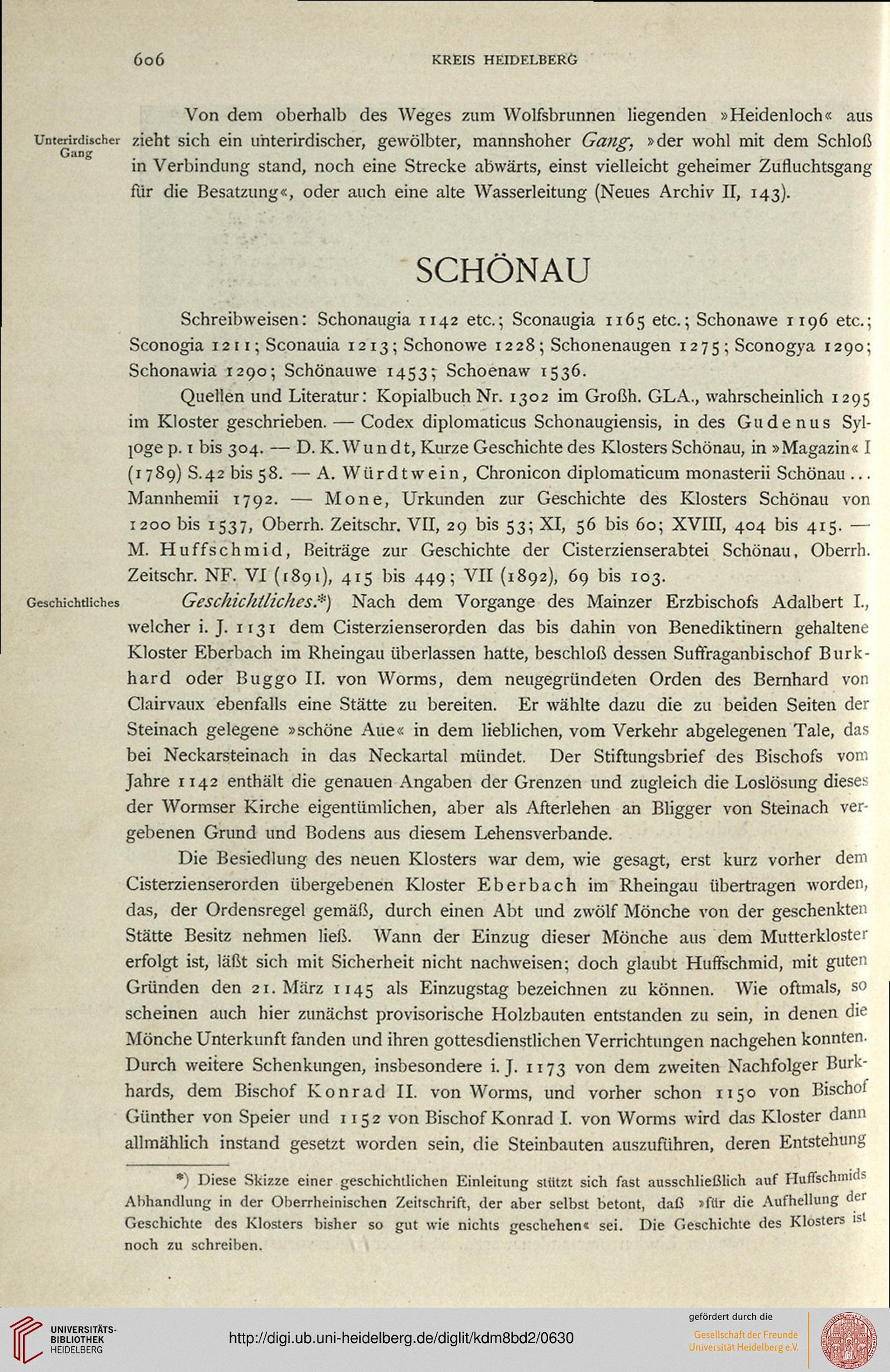6o6 KREIS HEIDELBERG
Von dem oberhalb des Weges zum Wolfsbrunnen liegenden »Heidenloch« aus
zieht sich ein unterirdischer, gewölbter, mannshoher Gang, »der wohl mit dem Schloß
in Verbindung stand, noch eine Strecke abwärts, einst vielleicht geheimer Zumichtsgang
für die Besatzung«, oder auch eine alte Wasserleitung (Neues Archiv II, 143).
SCHÖNAU
Schreibweisen: Schonaugia 1142 etc.; Sconaugia 1165 etc.; Schortawe 1196 etc.;
Sconogia 1211; Sconauia 1213 ; Schonowe 1228; Schonenaugen 1275;Sconogya 1290;
Scbonawia 1290; Schönauwe 1453; Schoenaw 1536.
Quellen und Literatur: Kopialbuch Nr. 1302 im Großh. GLA., wahrscheinlich 1295
im Kloster geschrieben. — Codex diplomaticus Schonaugiensis, in des Gudenus Syl-
joge p. 1 bis 304. — D. K.Wun dt, Kurze Geschichte des Klosters Schönau, in »Magazin« I
{1789) S.42 bis 58. — A. Würdtwein, Chronicon diplomaticum monasterii Schönau ...
Mannhemii 1792. — Mone, Urkunden zur Geschichte des Klosters Schönau von
1200 bis 1537, Oberrh. Zeitschr. VII, 29 bis 53; XI, 56 bis 60; XVIII, 404 bis 415. —
M. Huffschmid, Beiträge zur Geschichte der Cisterzienserabtei Schönau, Oberrh.
Zeitschr. NF. VI ([891), 415 bis 449; VII {1892), 69 bis 103.
5 Geschichtliches;') Nach dem Vorgange des Mainzer Erzbischofs Adalbert I.,
welcher i. J. 1131 dem Cisterzienserorden das bis dahin von Benediktinern gehaltene
Kloster Eberbach itn Rheingau überlassen hatte, beschloß dessen Suffraganbischof Burk-
hard oder Buggo II. von Worms, dem neugegründeten Orden des Bernhard von
Clairvaux ebenfalls eine Stätte zu bereiten. Er wählte dazu die zu beiden Seiten der
Steinach gelegene »schöne Aue« in dem lieblichen, vom Verkehr abgelegenen Tale, das
bei Neckarsteinach in das Neckartal mündet. Der Stiftungsbrief des Bischofs vom
Jahre 1142 enthält die genauen Angaben der Grenzen und zugleich die Loslösung dieses
der Wormser Kirche eigentümlichen, aber als Afterlehen an Bligger von Steinach ver-
gebenen Grund und Rodens aus diesem Lehensverbande.
Die Besiedlung des neuen Klosters war dem, wie gesagt, erst kurz vorher dem
Cisterzienserorden übergebenen Kloster Eb erb ach im Rheingau übertragen worden,
das, der Ordensregel gemäß, durch einen Abt und zwölf Mönche von der geschenkten
Stätte Besitz nehmen ließ. Wann der Einzug dieser Mönche aus dem Mutterklostei
erfolgt ist, läßt sich mit Sicherheit nicht nachweisen; doch glaubt Huffschmid, mit guten
Gründen den 21. März 1145 a's Einzugstag bezeichnen zu können. Wie oftmals, so
scheinen auch hier zunächst provisorische Holzbauten entstanden zu sein, in denen die
Mönche Unterkunft fanden und ihren gottesdienstlichen Verrichtungen nachgehen konnten.
Durch weitere Schenkungen, insbesondere i. J. 1173 von dem zweiten Nachfolger Burk-
hards, dem Bischof Konrad II. von Worms, und vorher schon 1150 von Bischof
Günther von Speier und 1152 von Bischof Konrad I. von Worms wird das Kloster dann
allmählich instand gesetzt worden sein, die Steinbauten auszuführen, deren Entstehung
*) Diese Skizze einer geschichtlichen Einleitung stützt sich fast ausschließlich auf Huffschmid
Abhandlung in der Oberrheinischen Zeilschrift, der aher selbst betont, daß >fur die Aufhellung der
Geschichte des Klosters hisher so gut wie nichts geschehen» sei. Die Geschichte des Klosters is
noch zu schreiben.
Von dem oberhalb des Weges zum Wolfsbrunnen liegenden »Heidenloch« aus
zieht sich ein unterirdischer, gewölbter, mannshoher Gang, »der wohl mit dem Schloß
in Verbindung stand, noch eine Strecke abwärts, einst vielleicht geheimer Zumichtsgang
für die Besatzung«, oder auch eine alte Wasserleitung (Neues Archiv II, 143).
SCHÖNAU
Schreibweisen: Schonaugia 1142 etc.; Sconaugia 1165 etc.; Schortawe 1196 etc.;
Sconogia 1211; Sconauia 1213 ; Schonowe 1228; Schonenaugen 1275;Sconogya 1290;
Scbonawia 1290; Schönauwe 1453; Schoenaw 1536.
Quellen und Literatur: Kopialbuch Nr. 1302 im Großh. GLA., wahrscheinlich 1295
im Kloster geschrieben. — Codex diplomaticus Schonaugiensis, in des Gudenus Syl-
joge p. 1 bis 304. — D. K.Wun dt, Kurze Geschichte des Klosters Schönau, in »Magazin« I
{1789) S.42 bis 58. — A. Würdtwein, Chronicon diplomaticum monasterii Schönau ...
Mannhemii 1792. — Mone, Urkunden zur Geschichte des Klosters Schönau von
1200 bis 1537, Oberrh. Zeitschr. VII, 29 bis 53; XI, 56 bis 60; XVIII, 404 bis 415. —
M. Huffschmid, Beiträge zur Geschichte der Cisterzienserabtei Schönau, Oberrh.
Zeitschr. NF. VI ([891), 415 bis 449; VII {1892), 69 bis 103.
5 Geschichtliches;') Nach dem Vorgange des Mainzer Erzbischofs Adalbert I.,
welcher i. J. 1131 dem Cisterzienserorden das bis dahin von Benediktinern gehaltene
Kloster Eberbach itn Rheingau überlassen hatte, beschloß dessen Suffraganbischof Burk-
hard oder Buggo II. von Worms, dem neugegründeten Orden des Bernhard von
Clairvaux ebenfalls eine Stätte zu bereiten. Er wählte dazu die zu beiden Seiten der
Steinach gelegene »schöne Aue« in dem lieblichen, vom Verkehr abgelegenen Tale, das
bei Neckarsteinach in das Neckartal mündet. Der Stiftungsbrief des Bischofs vom
Jahre 1142 enthält die genauen Angaben der Grenzen und zugleich die Loslösung dieses
der Wormser Kirche eigentümlichen, aber als Afterlehen an Bligger von Steinach ver-
gebenen Grund und Rodens aus diesem Lehensverbande.
Die Besiedlung des neuen Klosters war dem, wie gesagt, erst kurz vorher dem
Cisterzienserorden übergebenen Kloster Eb erb ach im Rheingau übertragen worden,
das, der Ordensregel gemäß, durch einen Abt und zwölf Mönche von der geschenkten
Stätte Besitz nehmen ließ. Wann der Einzug dieser Mönche aus dem Mutterklostei
erfolgt ist, läßt sich mit Sicherheit nicht nachweisen; doch glaubt Huffschmid, mit guten
Gründen den 21. März 1145 a's Einzugstag bezeichnen zu können. Wie oftmals, so
scheinen auch hier zunächst provisorische Holzbauten entstanden zu sein, in denen die
Mönche Unterkunft fanden und ihren gottesdienstlichen Verrichtungen nachgehen konnten.
Durch weitere Schenkungen, insbesondere i. J. 1173 von dem zweiten Nachfolger Burk-
hards, dem Bischof Konrad II. von Worms, und vorher schon 1150 von Bischof
Günther von Speier und 1152 von Bischof Konrad I. von Worms wird das Kloster dann
allmählich instand gesetzt worden sein, die Steinbauten auszuführen, deren Entstehung
*) Diese Skizze einer geschichtlichen Einleitung stützt sich fast ausschließlich auf Huffschmid
Abhandlung in der Oberrheinischen Zeilschrift, der aher selbst betont, daß >fur die Aufhellung der
Geschichte des Klosters hisher so gut wie nichts geschehen» sei. Die Geschichte des Klosters is
noch zu schreiben.