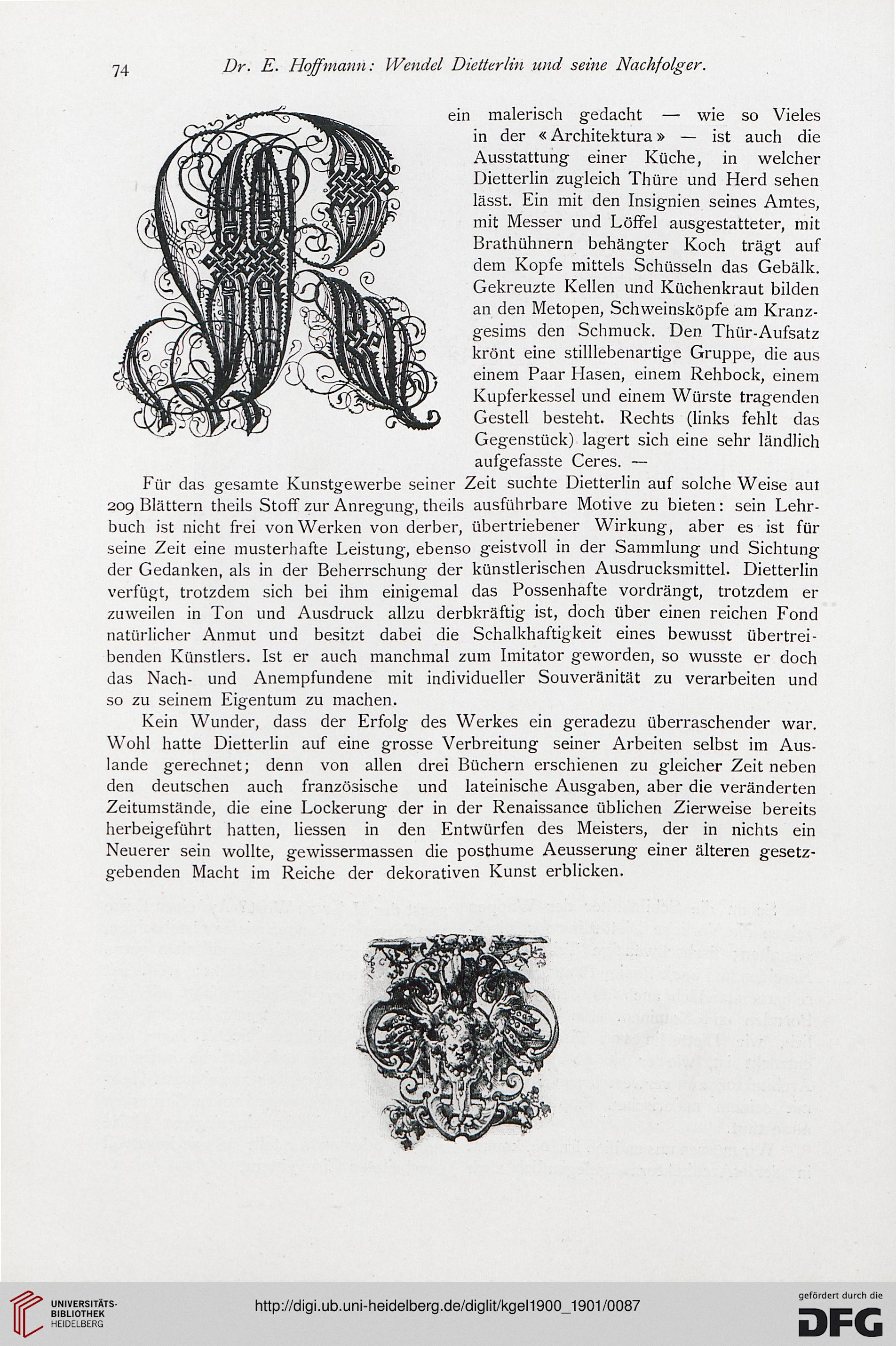Dr. E. Hoffmann: Wendel Dietterlin und seine Nachfolger.
ein malerisch gedacht — wie so Vieles
in der «Architektura» — ist auch die
Ausstattung einer Küche, in welcher
Dietterlin zugleich Thüre und Herd sehen
lässt. Ein mit den Insignien seines Amtes,
mit Messer und Löffel ausgestatteter, mit
Brathühnern behängter Koch trägt auf
dem Kopfe mittels Schüsseln das Gebälk.
Gekreuzte Kellen und Küchenkraut bilden
an den Metopen, Schweinsköpfe am Kranz-
gesims den Schmuck. Den Thür-Aufsatz
krönt eine stilllebenartige Gruppe, die aus
einem Paar Hasen, einem Rehbock, einem
Kupferkessel und einem Würste tragenden
Gestell besteht. Rechts (links fehlt das
Gegenstück) lagert sich eine sehr ländlich
aufgefasste Ceres. —
Für das gesamte Kunstgewerbe seiner Zeit suchte Dietterlin auf solche Weise aut
209 Blättern theils Stoff zur Anregung, theils ausführbare Motive zu bieten : sein Lehr-
buch ist nicht frei von Werken von derber, übertriebener Wirkung, aber es ist für
seine Zeit eine musterhafte Leistung, ebenso geistvoll in der Sammlung und Sichtung
der Gedanken, als in der Beherrschung der künstlerischen Ausdrucksmittel. Dietterlin
verfügt, trotzdem sich bei ihm einigemal das Possenhafte vordrängt, trotzdem er
zuweilen in Ton und Ausdruck allzu derbkräftig ist, doch über einen reichen Fond
natürlicher Anmut und besitzt dabei die Schalkhaftigkeit eines bewusst übertrei-
benden Künstlers. Ist er auch manchmal zum Imitator geworden, so wusste er doch
das Nach- und Anempfundene mit individueller Souveränität zu verarbeiten und
so zu seinem Eigentum zu machen.
Kein Wunder, dass der Erfolg des Werkes ein geradezu überraschender war.
Wohl hatte Dietterlin auf eine grosse Verbreitung seiner Arbeiten selbst im Aus-
lande gerechnet; denn von allen drei Büchern erschienen zu gleicher Zeit neben
den deutschen auch französische und lateinische Ausgaben, aber die veränderten
Zeitumstände, die eine Lockerung der in der Renaissance üblichen Zierweise bereits
herbeigeführt hatten, liessen in den Entwürfen des Meisters, der in nichts ein
Neuerer sein wollte, gewissermassen die posthume Aeusserung einer älteren gesetz-
gebenden Macht im Reiche der dekorativen Kunst erblicken.
ein malerisch gedacht — wie so Vieles
in der «Architektura» — ist auch die
Ausstattung einer Küche, in welcher
Dietterlin zugleich Thüre und Herd sehen
lässt. Ein mit den Insignien seines Amtes,
mit Messer und Löffel ausgestatteter, mit
Brathühnern behängter Koch trägt auf
dem Kopfe mittels Schüsseln das Gebälk.
Gekreuzte Kellen und Küchenkraut bilden
an den Metopen, Schweinsköpfe am Kranz-
gesims den Schmuck. Den Thür-Aufsatz
krönt eine stilllebenartige Gruppe, die aus
einem Paar Hasen, einem Rehbock, einem
Kupferkessel und einem Würste tragenden
Gestell besteht. Rechts (links fehlt das
Gegenstück) lagert sich eine sehr ländlich
aufgefasste Ceres. —
Für das gesamte Kunstgewerbe seiner Zeit suchte Dietterlin auf solche Weise aut
209 Blättern theils Stoff zur Anregung, theils ausführbare Motive zu bieten : sein Lehr-
buch ist nicht frei von Werken von derber, übertriebener Wirkung, aber es ist für
seine Zeit eine musterhafte Leistung, ebenso geistvoll in der Sammlung und Sichtung
der Gedanken, als in der Beherrschung der künstlerischen Ausdrucksmittel. Dietterlin
verfügt, trotzdem sich bei ihm einigemal das Possenhafte vordrängt, trotzdem er
zuweilen in Ton und Ausdruck allzu derbkräftig ist, doch über einen reichen Fond
natürlicher Anmut und besitzt dabei die Schalkhaftigkeit eines bewusst übertrei-
benden Künstlers. Ist er auch manchmal zum Imitator geworden, so wusste er doch
das Nach- und Anempfundene mit individueller Souveränität zu verarbeiten und
so zu seinem Eigentum zu machen.
Kein Wunder, dass der Erfolg des Werkes ein geradezu überraschender war.
Wohl hatte Dietterlin auf eine grosse Verbreitung seiner Arbeiten selbst im Aus-
lande gerechnet; denn von allen drei Büchern erschienen zu gleicher Zeit neben
den deutschen auch französische und lateinische Ausgaben, aber die veränderten
Zeitumstände, die eine Lockerung der in der Renaissance üblichen Zierweise bereits
herbeigeführt hatten, liessen in den Entwürfen des Meisters, der in nichts ein
Neuerer sein wollte, gewissermassen die posthume Aeusserung einer älteren gesetz-
gebenden Macht im Reiche der dekorativen Kunst erblicken.