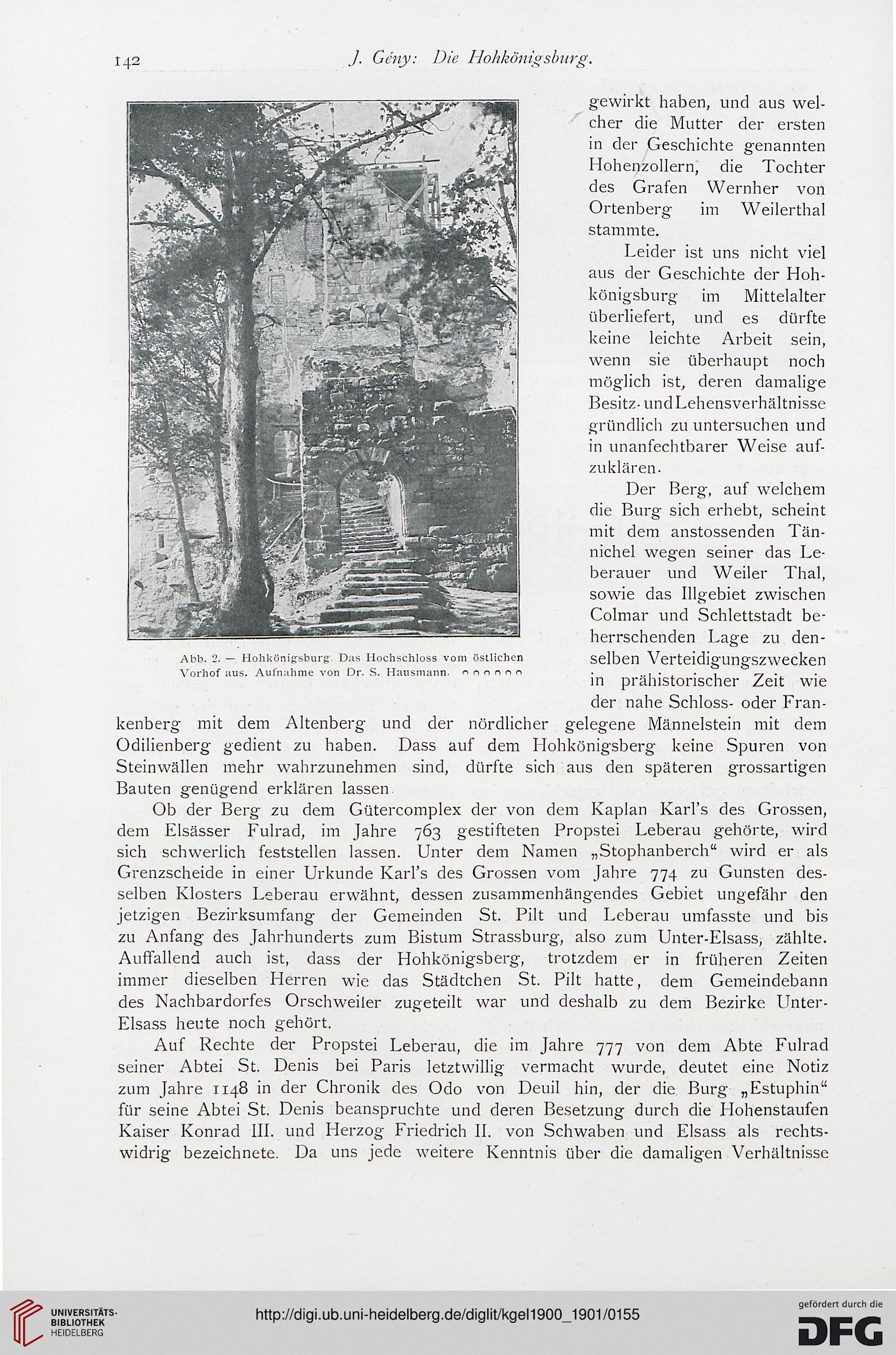142
J. Geny: Die Hohkönigsburg.
gewirkt haben, und aus wel-
cher die Mutter der ersten
in der Geschichte genannten
Hohenzollern, die Tochter
des Grafen Wernher von
Ortenberg im Weilerthal
stammte.
Leider ist uns nicht viel
aus der Geschichte der Hoh-
königsburg im Mittelalter
überliefert, und es dürfte
keine leichte Arbeit sein,
wenn sie überhaupt noch
möglich ist, deren damalige
Besitz- und Lehensverhältnisse
gründlich zu untersuchen und
in unanfechtbarer Weise auf-
zuklären.
Der Berg, auf welchem
die Burg sich erhebt, scheint
mit dem anstossenden Tän-
nichel wegen seiner das Le-
berauer und Weiler Thal,
sowie das Iiigebiet zwischen
Colmar und Schlettstadt be-
herrschenden Lage zu den-
selben Verteidigungszwecken
in prähistorischer Zeit wie
der nahe Schloss- oder Fran-
kenberg mit dem Altenberg und der nördlicher gelegene Männelstein mit dem
Odilienberg gedient zu haben. Dass auf dem I Iohkönigsberg keine Spuren von
Steinwällen mehr wahrzunehmen sind, dürfte sich aus den späteren grossartigen
Bauten genügend erklären lassen
Ob der Berg zu dem Gütercomplex der von dem Kaplan Karl's des Grossen,
dem Elsässer Fulrad, im Jahre 763 gestifteten Propstei Leberau gehörte, wird
sich schwerlich feststellen lassen. Unter dem Namen „Stophanberch" wird er als
Grenzscheide in einer Urkunde Karl's des Grossen vom Jahre 774 zu Gunsten des-
selben Klosters Leberau erwähnt, dessen zusammenhängendes Gebiet ungefähr den
jetzigen Bezirksumfang der Gemeinden St. Pilt und Leberau umfasste und bis
zu Anfang des Jahrhunderts zum Bistum Strassburg, also zum Unter-Elsass, zählte.
Auffallend auch ist, dass der Hohkönigsberg, trotzdem er in früheren Zeiten
immer dieselben Herren wie das Städtchen St. Pilt hatte, dem Gemeindebann
des Nachbardorfes Orschweiler zugeteilt war und deshalb zu dem Bezirke Unter-
Elsass heute noch gehört.
Auf Rechte der Propstei Leberau, die im Jahre 777 von dem Abte Fulrad
seiner Abtei St. Denis bei Paris letztwillig vermacht wurde, deutet eine Notiz
zum Jahre 1148 in der Chronik des Odo von Deuil hin, der die Burg „Estuphin"
für seine Abtei St. Denis beanspruchte und deren Besetzung durch die Hohenstaufen
Kaiser Konrad III. und Herzog Friedrich II. von Schwaben und Elsass als rechts-
widrig bezeichnete. Da uns jede weitere Kenntnis über die damaligen Verhältnisse
Abb. 2. — Hohkönigsburg;. Das Hochschloss vom östlichen
Vorhof aus. Aufnahme von Dr. S. Hausmann, n n o n n n
J. Geny: Die Hohkönigsburg.
gewirkt haben, und aus wel-
cher die Mutter der ersten
in der Geschichte genannten
Hohenzollern, die Tochter
des Grafen Wernher von
Ortenberg im Weilerthal
stammte.
Leider ist uns nicht viel
aus der Geschichte der Hoh-
königsburg im Mittelalter
überliefert, und es dürfte
keine leichte Arbeit sein,
wenn sie überhaupt noch
möglich ist, deren damalige
Besitz- und Lehensverhältnisse
gründlich zu untersuchen und
in unanfechtbarer Weise auf-
zuklären.
Der Berg, auf welchem
die Burg sich erhebt, scheint
mit dem anstossenden Tän-
nichel wegen seiner das Le-
berauer und Weiler Thal,
sowie das Iiigebiet zwischen
Colmar und Schlettstadt be-
herrschenden Lage zu den-
selben Verteidigungszwecken
in prähistorischer Zeit wie
der nahe Schloss- oder Fran-
kenberg mit dem Altenberg und der nördlicher gelegene Männelstein mit dem
Odilienberg gedient zu haben. Dass auf dem I Iohkönigsberg keine Spuren von
Steinwällen mehr wahrzunehmen sind, dürfte sich aus den späteren grossartigen
Bauten genügend erklären lassen
Ob der Berg zu dem Gütercomplex der von dem Kaplan Karl's des Grossen,
dem Elsässer Fulrad, im Jahre 763 gestifteten Propstei Leberau gehörte, wird
sich schwerlich feststellen lassen. Unter dem Namen „Stophanberch" wird er als
Grenzscheide in einer Urkunde Karl's des Grossen vom Jahre 774 zu Gunsten des-
selben Klosters Leberau erwähnt, dessen zusammenhängendes Gebiet ungefähr den
jetzigen Bezirksumfang der Gemeinden St. Pilt und Leberau umfasste und bis
zu Anfang des Jahrhunderts zum Bistum Strassburg, also zum Unter-Elsass, zählte.
Auffallend auch ist, dass der Hohkönigsberg, trotzdem er in früheren Zeiten
immer dieselben Herren wie das Städtchen St. Pilt hatte, dem Gemeindebann
des Nachbardorfes Orschweiler zugeteilt war und deshalb zu dem Bezirke Unter-
Elsass heute noch gehört.
Auf Rechte der Propstei Leberau, die im Jahre 777 von dem Abte Fulrad
seiner Abtei St. Denis bei Paris letztwillig vermacht wurde, deutet eine Notiz
zum Jahre 1148 in der Chronik des Odo von Deuil hin, der die Burg „Estuphin"
für seine Abtei St. Denis beanspruchte und deren Besetzung durch die Hohenstaufen
Kaiser Konrad III. und Herzog Friedrich II. von Schwaben und Elsass als rechts-
widrig bezeichnete. Da uns jede weitere Kenntnis über die damaligen Verhältnisse
Abb. 2. — Hohkönigsburg;. Das Hochschloss vom östlichen
Vorhof aus. Aufnahme von Dr. S. Hausmann, n n o n n n