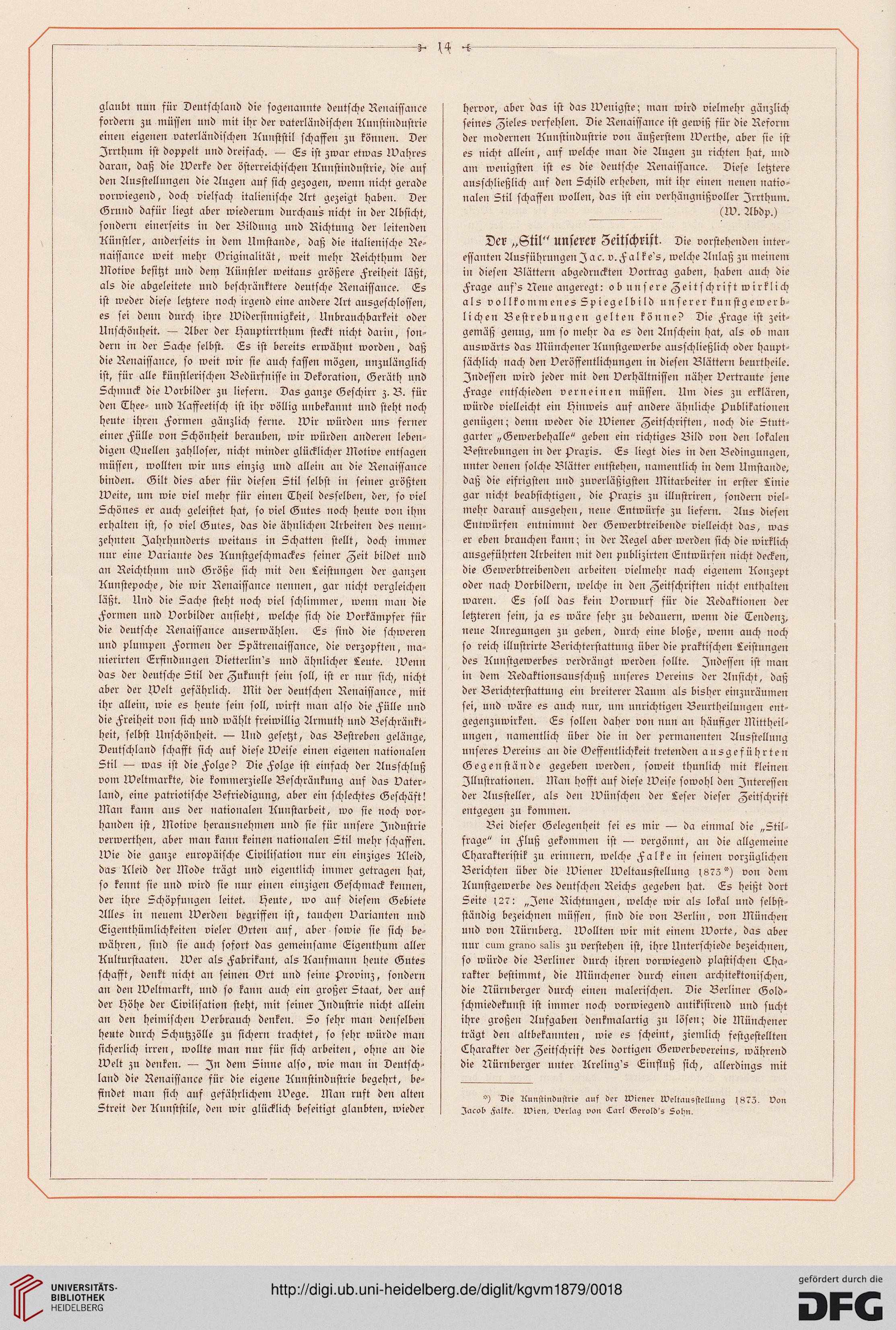glaubt nun für Deutschland die sogenannte deutsche Renaissance
fordern zu müssen und mit ihr der vaterländischen Kunstindustrie
einen eigenen vaterländischen Kunststil schaffen zu können. Der
Irrthum ist doppelt und dreifach. — Es ist zwar etwas wahres
daran, daß die Merke der österreichischen Kunstindustrie, die auf
den Ausstellungen die Augen auf sich gezogen, wenn nicht gerade
vorwiegend, doch vielfach italienische Art gezeigt haben. Der
Grund dafür liegt aber wiederum durchaus nicht in der Absicht,
sondern einerseits in der Bildung und Richtung der leitenden
Künstler, anderseits in dem Umstande, daß die italienische Re-
naissance weit mehr (Originalität, weit mehr Reichthum der
Motive besitzt und dem Künstler weitaus größere Freiheit läßt,
als die abgeleitete und beschränktere deutsche Renaissance. Es
ist weder diese letztere noch irgend eine andere Art ausgeschlossen,
es sei denn durch ihre Widersinnigkeit, Unbrauchbarkeit oder
Unschönheit. — Aber der Kauptirrthum steckt nicht darin, son-
dern in der Sache selbst. Es ist bereits erwähnt worden, daß
die Renaissance, so weit wir sie auch fassen mögen, unzulänglich
ist, für alle künstlerischen Bedürfnisse in Dekoration, Geräth nnd
Schmuck die Vorbilder zu liefern. Das ganze Geschirr z. B. für
den Thee- und Kaffeetisch ist ihr völlig unbekannt und steht noch
heute ihren Formen gänzlich ferne, wir würden uns ferner
einer Fülle von Schönheit berauben, wir würden anderen leben-
digen Quellen zahlloser, nicht minder glücklicher Motive entsagen
müssen, wollten wir uns einzig und allein an die Renaissance
binden. Gilt dies aber für diesen Stil selbst in seiner größten
weite, um wie viel mehr für einen Theil desselben, der, so viel
Schönes er auch geleistet hat, so viel Gutes noch heute von ihm
erhalten ist, so viel Gutes, das die ähnliche» Arbeiten des neun-
zehnten Jahrhunderts weitaus in Schatten stellt, doch immer
nur eine Variante des Kunstgeschmackes seiner Zeit bildet und
an Reichthum und Größe sich mit den Leistungen der ganzen
Kunstepoche, die wir Renaissance nennen, gar nicht vergleichen
läßt. Und die Sache steht noch viel schlimmer, wenn man die
Formen und Vorbilder ansieht, welche sich die Vorkämpfer für
die deutsche Renaissance auserwählen. Es sind die schweren
und plumpen Formen der Spätrenaissance, die verzopften, ma-
nierirten Erfindungen Dietterlin's und ähnlicher Leute, wenn
das der deutsche Stil der Zukunft sein soll, ist er nur sich, nicht
aber der Welt gefährlich. Mit der deutschen Renaissance, mit
ihr allein, wie es heute sein soll, wirft man also die Fülle und
die Freiheit von sich und wählt freiwillig Armuth und Beschränkt-
heit, selbst Unschönheit. — Und gesetzt, das Bestreben gelänge,
Deutschland schafft sich auf diese weise einen eigenen nationalen
Stil — was ist die Folge? Die Folge ist einfach der Ausschluß
vom Weltmärkte, die kommerzielle Beschränkung auf das Vater-
land, eine patriotische Befriedigung, aber ein schlechtes Geschäft!
Man kann aus der nationalen Kunstarbeit, wo sie noch vor-
handen ist, Motive herausnehmen und sie für unsere Industrie
verwerthen, aber man kann keinen nationalen Stil mehr schaffen,
wie die ganze europäische Livilisation nur ein einziges Kleid,
das Kleid der Mode trägt und eigentlich immer getragen hat,
so kennt sie und wird sie nur einen einzigen Geschmack kennen,
der ihre Schöpfungen leitet, kseute, wo auf diesem Gebiete
Alles in neuem werden begriffen ist, tauchen Varianten und
Eigenthümlichkeiten vieler (Orten auf, aber sowie sie sich be-
währen, sind sie auch sofort das gemeinsame Eigenthum aller
Kulturstaaten, wer als Fabrikant, als Kaufmann heute Gutes
schafft, denkt nicht an seinen (Ort und seine Provinz, sondern
an den Weltmarkt, und so kann auch ein großer Staat, der auf
der Vöhe der Livilisation steht, mit seiner Industrie nicht allein
an den heimischen verbrauch denken. So sehr man denselben
heute durch Schutzzölle zu sichern trachtet, so sehr würde man
sicherlich irren, wollte man nur für sich arbeiten, ohne an die
Welt zu denken. — In dem Sinne also, wie man in Deutsch-
land die Renaissance für die eigene Kunstindustrie begehrt, be-
findet man sich auf gefährlichem Wege. Man ruft den alten
Streit der Kunststile, den wir glücklich beseitigt glaubten, wieder
hervor, aber das ist das wenigste; man wird vielmehr gänzlich
seines Zieles verfehlen. Die Renaissance ist gewiß für die Reform
der modernen Kunstindustrie von äußerstem werthe, aber sie ist
es nicht allein, auf welche man die Augen zu richten hat, und
am wenigsten ist es die deutsche Renaissance. Diese letztere
ausschließlich auf den Schild erheben, mit ihr einen neuen natio-
nalen Stil schaffen wollen, das ist ein verhängnißvoller Irrthum.
______ (w. Abdp.)
Der „Hill" unserer Zeitschrift. Die vorstehenden inter-
essanten AusführungenJ ac. v.Fal ke's, welche Anlaß zu meinem
in diesen Blättern abgedruckten Vortrag gaben, haben auch die
Frage auf's Neue angeregt: ob unsere Zeitschrift wirklich
als vollkommenes Spiegelbild unserer kunstgewerb-
lichen Bestrebungen gelten könne? Die Frage ist zeit-
gemäß genug, um so mehr da es den Anschein hat, als ob man
auswärts das Münchener Kunstgewerbe ausschließlich oder Haupt-
sächlich nach den Veröffentlichungen in diesen Blättern beurtheile.
Indessen wird jeder mit den Verhältnissen näher Vertraute jene
Frage entschieden verneinen müssen. Um dies zu erklären,
würde vielleicht ein Hinweis auf andere ähnliche Publikationen
genügen; denn weder die wiener Zeitschriften, noch die Stutt-
garter „Gewerbehalle" geben ein richtiges Bild von den lokalen
Bestrebungen in der Praxis. Es liegt dies in den Bedingungen,
unter denen solche Blätter entstehen, namentlich in dem Umstande,
daß die eifrigsten und zuverläßigsten Mitarbeiter in erster Linie
gar nicht beabsichtigen, die Praxis zu illustriren, sondern viel-
mehr darauf ausgehen, neue Entwürfe zu liefern, Aus diesen
Entwürfen entnimmt der Gewerbtreibende vielleicht das, was
er eben brauchen kann; in der Regel aber werden sich die wirklich
ausgeführten Arbeiten mit den publizirten Entwürfen nicht decken,
die Gewerbtreibenden arbeiten vielmehr nach eigenem Konzept
oder nach Vorbildern, welche in den Zeitschriften nicht enthalten
waren. Ls soll das kein Vorwurf für die Redaktionen der
letzteren sein, ja es wäre sehr zu bedauern, wenn die Tendenz,
neue Anregungen zu geben, durch eine bloße, wenn auch noch
so reich illustrirte Berichterstattung über die praktischen Leistungen
des Kunstgewerbes verdrängt werden sollte. Indessen ist man
in dem Redaktionsausschuß unseres Vereins der Ansicht, daß
der Berichterstattung ein breiterer Raum als bisher einzuräumen
sei, und wäre es auch nur, um unrichtigen Beurtheiluugen ent-
gegenzuwirken. Es sollen daher von nun an häufiger Mittheil-
ungen , namentlich über die in der permanenten Ausstellung
unseres Vereins an die (Oeffeutlichkeit tretenden ausgeführten
Gegenstände gegeben werden, soweit thunlich mit kleinen
Illustrationen. Man hofft auf diese weise sowohl den Interessen
der Aussteller, als den wünschen der Leser dieser Zeitschrift
entgegen zu kommen.
Bei dieser Gelegenheit sei es mir — da einmal die „Stil-
frage" in Fluß gekommen ist — vergönnt, an die allgemeine
Lharakteristik zu erinnern, welche Falke in seinen vorzüglichen
Berichten über die wiener Weltausstellung ^ 873 *) von dem
Kunstgewerbe des deutschen Reichs gegeben hat. Es heißt dort
Seite (27: „Jene Richtungen, welche wir als lokal und selbst-
ständig bezeichnen müssen, sind die von Berlin, von München
und von Nürnberg, wollten wir mit einem Worte, das aber
nur cum grano salis zu verstehen ist, ihre Unterschiede bezeichnen,
so würde die Berliner durch ihren vorwiegend plastischen Lha-
rakter bestimmt, die Münchener durch einen architektonischen,
die Nürnberger durch einen malerischen. Die Berliner Gold-
schmiedekunst ist immer noch vorwiegend autikisireud und sucht
ihre großen Ausgaben denkmalartig zu lösen; die Münchener
trägt den altbekannten, wie es scheint, ziemlich festgestellten
Charakter der Zeitschrift des dortigen Gewerbevereius, während
die Nürnberger unter Kreling's Einfiuß sich, allerdings mit
*) Die Kunftinbuftrie auf der wiener Weltausstellung \875. von
Jacob Falke. Wien, Verlag von Carl Gerold's Lohn.