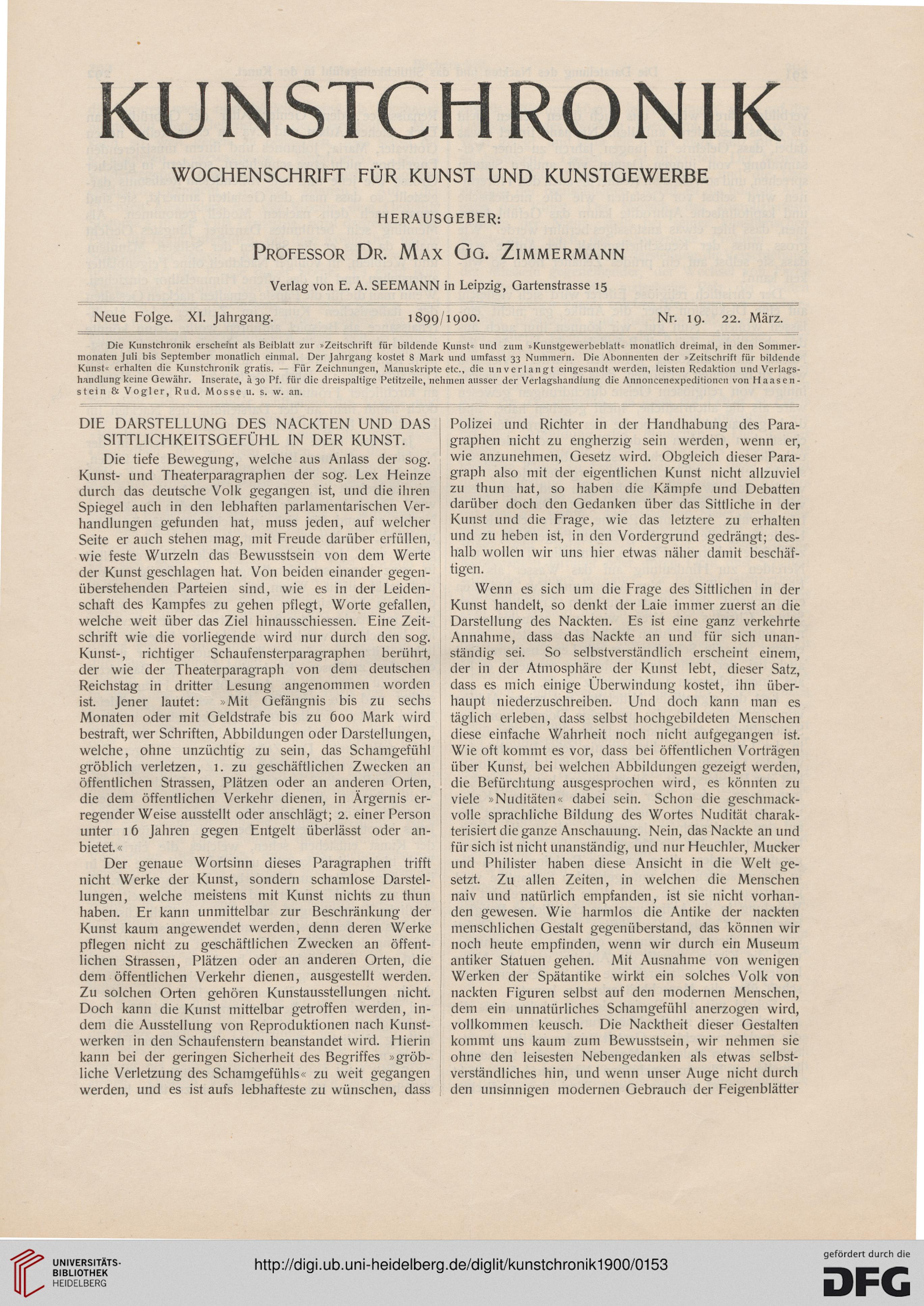KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
herausgeber:
Professor Dr. Max Gg. Zimmermann
Verlag von e. a. seemann in Leipzig, Oartenstrasse 15
Neue Folge. XI. Jahrgang.
1899/1900.
Nr. 19. 22. März.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlags-
handlung keine Gewähr. Inserate, ä 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasen-
stein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
DIE DARSTELLUNG DES NACKTEN UND DAS
SITTLICHKEITSGEFÜHL IN DER KUNST.
Die tiefe Bewegung, welche aus Anlass der sog.
Kunst- und Theaterparagraphen der sog. Lex Heinze
durch das deutsche Volk gegangen ist, und die ihren
Spiegel auch in den lebhaften parlamentarischen Ver-
handlungen gefunden hat, muss jeden, auf welcher
Seite er auch stehen mag, mit Freude darüber erfüllen,
wie feste Wurzeln das Bewusstsein von dem Werte
der Kunst geschlagen hat. Von beiden einander gegen-
überstehenden Parteien sind, wie es in der Leiden-
schaft des Kampfes zu gehen pflegt, Worte gefallen,
welche weit über das Ziel hinausschiessen. Eine Zeit-
schrift wie die vorliegende wird nur durch den sog.
Kunst-, richtiger Schaufensterparagraphen berührt,
der wie der Theaterparagraph von dem deutschen
Reichstag in dritter Lesung angenommen worden
ist. Jener lautet: Mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 600 Mark wird
bestraft, wer Schriften, Abbildungen oder Darstellungen,
welche, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl
gröblich verletzen, 1. zu geschäftlichen Zwecken an
öffentlichen Strassen, Plätzen oder an anderen Orten,
die dem öffentlichen Verkehr dienen, in Ärgernis er-
regender Weise ausstellt oder anschlägt; 2. einer Person
unter 16 Jahren gegen Entgelt überlässt oder an-
bietet. «
Der genaue Wortsinn dieses Paragraphen trifft
nicht Werke der Kunst, sondern schamlose Darstel-
lungen, welche meistens mit Kunst nichts zu thun
haben. Er kann unmittelbar zur Beschränkung der
Kunst kaum angewendet werden, denn deren Werke
pflegen nicht zu geschäftlichen Zwecken an öffent-
lichen Strassen, Plätzen oder an anderen Orten, die
dem öffentlichen Verkehr dienen, ausgestellt werden.
Zu solchen Orten gehören Kunstausstellungen nicht.
Doch kann die Kunst mittelbar getroffen werden, in-
dem die Ausstellung von Reproduktionen nach Kunst-
werken in den Schaufenstern beanstandet wird. Hierin
kann bei der geringen Sicherheit des Begriffes »gröb-
liche Verletzung des Schamgefühls« zu weit gegangen
werden, und es ist aufs lebhafteste zu wünschen, dass
Polizei und Richter in der Handhabung des Para-
graphen nicht zu engherzig sein werden, wenn er,
1 wie anzunehmen, Gesetz wird. Obgleich dieser Para-
, graph also mit der eigentlichen Kunst nicht allzuviel
zu thun hat, so haben die Kämpfe und Debatten
darüber doch den Gedanken über das Sittliche in der
Kunst und die Frage, wie das letztere zu erhalten
und zu heben ist, in den Vordergrund gedrängt; des-
halb wollen wir uns hier etwas näher damit beschäf-
tigen.
Wenn es sich um die Frage des Sittlichen in der
Kunst handelt, so denkt der Laie immer zuerst an die
Darstellung des Nackten. Es ist eine ganz verkehrte
Annahme, dass das Nackte an und für sich unan-
ständig sei. So selbstverständlich erscheint einem,
der in der Atmosphäre der Kunst lebt, dieser Satz,
dass es mich einige Überwindung kostet, ihn über-
haupt niederzuschreiben. Und doch kann man es
täglich erleben, dass selbst hochgebildeten Menschen
diese einfache Wahrheit noch nicht aufgegangen ist.
Wie oft kommt es vor, dass bei öffentlichen Vorträgen
über Kunst, bei welchen Abbildungen gezeigt werden,
die Befürchtung ausgesprochen wird, es könnten zu
viele »Nuditäten« dabei sein. Schon die geschmack-
volle sprachliche Bildung des Wortes Nudität charak-
terisiert die ganze Anschauung. Nein, das Nackte an und
für sich ist nicht unanständig, und nur Heuchler, Mucker
und Philister haben diese Ansicht in die Welt ge-
setzt. Zu allen Zeiten, in welchen die Menschen
naiv und natürlich empfanden, ist sie nicht vorhan-
i den gewesen. Wie harmlos die Antike der nackten
, menschlichen Gestalt gegenüberstand, das können wir
noch heute empfinden, wenn wir durch ein Museum
antiker Statuen gehen. Mit Ausnahme von wenigen
Werken der Spätantike wirkt ein solches Volk von
nackten Figuren selbst auf den modernen Menschen,
dem ein unnatürliches Schamgefühl anerzogen wird,
vollkommen keusch. Die Nacktheit dieser Gestalten
kommt uns kaum zum Bewusstsein, wir nehmen sie
ohne den leisesten Nebengedanken als etwas selbst-
verständliches hin, und wenn unser Auge nicht durch
I den unsinnigen modernen Gebrauch der Feigenblätter
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
herausgeber:
Professor Dr. Max Gg. Zimmermann
Verlag von e. a. seemann in Leipzig, Oartenstrasse 15
Neue Folge. XI. Jahrgang.
1899/1900.
Nr. 19. 22. März.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlags-
handlung keine Gewähr. Inserate, ä 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasen-
stein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
DIE DARSTELLUNG DES NACKTEN UND DAS
SITTLICHKEITSGEFÜHL IN DER KUNST.
Die tiefe Bewegung, welche aus Anlass der sog.
Kunst- und Theaterparagraphen der sog. Lex Heinze
durch das deutsche Volk gegangen ist, und die ihren
Spiegel auch in den lebhaften parlamentarischen Ver-
handlungen gefunden hat, muss jeden, auf welcher
Seite er auch stehen mag, mit Freude darüber erfüllen,
wie feste Wurzeln das Bewusstsein von dem Werte
der Kunst geschlagen hat. Von beiden einander gegen-
überstehenden Parteien sind, wie es in der Leiden-
schaft des Kampfes zu gehen pflegt, Worte gefallen,
welche weit über das Ziel hinausschiessen. Eine Zeit-
schrift wie die vorliegende wird nur durch den sog.
Kunst-, richtiger Schaufensterparagraphen berührt,
der wie der Theaterparagraph von dem deutschen
Reichstag in dritter Lesung angenommen worden
ist. Jener lautet: Mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 600 Mark wird
bestraft, wer Schriften, Abbildungen oder Darstellungen,
welche, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl
gröblich verletzen, 1. zu geschäftlichen Zwecken an
öffentlichen Strassen, Plätzen oder an anderen Orten,
die dem öffentlichen Verkehr dienen, in Ärgernis er-
regender Weise ausstellt oder anschlägt; 2. einer Person
unter 16 Jahren gegen Entgelt überlässt oder an-
bietet. «
Der genaue Wortsinn dieses Paragraphen trifft
nicht Werke der Kunst, sondern schamlose Darstel-
lungen, welche meistens mit Kunst nichts zu thun
haben. Er kann unmittelbar zur Beschränkung der
Kunst kaum angewendet werden, denn deren Werke
pflegen nicht zu geschäftlichen Zwecken an öffent-
lichen Strassen, Plätzen oder an anderen Orten, die
dem öffentlichen Verkehr dienen, ausgestellt werden.
Zu solchen Orten gehören Kunstausstellungen nicht.
Doch kann die Kunst mittelbar getroffen werden, in-
dem die Ausstellung von Reproduktionen nach Kunst-
werken in den Schaufenstern beanstandet wird. Hierin
kann bei der geringen Sicherheit des Begriffes »gröb-
liche Verletzung des Schamgefühls« zu weit gegangen
werden, und es ist aufs lebhafteste zu wünschen, dass
Polizei und Richter in der Handhabung des Para-
graphen nicht zu engherzig sein werden, wenn er,
1 wie anzunehmen, Gesetz wird. Obgleich dieser Para-
, graph also mit der eigentlichen Kunst nicht allzuviel
zu thun hat, so haben die Kämpfe und Debatten
darüber doch den Gedanken über das Sittliche in der
Kunst und die Frage, wie das letztere zu erhalten
und zu heben ist, in den Vordergrund gedrängt; des-
halb wollen wir uns hier etwas näher damit beschäf-
tigen.
Wenn es sich um die Frage des Sittlichen in der
Kunst handelt, so denkt der Laie immer zuerst an die
Darstellung des Nackten. Es ist eine ganz verkehrte
Annahme, dass das Nackte an und für sich unan-
ständig sei. So selbstverständlich erscheint einem,
der in der Atmosphäre der Kunst lebt, dieser Satz,
dass es mich einige Überwindung kostet, ihn über-
haupt niederzuschreiben. Und doch kann man es
täglich erleben, dass selbst hochgebildeten Menschen
diese einfache Wahrheit noch nicht aufgegangen ist.
Wie oft kommt es vor, dass bei öffentlichen Vorträgen
über Kunst, bei welchen Abbildungen gezeigt werden,
die Befürchtung ausgesprochen wird, es könnten zu
viele »Nuditäten« dabei sein. Schon die geschmack-
volle sprachliche Bildung des Wortes Nudität charak-
terisiert die ganze Anschauung. Nein, das Nackte an und
für sich ist nicht unanständig, und nur Heuchler, Mucker
und Philister haben diese Ansicht in die Welt ge-
setzt. Zu allen Zeiten, in welchen die Menschen
naiv und natürlich empfanden, ist sie nicht vorhan-
i den gewesen. Wie harmlos die Antike der nackten
, menschlichen Gestalt gegenüberstand, das können wir
noch heute empfinden, wenn wir durch ein Museum
antiker Statuen gehen. Mit Ausnahme von wenigen
Werken der Spätantike wirkt ein solches Volk von
nackten Figuren selbst auf den modernen Menschen,
dem ein unnatürliches Schamgefühl anerzogen wird,
vollkommen keusch. Die Nacktheit dieser Gestalten
kommt uns kaum zum Bewusstsein, wir nehmen sie
ohne den leisesten Nebengedanken als etwas selbst-
verständliches hin, und wenn unser Auge nicht durch
I den unsinnigen modernen Gebrauch der Feigenblätter