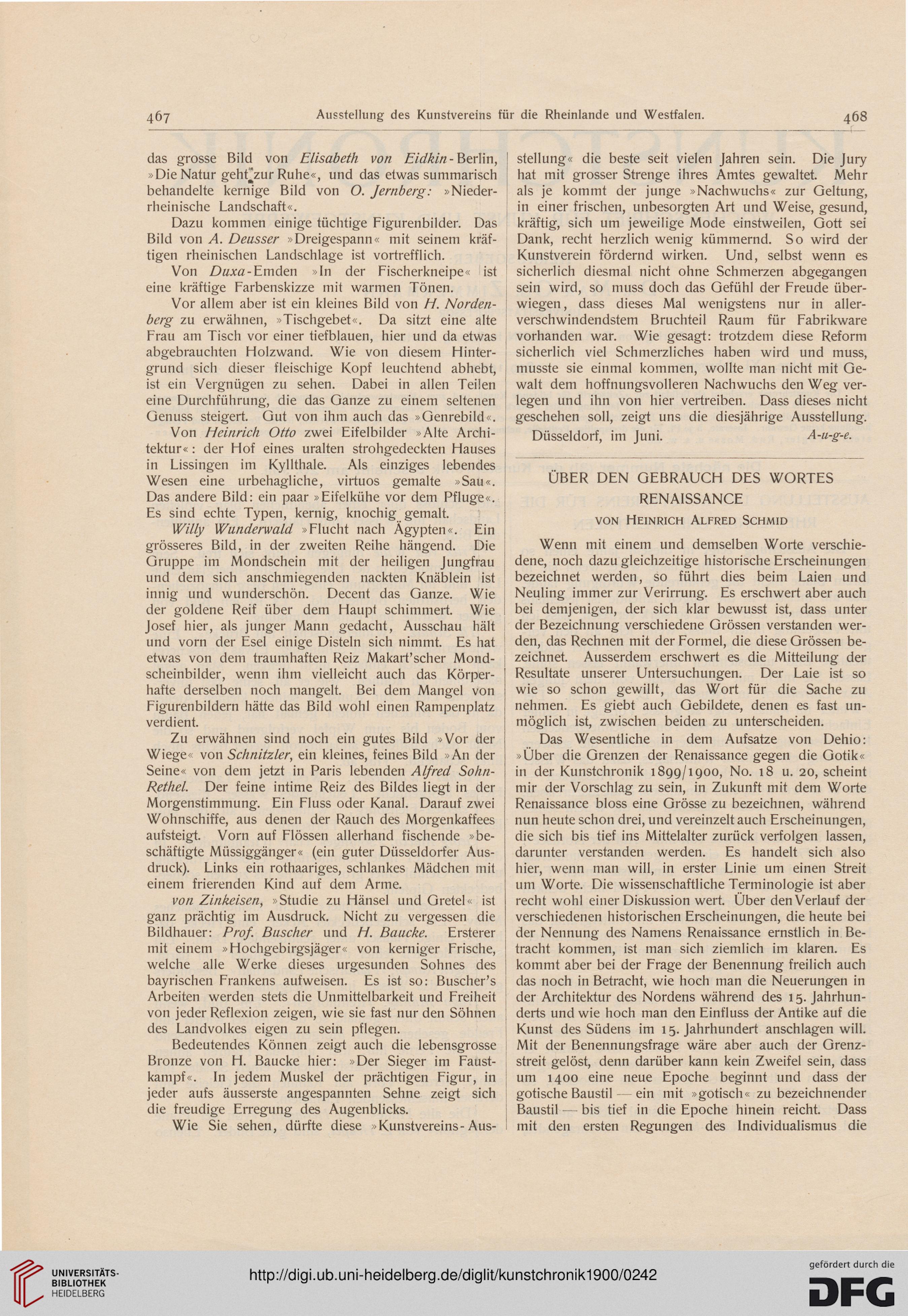467
Ausstellung des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen.
468
das grosse Bild von Elisabeth von Eidkin- Berlin,
»Die Natur geht^zur Ruhe«, und das etwas summarisch
behandelte kernige Bild von O. Jernberg: »Nieder-
rheinische Landschaft«.
Dazu kommen einige tüchtige Figurenbilder. Das
Bild von A. Deusser »Dreigespann« mit seinem kräf-
tigen rheinischen Landschlage ist vortrefflich.
Von Duxa-Emden »In der Fischerkneipe« ist
eine kräftige Farbenskizze mit warmen Tönen.
Vor allem aber ist ein kleines Bild von H. Norden-
berg zu erwähnen, »Tischgebet«. Da sitzt eine alte
Frau am Tisch vor einer tiefblauen, hier und da etwas
abgebrauchten Holzwand. Wie von diesem Hinter-
grund sich dieser fleischige Kopf leuchtend abhebt,
ist ein Vergnügen zu sehen. Dabei in allen Teilen
eine Durchführung, die das Ganze zu einem seltenen
üenuss steigert. Gut von ihm auch das »Genrebild .
Von Heinrich Otto zwei Eifelbilder »Alte Archi-
tektur« : der Hof eines uralten strohgedeckten Hauses
in Lissingen im Kyllthale. Als einziges lebendes
Wesen eine urbehagliche, virtuos gemalte »Sau«.
Das andere Bild: ein paar »Eifelkühe vor dem Pfluge«.
Es sind echte Typen, kernig, knochig gemalt.
Willy Wunderwald »Flucht nach Ägypten«. Ein
grösseres Bild, in der zweiten Reihe hängend. Die
Gruppe im Mondschein mit der heiligen Jungfrau
und dem sich anschmiegenden nackten Knäblein ist
innig und wunderschön. Decent das Ganze. Wie
der goldene Reif über dem Haupt schimmert. Wie
Josef hier, als junger Mann gedacht, Ausschau hält
und vorn der Esel einige Disteln sich nimmt. Es hat
etwas von dem traumhaften Reiz Makart'scher Mond-
scheinbilder, wenn ihm vielleicht auch das Körper-
hafte derselben noch mangelt. Bei dem Mangel von
Figurenbildern hätte das Bild wohl einen Rampenplatz
verdient.
Zu erwähnen sind noch ein gutes Bild »Vor der
Wiege« von Schnitzler, ein kleines, feines Bild »An der
Seine« von dem jetzt in Paris lebenden Alfred Sohn-
Rethel. Der feine intime Reiz des Bildes liegt in der
Morgenstimmung. Ein Fluss oder Kanal. Darauf zwei
Wohnschiffe, aus denen der Rauch des Morgenkaffees
aufsteigt. Vorn auf Flössen allerhand fischende »be-
schäftigte Müssiggänger« (ein guter Düsseldorfer Aus-
druck). Links ein rothaariges, schlankes Mädchen mit
einem frierenden Kind auf dem Arme.
von Zinkeisen, »Studie zu Hänsel und Gretel« ist
ganz prächtig im Ausdruck. Nicht zu vergessen die
Bildhauer: Prof. Buscher und H. Baucke. Ersterer
mit einem »Hochgebirgsjäger« von kerniger Frische,
welche alle Werke dieses urgesunden Sohnes des
bayrischen Frankens aufweisen. Es ist so: Buscher's
Arbeiten werden stets die Unmittelbarkeit und Freiheit
von jeder Reflexion zeigen, wie sie fast nur den Söhnen
des Landvolkes eigen zu sein pflegen.
Bedeutendes Können zeigt auch die lebensgrosse
Bronze von H. Baucke hier: »Der Sieger im Faust-
kampf«. In jedem Muskel der prächtigen Figur, in
jeder aufs äusserste angespannten Sehne zeigt sich
die freudige Erregung des Augenblicks.
Wie Sie sehen, dürfte diese »Kunstvereins-Aus-
! Stellung« die beste seit vielen Jahren sein. Die Jury
hat mit grosser Strenge ihres Amtes gewaltet. Mehr
als je kommt der junge »Nachwuchs« zur Geltung,
in einer frischen, unbesorgten Art und Weise, gesund,
kräftig, sich um jeweilige Mode einstweilen, Gott sei
Dank, recht herzlich wenig kümmernd. So wird der
Kunstverein fördernd wirken. Und, selbst wenn es
sicherlich diesmal nicht ohne Schmerzen abgegangen
sein wird, so muss doch das Gefühl der Freude über-
wiegen , dass dieses Mal wenigstens nur in aller-
verschwindendstem Bruchteil Raum für Fabrikware
j vorhanden war. Wie gesagt: trotzdem diese Reform
sicherlich viel Schmerzliches haben wird und muss,
musste sie einmal kommen, wollte man nicht mit Ge-
walt dem hoffnungsvolleren Nachwuchs den Weg ver-
legen und ihn von hier vertreiben. Dass dieses nicht
geschehen soll, zeigt uns die diesjährige Ausstellung.
Düsseldorf, im Juni. A-u-g-e.
ÜBER DEN GEBRAUCH DES WORTES
RENAISSANCE
von Heinrich Alfred Schmid
Wenn mit einem und demselben Worte verschie-
dene, noch dazu gleichzeitige historische Erscheinungen
bezeichnet werden, so führt dies beim Laien und
Neuling immer zur Verirrung. Es erschwert aber auch
bei demjenigen, der sich klar bewusst ist, dass unter
der Bezeichnung verschiedene Grössen verstanden wer-
den, das Rechnen mit der Formel, die diese Grössen be-
1 zeichnet. Ausserdem erschwert es die Mitteilung der
Resultate unserer Untersuchungen. Der Laie ist so
wie so schon gewillt, das Wort für die Sache zu
nehmen. Es giebt auch Gebildete, denen es fast un-
möglich ist, zwischen beiden zu unterscheiden.
Das Wesentliche in dem Aufsatze von Dehio:
»Über die Grenzen der Renaissance gegen die Gotik«
in der Kunstchronik 1899/1900, No. 18 u. 20, scheint
mir der Vorschlag zu sein, in Zukunft mit dem Worte
Renaissance bloss eine Grösse zu bezeichnen, während
nun heute schon drei, und vereinzelt auch Erscheinungen,
die sich bis tief ins Mittelalter zurück verfolgen lassen,
darunter verstanden werden. Es handelt sich also
hier, wenn man will, in erster Linie um einen Streit
um Worte. Die wissenschaftliche Terminologie ist aber
recht wohl einer Diskussion wert. Über den Verlauf der
verschiedenen historischen Erscheinungen, die heute bei
der Nennung des Namens Renaissance ernstlich in Be-
! tracht kommen, ist man sich ziemlich im klaren. Es
I kommt aber bei der Frage der Benennung freilich auch
das noch in Betracht, wie hoch man die Neuerungen in
' der Architektur des Nordens während des 15. Jahrhun-
derts und wie hoch man den Einfluss der Antike auf die
Kunst des Südens im 15. Jahrhundert anschlagen will.
Mit der Benennungsfrage wäre aber auch der Grenz-
streit gelöst, denn darüber kann kein Zweifel sein, dass
um 1400 eine neue Epoche beginnt und dass der
gotische Baustil — ein mit »gotisch« zu bezeichnender
Baustil — bis tief in die Epoche hinein reicht. Dass
i mit den ersten Regungen des Individualismus die
Ausstellung des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen.
468
das grosse Bild von Elisabeth von Eidkin- Berlin,
»Die Natur geht^zur Ruhe«, und das etwas summarisch
behandelte kernige Bild von O. Jernberg: »Nieder-
rheinische Landschaft«.
Dazu kommen einige tüchtige Figurenbilder. Das
Bild von A. Deusser »Dreigespann« mit seinem kräf-
tigen rheinischen Landschlage ist vortrefflich.
Von Duxa-Emden »In der Fischerkneipe« ist
eine kräftige Farbenskizze mit warmen Tönen.
Vor allem aber ist ein kleines Bild von H. Norden-
berg zu erwähnen, »Tischgebet«. Da sitzt eine alte
Frau am Tisch vor einer tiefblauen, hier und da etwas
abgebrauchten Holzwand. Wie von diesem Hinter-
grund sich dieser fleischige Kopf leuchtend abhebt,
ist ein Vergnügen zu sehen. Dabei in allen Teilen
eine Durchführung, die das Ganze zu einem seltenen
üenuss steigert. Gut von ihm auch das »Genrebild .
Von Heinrich Otto zwei Eifelbilder »Alte Archi-
tektur« : der Hof eines uralten strohgedeckten Hauses
in Lissingen im Kyllthale. Als einziges lebendes
Wesen eine urbehagliche, virtuos gemalte »Sau«.
Das andere Bild: ein paar »Eifelkühe vor dem Pfluge«.
Es sind echte Typen, kernig, knochig gemalt.
Willy Wunderwald »Flucht nach Ägypten«. Ein
grösseres Bild, in der zweiten Reihe hängend. Die
Gruppe im Mondschein mit der heiligen Jungfrau
und dem sich anschmiegenden nackten Knäblein ist
innig und wunderschön. Decent das Ganze. Wie
der goldene Reif über dem Haupt schimmert. Wie
Josef hier, als junger Mann gedacht, Ausschau hält
und vorn der Esel einige Disteln sich nimmt. Es hat
etwas von dem traumhaften Reiz Makart'scher Mond-
scheinbilder, wenn ihm vielleicht auch das Körper-
hafte derselben noch mangelt. Bei dem Mangel von
Figurenbildern hätte das Bild wohl einen Rampenplatz
verdient.
Zu erwähnen sind noch ein gutes Bild »Vor der
Wiege« von Schnitzler, ein kleines, feines Bild »An der
Seine« von dem jetzt in Paris lebenden Alfred Sohn-
Rethel. Der feine intime Reiz des Bildes liegt in der
Morgenstimmung. Ein Fluss oder Kanal. Darauf zwei
Wohnschiffe, aus denen der Rauch des Morgenkaffees
aufsteigt. Vorn auf Flössen allerhand fischende »be-
schäftigte Müssiggänger« (ein guter Düsseldorfer Aus-
druck). Links ein rothaariges, schlankes Mädchen mit
einem frierenden Kind auf dem Arme.
von Zinkeisen, »Studie zu Hänsel und Gretel« ist
ganz prächtig im Ausdruck. Nicht zu vergessen die
Bildhauer: Prof. Buscher und H. Baucke. Ersterer
mit einem »Hochgebirgsjäger« von kerniger Frische,
welche alle Werke dieses urgesunden Sohnes des
bayrischen Frankens aufweisen. Es ist so: Buscher's
Arbeiten werden stets die Unmittelbarkeit und Freiheit
von jeder Reflexion zeigen, wie sie fast nur den Söhnen
des Landvolkes eigen zu sein pflegen.
Bedeutendes Können zeigt auch die lebensgrosse
Bronze von H. Baucke hier: »Der Sieger im Faust-
kampf«. In jedem Muskel der prächtigen Figur, in
jeder aufs äusserste angespannten Sehne zeigt sich
die freudige Erregung des Augenblicks.
Wie Sie sehen, dürfte diese »Kunstvereins-Aus-
! Stellung« die beste seit vielen Jahren sein. Die Jury
hat mit grosser Strenge ihres Amtes gewaltet. Mehr
als je kommt der junge »Nachwuchs« zur Geltung,
in einer frischen, unbesorgten Art und Weise, gesund,
kräftig, sich um jeweilige Mode einstweilen, Gott sei
Dank, recht herzlich wenig kümmernd. So wird der
Kunstverein fördernd wirken. Und, selbst wenn es
sicherlich diesmal nicht ohne Schmerzen abgegangen
sein wird, so muss doch das Gefühl der Freude über-
wiegen , dass dieses Mal wenigstens nur in aller-
verschwindendstem Bruchteil Raum für Fabrikware
j vorhanden war. Wie gesagt: trotzdem diese Reform
sicherlich viel Schmerzliches haben wird und muss,
musste sie einmal kommen, wollte man nicht mit Ge-
walt dem hoffnungsvolleren Nachwuchs den Weg ver-
legen und ihn von hier vertreiben. Dass dieses nicht
geschehen soll, zeigt uns die diesjährige Ausstellung.
Düsseldorf, im Juni. A-u-g-e.
ÜBER DEN GEBRAUCH DES WORTES
RENAISSANCE
von Heinrich Alfred Schmid
Wenn mit einem und demselben Worte verschie-
dene, noch dazu gleichzeitige historische Erscheinungen
bezeichnet werden, so führt dies beim Laien und
Neuling immer zur Verirrung. Es erschwert aber auch
bei demjenigen, der sich klar bewusst ist, dass unter
der Bezeichnung verschiedene Grössen verstanden wer-
den, das Rechnen mit der Formel, die diese Grössen be-
1 zeichnet. Ausserdem erschwert es die Mitteilung der
Resultate unserer Untersuchungen. Der Laie ist so
wie so schon gewillt, das Wort für die Sache zu
nehmen. Es giebt auch Gebildete, denen es fast un-
möglich ist, zwischen beiden zu unterscheiden.
Das Wesentliche in dem Aufsatze von Dehio:
»Über die Grenzen der Renaissance gegen die Gotik«
in der Kunstchronik 1899/1900, No. 18 u. 20, scheint
mir der Vorschlag zu sein, in Zukunft mit dem Worte
Renaissance bloss eine Grösse zu bezeichnen, während
nun heute schon drei, und vereinzelt auch Erscheinungen,
die sich bis tief ins Mittelalter zurück verfolgen lassen,
darunter verstanden werden. Es handelt sich also
hier, wenn man will, in erster Linie um einen Streit
um Worte. Die wissenschaftliche Terminologie ist aber
recht wohl einer Diskussion wert. Über den Verlauf der
verschiedenen historischen Erscheinungen, die heute bei
der Nennung des Namens Renaissance ernstlich in Be-
! tracht kommen, ist man sich ziemlich im klaren. Es
I kommt aber bei der Frage der Benennung freilich auch
das noch in Betracht, wie hoch man die Neuerungen in
' der Architektur des Nordens während des 15. Jahrhun-
derts und wie hoch man den Einfluss der Antike auf die
Kunst des Südens im 15. Jahrhundert anschlagen will.
Mit der Benennungsfrage wäre aber auch der Grenz-
streit gelöst, denn darüber kann kein Zweifel sein, dass
um 1400 eine neue Epoche beginnt und dass der
gotische Baustil — ein mit »gotisch« zu bezeichnender
Baustil — bis tief in die Epoche hinein reicht. Dass
i mit den ersten Regungen des Individualismus die