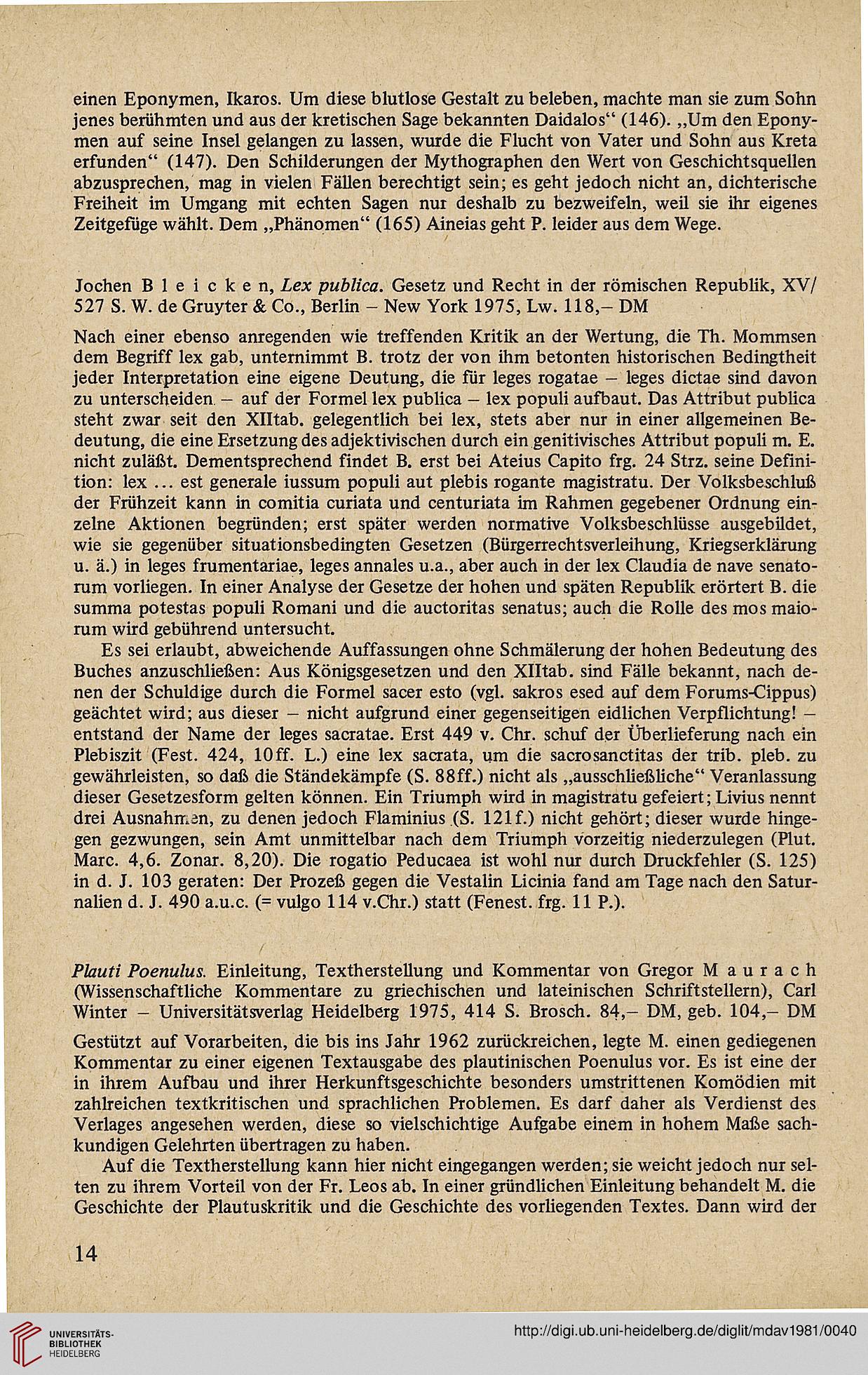einen Eponymen, Ikaros. Um diese blutlose Gestalt zu beleben, machte man sie zum Sohn
jenes berühmten und aus der kretischen Sage bekannten Daidalos“ (146). „Um den Epony-
men auf seine Insel gelangen zu lassen, wurde die Flucht von Vater und Sohn aus Kreta
erfunden“ (147). Den Schilderungen der Mythographen den Wert von Geschichtsquellen
abzusprechen, mag in vielen Fällen berechtigt sein; es geht jedoch nicht an, dichterische
Freiheit im Umgang mit echten Sagen nur deshalb zu bezweifeln, weil sie ihr eigenes
Zeitgefüge wählt. Dem „Phänomen“ (165) Aineias geht P. leider aus dem Wege.
Jochen B 1 e i c k e n, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, XV/
527 S. W. de Gruyter & Co., Berlin - New York 1975, Lw. 118,- DM
Nach einer ebenso anregenden wie treffenden Kritik an der Wertung, die Th. Mommsen
dem Begriff lex gab, unternimmt B. trotz der von ihm betonten historischen Bedingtheit
jeder Interpretation eine eigene Deutung, die für leges rogatae - leges dictae sind davon
zu unterscheiden - auf der Formel lex publica - lex populi aufbaut. Das Attribut publica
steht zwar seit den Xlltab. gelegentlich bei lex, stets aber nur in einer allgemeinen Be-
deutung, die eine Ersetzung des adjektivischen durch ein genitivisches Attribut populi m. E.
nicht zuläßt. Dementsprechend findet B. erst bei Ateius Capito frg. 24 Strz. seine Defini-
tion: lex ... est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu. Der Volksbeschluß
der Frühzeit kann in comitia curiata und centuriata im Rahmen gegebener Ordnung ein-
zelne Aktionen begründen; erst später werden normative Volksbeschlüsse ausgebildet,
wie sie gegenüber situationsbedingten Gesetzen (Bürgerrechtsverleihung, Kriegserklärung
u. ä.) in leges frumentariae, leges annales u.a., aber auch in der lex Claudia de nave senato-
rum vorliegen. In einer Analyse der Gesetze der hohen und späten Republik erörtert B. die
summa potestas populi Romani und die auctoritas senatus; auch die Rolle des mos maio-
rum wird gebührend untersucht.
Es sei erlaubt, abweichende Auffassungen ohne Schmälerung der hohen Bedeutung des
Buches anzuschließen: Aus Königsgesetzen und den Xlltab. sind Fälle bekannt, nach de-
nen der Schuldige durch die Formel sacer esto (vgl. sakros esed auf dem Forums-Cippus)
geächtet wird; aus dieser — nicht aufgrund einer gegenseitigen eidlichen Verpflichtung! —
entstand der Name der leges sacratae. Erst 449 v. Chr. schuf der Überlieferung nach ein
Plebiszit (Fest. 424, lOff. L.) eine lex sacrata, um die sacrosanctitas der trib. pleb. zu
gewährleisten, so daß die Ständekämpfe (S. 88ff.) nicht als „ausschließliche“ Veranlassung
dieser Gesetzesform gelten können. Ein Triumph wird in magistratu gefeiert; Livius nennt
drei Ausnahmen, zu denen jedoch Flaminius (S. 121 f.) nicht gehört; dieser wurde hinge-
gen gezwungen, sein Amt unmittelbar nach dem Triumph vorzeitig niederzulegen (Plut.
Marc. 4,6. Zonar. 8,20). Die rogatio Peducaea ist wohl nur durch Druckfehler (S. 125)
in d. J. 103 geraten: Der Prozeß gegen die Vestalin Licinia fand am Tage nach den Satur-
nalien d. J. 490 a.u.c. (= vulgo 114 v.Chr.) statt (Fenest. frg. 11 P.).
Plauti Poenulus. Einleitung, Textherstellung und Kommentar von Gregor M a u r a c h
(Wissenschaftliche Kommentare zu griechischen und lateinischen Schriftstellern), Carl
Winter - Universitätsverlag Heidelberg 1975, 414 S. Brosch. 84,- DM, geb. 104,- DM
Gestützt auf Vorarbeiten, die bis ins Jahr 1962 zurückreichen, legte M. einen gediegenen
Kommentar zu einer eigenen Textausgabe des plautinischen Poenulus vor. Es ist eine der
in ihrem Aufbau und ihrer Herkunftsgeschichte besonders umstrittenen Komödien mit
zahlreichen textkritischen und sprachlichen Problemen. Es darf daher als Verdienst des
Verlages angesehen werden, diese so vielschichtige Aufgabe einem in hohem Maße sach-
kundigen Gelehrten übertragen zu haben.
Auf die Textherstellung kann hier nicht eingegangen werden; sie weicht jedoch nur sel-
ten zu ihrem Vorteil von der Fr. Leos ab. In einer gründlichen Einleitung behandelt M. die
Geschichte der Plautuskritik und die Geschichte des vorliegenden Textes. Dann wird der
14
jenes berühmten und aus der kretischen Sage bekannten Daidalos“ (146). „Um den Epony-
men auf seine Insel gelangen zu lassen, wurde die Flucht von Vater und Sohn aus Kreta
erfunden“ (147). Den Schilderungen der Mythographen den Wert von Geschichtsquellen
abzusprechen, mag in vielen Fällen berechtigt sein; es geht jedoch nicht an, dichterische
Freiheit im Umgang mit echten Sagen nur deshalb zu bezweifeln, weil sie ihr eigenes
Zeitgefüge wählt. Dem „Phänomen“ (165) Aineias geht P. leider aus dem Wege.
Jochen B 1 e i c k e n, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, XV/
527 S. W. de Gruyter & Co., Berlin - New York 1975, Lw. 118,- DM
Nach einer ebenso anregenden wie treffenden Kritik an der Wertung, die Th. Mommsen
dem Begriff lex gab, unternimmt B. trotz der von ihm betonten historischen Bedingtheit
jeder Interpretation eine eigene Deutung, die für leges rogatae - leges dictae sind davon
zu unterscheiden - auf der Formel lex publica - lex populi aufbaut. Das Attribut publica
steht zwar seit den Xlltab. gelegentlich bei lex, stets aber nur in einer allgemeinen Be-
deutung, die eine Ersetzung des adjektivischen durch ein genitivisches Attribut populi m. E.
nicht zuläßt. Dementsprechend findet B. erst bei Ateius Capito frg. 24 Strz. seine Defini-
tion: lex ... est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu. Der Volksbeschluß
der Frühzeit kann in comitia curiata und centuriata im Rahmen gegebener Ordnung ein-
zelne Aktionen begründen; erst später werden normative Volksbeschlüsse ausgebildet,
wie sie gegenüber situationsbedingten Gesetzen (Bürgerrechtsverleihung, Kriegserklärung
u. ä.) in leges frumentariae, leges annales u.a., aber auch in der lex Claudia de nave senato-
rum vorliegen. In einer Analyse der Gesetze der hohen und späten Republik erörtert B. die
summa potestas populi Romani und die auctoritas senatus; auch die Rolle des mos maio-
rum wird gebührend untersucht.
Es sei erlaubt, abweichende Auffassungen ohne Schmälerung der hohen Bedeutung des
Buches anzuschließen: Aus Königsgesetzen und den Xlltab. sind Fälle bekannt, nach de-
nen der Schuldige durch die Formel sacer esto (vgl. sakros esed auf dem Forums-Cippus)
geächtet wird; aus dieser — nicht aufgrund einer gegenseitigen eidlichen Verpflichtung! —
entstand der Name der leges sacratae. Erst 449 v. Chr. schuf der Überlieferung nach ein
Plebiszit (Fest. 424, lOff. L.) eine lex sacrata, um die sacrosanctitas der trib. pleb. zu
gewährleisten, so daß die Ständekämpfe (S. 88ff.) nicht als „ausschließliche“ Veranlassung
dieser Gesetzesform gelten können. Ein Triumph wird in magistratu gefeiert; Livius nennt
drei Ausnahmen, zu denen jedoch Flaminius (S. 121 f.) nicht gehört; dieser wurde hinge-
gen gezwungen, sein Amt unmittelbar nach dem Triumph vorzeitig niederzulegen (Plut.
Marc. 4,6. Zonar. 8,20). Die rogatio Peducaea ist wohl nur durch Druckfehler (S. 125)
in d. J. 103 geraten: Der Prozeß gegen die Vestalin Licinia fand am Tage nach den Satur-
nalien d. J. 490 a.u.c. (= vulgo 114 v.Chr.) statt (Fenest. frg. 11 P.).
Plauti Poenulus. Einleitung, Textherstellung und Kommentar von Gregor M a u r a c h
(Wissenschaftliche Kommentare zu griechischen und lateinischen Schriftstellern), Carl
Winter - Universitätsverlag Heidelberg 1975, 414 S. Brosch. 84,- DM, geb. 104,- DM
Gestützt auf Vorarbeiten, die bis ins Jahr 1962 zurückreichen, legte M. einen gediegenen
Kommentar zu einer eigenen Textausgabe des plautinischen Poenulus vor. Es ist eine der
in ihrem Aufbau und ihrer Herkunftsgeschichte besonders umstrittenen Komödien mit
zahlreichen textkritischen und sprachlichen Problemen. Es darf daher als Verdienst des
Verlages angesehen werden, diese so vielschichtige Aufgabe einem in hohem Maße sach-
kundigen Gelehrten übertragen zu haben.
Auf die Textherstellung kann hier nicht eingegangen werden; sie weicht jedoch nur sel-
ten zu ihrem Vorteil von der Fr. Leos ab. In einer gründlichen Einleitung behandelt M. die
Geschichte der Plautuskritik und die Geschichte des vorliegenden Textes. Dann wird der
14