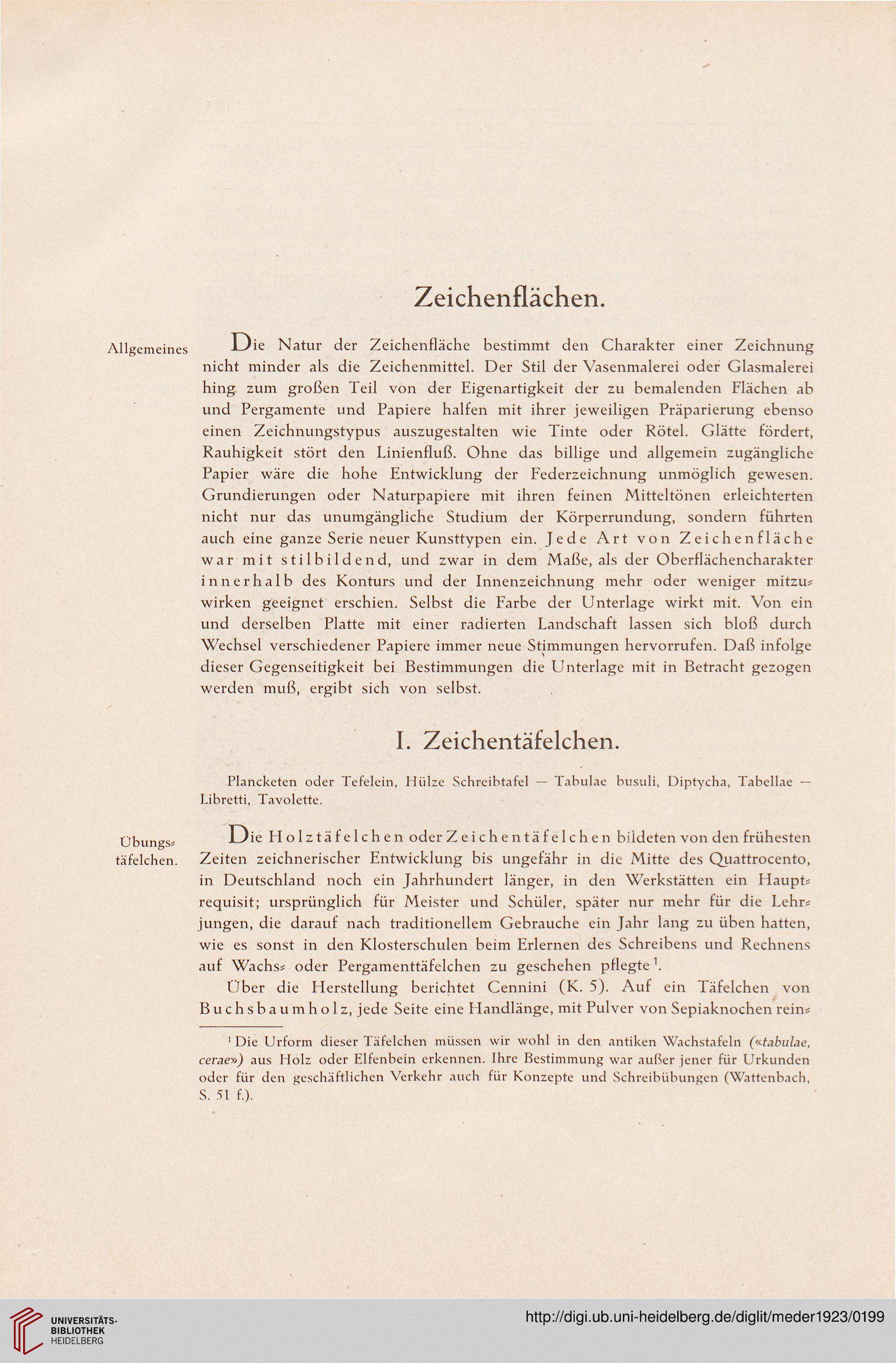Zeichenflächen.
Allgemeines Die Natur der Zeichenfläche bestimmt den Charakter einer Zeichnung
nicht minder als die Zeichenmittel. Der Stil der Vasenmalerei oder Glasmalerei
hing zum großen Teil von der Eigenartigkeit der zu bemalenden Flächen ab
und Pergamente und Papiere halfen mit ihrer jeweiligen Präparierung ebenso
einen Zeichnungstypus auszugestalten wie Tinte oder Rötel. Glätte fördert,
Rauhigkeit stört den Linienfluß. Ohne das billige und allgemein zugängliche
Papier wäre die hohe Entwicklung der Federzeichnung unmöglich gewesen.
Grundierungen oder Naturpapiere mit ihren feinen Mitteltönen erleichterten
nicht nur das unumgängliche Studium der Körperrundung, sondern führten
auch eine ganze Serie neuer Kunsttypen ein. Jede Art von Zeichenfläche
war mit stilbildend, und zwar in dem Maße, als der Oberflächencharakter
innerhalb des Konturs und der Innenzeichnung mehr oder weniger mitzu*
wirken geeignet erschien. Selbst die Farbe der Unterlage wirkt mit. Von ein
und derselben Platte mit einer radierten Landschaft lassen sich bloß durch
Wechsel verschiedener Papiere immer neue Stimmungen hervorrufen. Daß infolge
dieser Gegenseitigkeit bei Bestimmungen die Unterlage mit in Betracht gezogen
werden muß, ergibt sich von selbst.
I. Zeichentäfelchen.
Plancketen oder Tefelein, Ilülze .Schreibtafel — Tabulae busuli, Diptycha, Tabellae —
Libretti, Tavolette.
D ie Llolztäfelchen oder Zeiche ntäf eichen bildeten von den frühesten
Zeiten zeichnerischer Entwicklung bis ungefähr in die Mitte des Quattrocento,
in Deutschland noch ein Jahrhundert länger, in den Werkstätten ein Haupt«
requisit; ursprünglich für Meister und Schüler, später nur mehr für die Lehr«
jungen, die darauf nach traditionellem Gebrauche ein Jahr lang zu üben hatten,
wie es sonst in den Klosterschulen beim Erlernen des Schreibens und Rechnens
auf Wachs* oder Pergamenttäfelchen zu geschehen pflegte1.
Uber die Herstellung berichtet Cennini (K. 5). Auf ein Täfelchen von
Buchsbaumholz, jede Seite eine Handlänge, mit Pulver von Sepiaknochen rein*
1 Die Urform dieser Täfelchen müssen wir wohl in den antiken Wachstafeln («tabulae,
cerae») aus Holz oder Elfenbein erkennen. Ihre Bestimmung war außer jener für Urkunden
oder für den geschäftlichen Verkehr auch für Konzepte und Schreibübungen (Wattenbach,
S. 51 f.).
Ubungs»
täfeichen.
Allgemeines Die Natur der Zeichenfläche bestimmt den Charakter einer Zeichnung
nicht minder als die Zeichenmittel. Der Stil der Vasenmalerei oder Glasmalerei
hing zum großen Teil von der Eigenartigkeit der zu bemalenden Flächen ab
und Pergamente und Papiere halfen mit ihrer jeweiligen Präparierung ebenso
einen Zeichnungstypus auszugestalten wie Tinte oder Rötel. Glätte fördert,
Rauhigkeit stört den Linienfluß. Ohne das billige und allgemein zugängliche
Papier wäre die hohe Entwicklung der Federzeichnung unmöglich gewesen.
Grundierungen oder Naturpapiere mit ihren feinen Mitteltönen erleichterten
nicht nur das unumgängliche Studium der Körperrundung, sondern führten
auch eine ganze Serie neuer Kunsttypen ein. Jede Art von Zeichenfläche
war mit stilbildend, und zwar in dem Maße, als der Oberflächencharakter
innerhalb des Konturs und der Innenzeichnung mehr oder weniger mitzu*
wirken geeignet erschien. Selbst die Farbe der Unterlage wirkt mit. Von ein
und derselben Platte mit einer radierten Landschaft lassen sich bloß durch
Wechsel verschiedener Papiere immer neue Stimmungen hervorrufen. Daß infolge
dieser Gegenseitigkeit bei Bestimmungen die Unterlage mit in Betracht gezogen
werden muß, ergibt sich von selbst.
I. Zeichentäfelchen.
Plancketen oder Tefelein, Ilülze .Schreibtafel — Tabulae busuli, Diptycha, Tabellae —
Libretti, Tavolette.
D ie Llolztäfelchen oder Zeiche ntäf eichen bildeten von den frühesten
Zeiten zeichnerischer Entwicklung bis ungefähr in die Mitte des Quattrocento,
in Deutschland noch ein Jahrhundert länger, in den Werkstätten ein Haupt«
requisit; ursprünglich für Meister und Schüler, später nur mehr für die Lehr«
jungen, die darauf nach traditionellem Gebrauche ein Jahr lang zu üben hatten,
wie es sonst in den Klosterschulen beim Erlernen des Schreibens und Rechnens
auf Wachs* oder Pergamenttäfelchen zu geschehen pflegte1.
Uber die Herstellung berichtet Cennini (K. 5). Auf ein Täfelchen von
Buchsbaumholz, jede Seite eine Handlänge, mit Pulver von Sepiaknochen rein*
1 Die Urform dieser Täfelchen müssen wir wohl in den antiken Wachstafeln («tabulae,
cerae») aus Holz oder Elfenbein erkennen. Ihre Bestimmung war außer jener für Urkunden
oder für den geschäftlichen Verkehr auch für Konzepte und Schreibübungen (Wattenbach,
S. 51 f.).
Ubungs»
täfeichen.