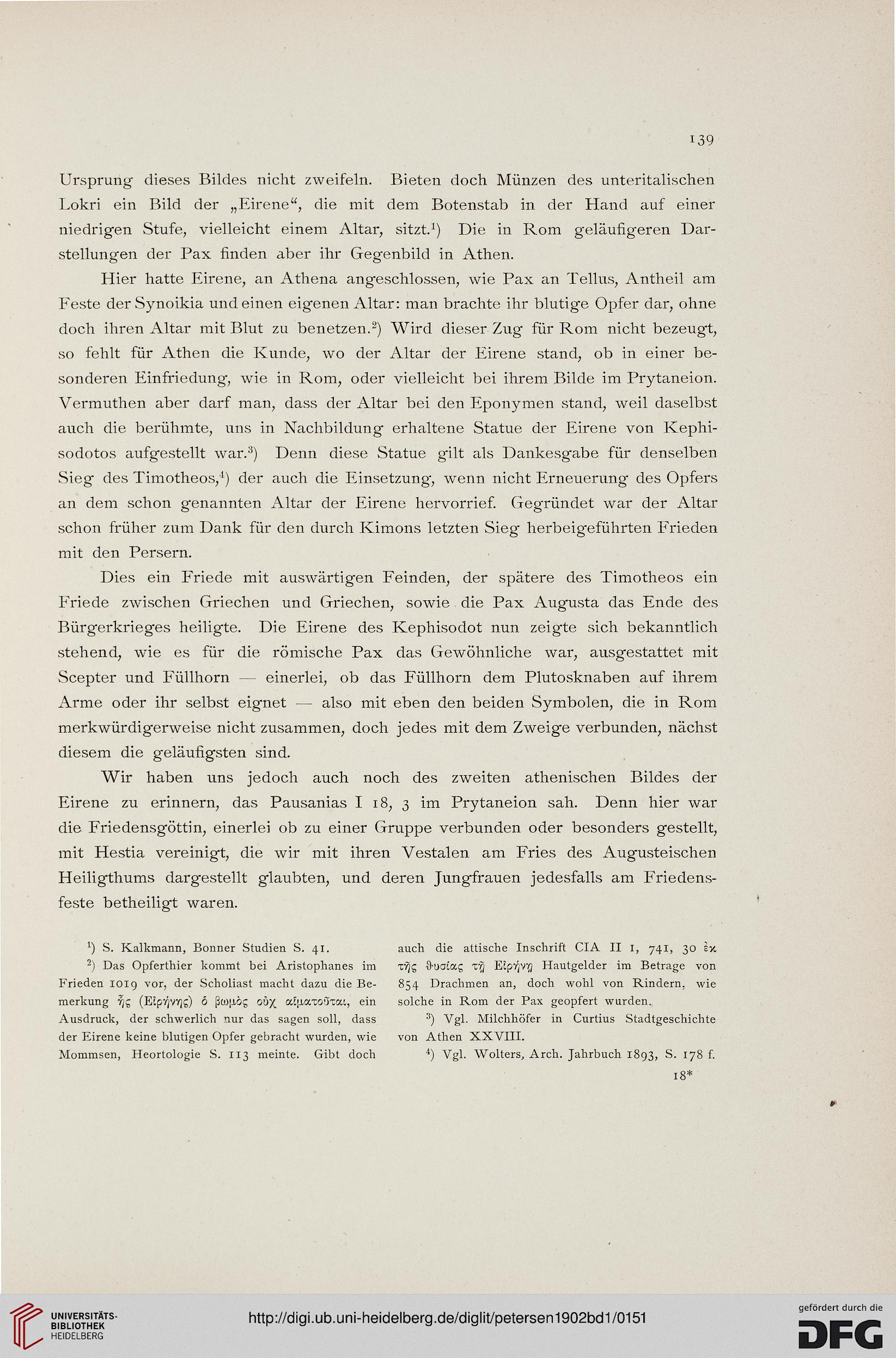139
Ursprung dieses Bildes nicht zweifeln. Bieten doch Münzen des unteritalischen
Lokri ein Bild der „Eirene", die mit dem Botenstab in der Hand auf einer
niedrigen Stufe, vielleicht einem Altar, sitzt.1) Die in Rom geläufigeren Dar-
stellungen der Pax finden aber ihr Gegenbild in Athen.
Hier hatte Eirene, an Athena angeschlossen, wie Pax an Tellus, Antheil am
Feste der Synoikia und einen eigenen Altar: man brachte ihr blutige Opfer dar, ohne
doch ihren Altar mit Blut zu benetzen.2) Wird dieser Zug für Rom nicht bezeugt,
so fehlt für Athen die Kunde, wo der Altar der Eirene stand, ob in einer be-
sonderen Einfriedung, wie in Rom, oder vielleicht bei ihrem Bilde im Prytaneion.
Vermuthen aber darf man, dass der Altar bei den Eponymen stand, weil daselbst
auch die berühmte, uns in Nachbildung erhaltene Statue der Eirene von Kephi-
sodotos aufgestellt war.3) Denn diese Statue gilt als Dankesgabe für denselben
Sieg des Timotheos,1) der auch die Einsetzung, wenn nicht Erneuerung des Opfers
an dem schon genannten Altar der Eirene hervorrief. Gegründet war der Altar
schon früher zum Dank für den durch Kimons letzten Sieg herbeigeführten Frieden
mit den Persern.
Dies ein Friede mit auswärtigen Feinden, der spätere des Timotheos ein
Friede zwischen Griechen und Griechen, sowie die Pax Augusta das Ende des
Bürgerkrieges heiligte. Die Eirene des Kephisodot nun zeigte sich bekanntlich
stehend, wie es für die römische Pax das Gewöhnliche war, ausgestattet mit
Scepter und Füllhorn - einerlei, ob das Füllhorn dem Plutosknaben auf ihrem
Arme oder ihr selbst eignet — also mit eben den beiden Symbolen, die in Rom
merkwürdigerweise nicht zusammen, doch jedes mit dem Zweige verbunden, nächst
diesem die geläufigsten sind.
Wir haben uns jedoch auch noch des zweiten athenischen Bildes der
Eirene zu erinnern, das Pausanias I 18, 3 im Prytaneion sah. Denn hier war
die Friedensgöttin, einerlei ob zu einer Gruppe verbunden oder besonders gestellt,
mit Hestia vereinigt, die wir mit ihren Vestalen am Fries des Augusteischen
Heiligthums dargestellt glaubten, und deren Jungfrauen jedesfalls am Friedens-
feste betheiligt waren.
1) S. Kalkmann, Bonner Studien S. 41.
2) Das Opferthier kommt bei Aristophanes im
Frieden 1019 vor, der Scholiast macht dazu die Be-
merkung ?}g (EJpvjvyjj) 6 ßu)[iÖ£ oöx aEjiaTOÖTat,, ein
Ausdruck, der schwerlich nur das sagen soll, dass
der Eirene keine blutigen Opfer gebracht wurden, wie
Mommsen, Heortologie S. Ii3 meinte. Gibt doch
auch die attische Inschrift CIA II I, 741, 30 iy.
TYjg T$ Etp7jvv; Hautgelder im Betrage von
854 Drachmen an, doch wohl von Rindern, wie
solche in Rom der Pax geopfert wurden.
3) Vgl. Milchhöfer in Curtius Stadtgeschichte
von Athen XXVIII.
4) Vgl. Wolters, Arch. Jahrbuch 1893, S. 178 f.
18*
Ursprung dieses Bildes nicht zweifeln. Bieten doch Münzen des unteritalischen
Lokri ein Bild der „Eirene", die mit dem Botenstab in der Hand auf einer
niedrigen Stufe, vielleicht einem Altar, sitzt.1) Die in Rom geläufigeren Dar-
stellungen der Pax finden aber ihr Gegenbild in Athen.
Hier hatte Eirene, an Athena angeschlossen, wie Pax an Tellus, Antheil am
Feste der Synoikia und einen eigenen Altar: man brachte ihr blutige Opfer dar, ohne
doch ihren Altar mit Blut zu benetzen.2) Wird dieser Zug für Rom nicht bezeugt,
so fehlt für Athen die Kunde, wo der Altar der Eirene stand, ob in einer be-
sonderen Einfriedung, wie in Rom, oder vielleicht bei ihrem Bilde im Prytaneion.
Vermuthen aber darf man, dass der Altar bei den Eponymen stand, weil daselbst
auch die berühmte, uns in Nachbildung erhaltene Statue der Eirene von Kephi-
sodotos aufgestellt war.3) Denn diese Statue gilt als Dankesgabe für denselben
Sieg des Timotheos,1) der auch die Einsetzung, wenn nicht Erneuerung des Opfers
an dem schon genannten Altar der Eirene hervorrief. Gegründet war der Altar
schon früher zum Dank für den durch Kimons letzten Sieg herbeigeführten Frieden
mit den Persern.
Dies ein Friede mit auswärtigen Feinden, der spätere des Timotheos ein
Friede zwischen Griechen und Griechen, sowie die Pax Augusta das Ende des
Bürgerkrieges heiligte. Die Eirene des Kephisodot nun zeigte sich bekanntlich
stehend, wie es für die römische Pax das Gewöhnliche war, ausgestattet mit
Scepter und Füllhorn - einerlei, ob das Füllhorn dem Plutosknaben auf ihrem
Arme oder ihr selbst eignet — also mit eben den beiden Symbolen, die in Rom
merkwürdigerweise nicht zusammen, doch jedes mit dem Zweige verbunden, nächst
diesem die geläufigsten sind.
Wir haben uns jedoch auch noch des zweiten athenischen Bildes der
Eirene zu erinnern, das Pausanias I 18, 3 im Prytaneion sah. Denn hier war
die Friedensgöttin, einerlei ob zu einer Gruppe verbunden oder besonders gestellt,
mit Hestia vereinigt, die wir mit ihren Vestalen am Fries des Augusteischen
Heiligthums dargestellt glaubten, und deren Jungfrauen jedesfalls am Friedens-
feste betheiligt waren.
1) S. Kalkmann, Bonner Studien S. 41.
2) Das Opferthier kommt bei Aristophanes im
Frieden 1019 vor, der Scholiast macht dazu die Be-
merkung ?}g (EJpvjvyjj) 6 ßu)[iÖ£ oöx aEjiaTOÖTat,, ein
Ausdruck, der schwerlich nur das sagen soll, dass
der Eirene keine blutigen Opfer gebracht wurden, wie
Mommsen, Heortologie S. Ii3 meinte. Gibt doch
auch die attische Inschrift CIA II I, 741, 30 iy.
TYjg T$ Etp7jvv; Hautgelder im Betrage von
854 Drachmen an, doch wohl von Rindern, wie
solche in Rom der Pax geopfert wurden.
3) Vgl. Milchhöfer in Curtius Stadtgeschichte
von Athen XXVIII.
4) Vgl. Wolters, Arch. Jahrbuch 1893, S. 178 f.
18*