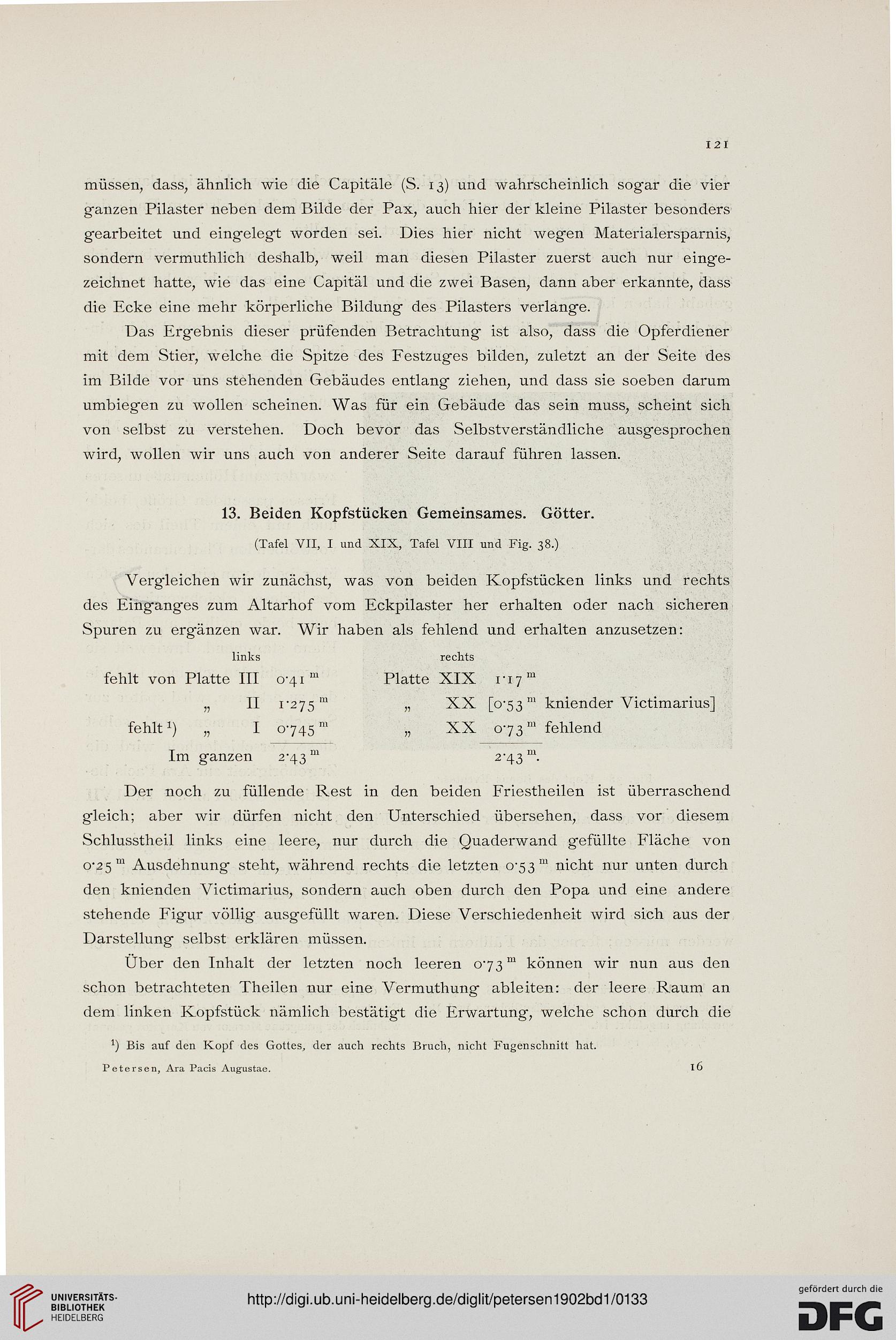121
müssen, dass; ähnlich wie die Capitäle (S. 13) und wahrscheinlich sogar die vier
ganzen Pilaster neben dem Bilde der Pax, auch hier der kleine Pilaster besonders
gearbeitet und eingelegt worden sei. Dies hier nicht wegen Materialersparnis,
sondern vermuthlich deshalb, weil man diesen Pilaster zuerst auch nur einge-
zeichnet hatte, wie das eine Capital und die zwei Basen, dann aber erkannte, dass
die Ecke eine mehr körperliche Bildung des Pilasters verlange.
Das Ergebnis dieser prüfenden Betrachtung ist also, dass die Opferdiener
mit dem Stier, welche die Spitze des Festzuges bilden, zuletzt an der Seite des
im Bilde vor uns stehenden Gebäudes entlang ziehen, und dass sie soeben darum
umbiegen zu wollen scheinen. Was für ein Gebäude das sein muss, scheint sich
von selbst zu verstehen. Doch bevor das Selbstverständliche ausgesprochen
wird, wollen wir uns auch von anderer Seite darauf führen lassen.
13. Beiden Kopfstücken Gemeinsames. Götter.
(Tafel VII, I und XIX, Tafel VIII und Fig. 38.)
Vergleichen wir zunächst, was von beiden Kopfstücken links und rechts
des Einganges zum Altarhof vom Eckpilaster her erhalten oder nach sicheren
Spuren zu ergänzen war. Wir haben als fehlend und erhalten anzusetzen:
links rechts
fehlt von Platte III 0-41 m Platte XIX 1 • 17 m
„ II 1*275m „ XX [0-53111 kniender Victimarius]
fehlt1) „ I 0745m „ XX 073m fehlend
Im ganzen 2-43111 2'43m-
Der noch zu füllende Rest in den beiden Friestheilen ist überraschend
gleich; aber wir dürfen nicht den Unterschied übersehen, dass vor diesem
Schlusstheil links eine leere, nur durch die Quaderwand gefüllte Fläche von
0-25 111 Ausdehnung steht, während rechts die letzten 0-53'" nicht nur unten durch
den knienden Victimarius, sondern auch oben durch den Popa und eine andere
stehende Figur völlig ausgefüllt waren. Diese Verschiedenheit wird sich aus der
Darstellung selbst erklären müssen.
Über den Inhalt der letzten noch leeren 073m können wir nun aus den
schon betrachteten Theilen nur eine Vermuthung ableiten: der leere Raum an
dem linken Kopfstück nämlich bestätigt die Erwartung, welche schon durch die
l) Bis auf den Kopf des Gottes, der auch rechts Bruch, nicht Fugenschnitt hat.
Petersen, Ära Pacis Augustae. l6
müssen, dass; ähnlich wie die Capitäle (S. 13) und wahrscheinlich sogar die vier
ganzen Pilaster neben dem Bilde der Pax, auch hier der kleine Pilaster besonders
gearbeitet und eingelegt worden sei. Dies hier nicht wegen Materialersparnis,
sondern vermuthlich deshalb, weil man diesen Pilaster zuerst auch nur einge-
zeichnet hatte, wie das eine Capital und die zwei Basen, dann aber erkannte, dass
die Ecke eine mehr körperliche Bildung des Pilasters verlange.
Das Ergebnis dieser prüfenden Betrachtung ist also, dass die Opferdiener
mit dem Stier, welche die Spitze des Festzuges bilden, zuletzt an der Seite des
im Bilde vor uns stehenden Gebäudes entlang ziehen, und dass sie soeben darum
umbiegen zu wollen scheinen. Was für ein Gebäude das sein muss, scheint sich
von selbst zu verstehen. Doch bevor das Selbstverständliche ausgesprochen
wird, wollen wir uns auch von anderer Seite darauf führen lassen.
13. Beiden Kopfstücken Gemeinsames. Götter.
(Tafel VII, I und XIX, Tafel VIII und Fig. 38.)
Vergleichen wir zunächst, was von beiden Kopfstücken links und rechts
des Einganges zum Altarhof vom Eckpilaster her erhalten oder nach sicheren
Spuren zu ergänzen war. Wir haben als fehlend und erhalten anzusetzen:
links rechts
fehlt von Platte III 0-41 m Platte XIX 1 • 17 m
„ II 1*275m „ XX [0-53111 kniender Victimarius]
fehlt1) „ I 0745m „ XX 073m fehlend
Im ganzen 2-43111 2'43m-
Der noch zu füllende Rest in den beiden Friestheilen ist überraschend
gleich; aber wir dürfen nicht den Unterschied übersehen, dass vor diesem
Schlusstheil links eine leere, nur durch die Quaderwand gefüllte Fläche von
0-25 111 Ausdehnung steht, während rechts die letzten 0-53'" nicht nur unten durch
den knienden Victimarius, sondern auch oben durch den Popa und eine andere
stehende Figur völlig ausgefüllt waren. Diese Verschiedenheit wird sich aus der
Darstellung selbst erklären müssen.
Über den Inhalt der letzten noch leeren 073m können wir nun aus den
schon betrachteten Theilen nur eine Vermuthung ableiten: der leere Raum an
dem linken Kopfstück nämlich bestätigt die Erwartung, welche schon durch die
l) Bis auf den Kopf des Gottes, der auch rechts Bruch, nicht Fugenschnitt hat.
Petersen, Ära Pacis Augustae. l6