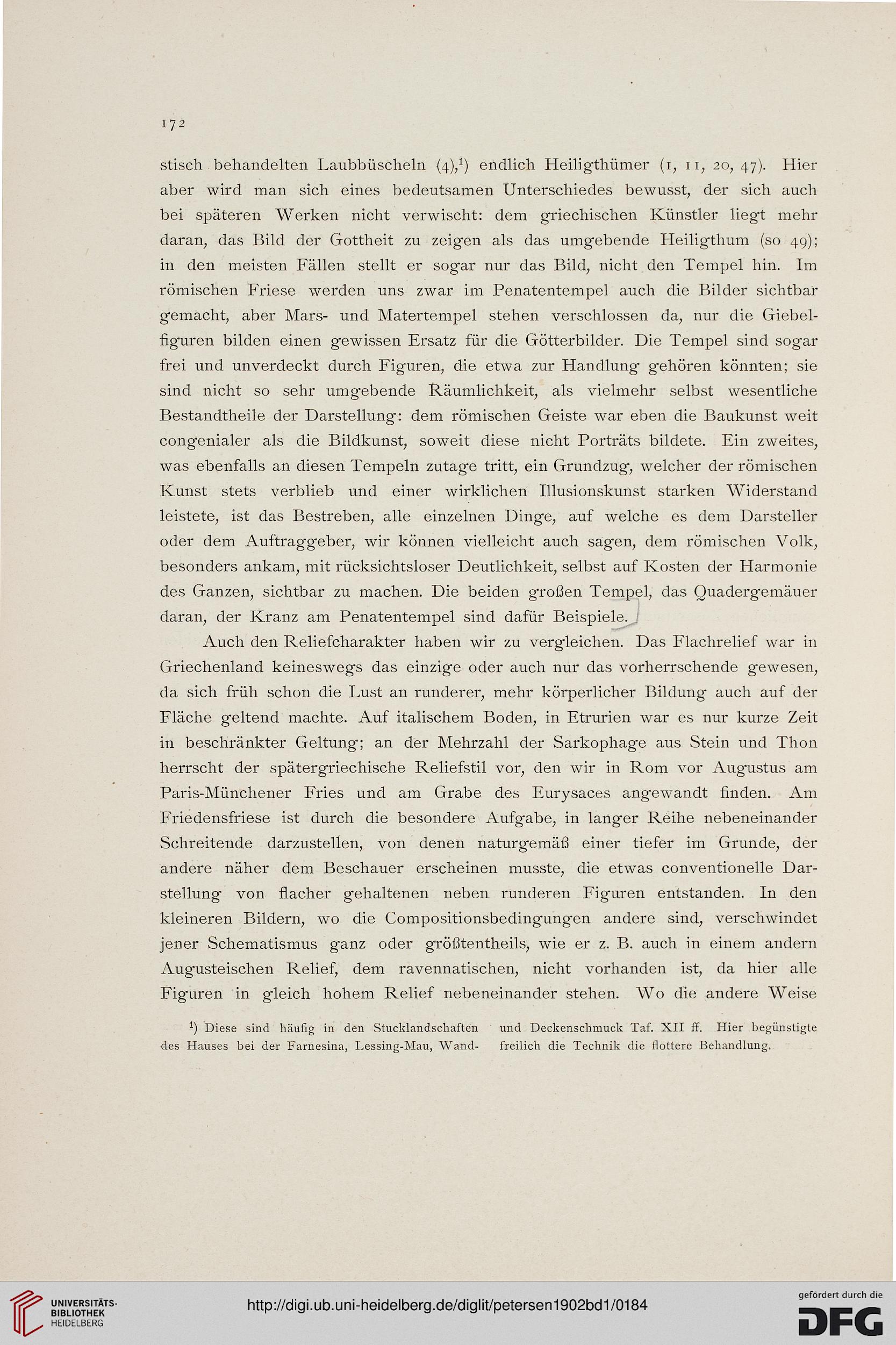172
stisch behandelten Laubbüscheln (4),1) endlich Heiligthümer (1, ii; 20, 47). Hier
aber wird man sich eines bedeutsamen Unterschiedes bewusst, der sich auch
bei späteren Werken nicht verwischt: dem griechischen Künstler liegt mehr
daran, das Bild der Gottheit zu zeigen als das umgebende Heiligthum (so 49);
in den meisten Fällen stellt er sogar nur das Bild; nicht den Tempel hin. Im
römischen Friese werden uns zwar im Penatentempel auch die Bilder sichtbar
gemacht, aber Mars- und Matertempel stehen verschlossen da, nur die Giebel-
figuren bilden einen gewissen Ersatz für die Götterbilder. Die Tempel sind sogar
frei und unverdeckt durch Figuren, die etwa zur Handlung gehören könnten; sie
sind nicht so sehr umgebende Räumlichkeit, als vielmehr selbst wesentliche
Bestandtheile der Darstellung: dem römischen Geiste war eben die Baukunst weit
congenialer als die Bildkunst, soweit diese nicht Porträts bildete. Ein zweites,
was ebenfalls an diesen Tempeln zutage tritt, ein Grundzug, welcher der römischen
Kunst stets verblieb und einer wirklichen Illusionskunst starken Widerstand
leistete, ist das Bestreben, alle einzelnen Dinge, auf welche es dem Darsteller
oder dem Auftraggeber, wir können vielleicht auch sagen, dem römischen Volk,
besonders ankam, mit rücksichtsloser Deutlichkeit, selbst auf Kosten der Harmonie
des Ganzen, sichtbar zu machen. Die beiden großen Tempel, das Quadergemäuer
daran, der Kranz am Penatentempel sind dafür Beispiele./
Auch den Reliefcharakter haben wir zu vergleichen. Das Flachrelief war in
Griechenland keineswegs das einzige oder auch nur das vorherrschende gewesen,
da sich früh schon die Lust an runderer, mehr körperlicher Bildung auch auf der
Fläche geltend machte. Auf italischem Boden, in Etrurien war es nur kurze Zeit
in beschränkter Geltung; an der Mehrzahl der Sarkophage aus Stein und Thon
herrscht der spätergriechische Reliefstil vor, den wir in Rom vor Augustus am
Paris-Münchener Fries und am Grabe des Eurysaces angewandt finden. Am
Friedensfriese ist durch die besondere Aufgabe, in langer Reihe nebeneinander
Schreitende darzustellen, von denen naturgemäß einer tiefer im Grunde, der
andere näher dem Beschauer erscheinen musste, die etwas conventioneile Dar-
stellung von flacher gehaltenen neben runderen Figuren entstanden. In den
kleineren Bildern, wo die Compositionsbedingungen andere sind, verschwindet
jener Schematismus ganz oder größtentheils, wie er z. B. auch in einem andern
Augusteischen Relief, dem ravennatischen, nicht vorhanden ist, da hier alle
Figuren in gleich hohem Relief nebeneinander stehen. Wo die andere Weise
*) Diese sind häufig in den Stucklandschaften und Deckenschmuck Taf. XII ff. Hier begünstigte
des Hauses bei der Farnesina, Lessing-Mau, Wand- freilich die Technik die flottere Behandlung.
stisch behandelten Laubbüscheln (4),1) endlich Heiligthümer (1, ii; 20, 47). Hier
aber wird man sich eines bedeutsamen Unterschiedes bewusst, der sich auch
bei späteren Werken nicht verwischt: dem griechischen Künstler liegt mehr
daran, das Bild der Gottheit zu zeigen als das umgebende Heiligthum (so 49);
in den meisten Fällen stellt er sogar nur das Bild; nicht den Tempel hin. Im
römischen Friese werden uns zwar im Penatentempel auch die Bilder sichtbar
gemacht, aber Mars- und Matertempel stehen verschlossen da, nur die Giebel-
figuren bilden einen gewissen Ersatz für die Götterbilder. Die Tempel sind sogar
frei und unverdeckt durch Figuren, die etwa zur Handlung gehören könnten; sie
sind nicht so sehr umgebende Räumlichkeit, als vielmehr selbst wesentliche
Bestandtheile der Darstellung: dem römischen Geiste war eben die Baukunst weit
congenialer als die Bildkunst, soweit diese nicht Porträts bildete. Ein zweites,
was ebenfalls an diesen Tempeln zutage tritt, ein Grundzug, welcher der römischen
Kunst stets verblieb und einer wirklichen Illusionskunst starken Widerstand
leistete, ist das Bestreben, alle einzelnen Dinge, auf welche es dem Darsteller
oder dem Auftraggeber, wir können vielleicht auch sagen, dem römischen Volk,
besonders ankam, mit rücksichtsloser Deutlichkeit, selbst auf Kosten der Harmonie
des Ganzen, sichtbar zu machen. Die beiden großen Tempel, das Quadergemäuer
daran, der Kranz am Penatentempel sind dafür Beispiele./
Auch den Reliefcharakter haben wir zu vergleichen. Das Flachrelief war in
Griechenland keineswegs das einzige oder auch nur das vorherrschende gewesen,
da sich früh schon die Lust an runderer, mehr körperlicher Bildung auch auf der
Fläche geltend machte. Auf italischem Boden, in Etrurien war es nur kurze Zeit
in beschränkter Geltung; an der Mehrzahl der Sarkophage aus Stein und Thon
herrscht der spätergriechische Reliefstil vor, den wir in Rom vor Augustus am
Paris-Münchener Fries und am Grabe des Eurysaces angewandt finden. Am
Friedensfriese ist durch die besondere Aufgabe, in langer Reihe nebeneinander
Schreitende darzustellen, von denen naturgemäß einer tiefer im Grunde, der
andere näher dem Beschauer erscheinen musste, die etwas conventioneile Dar-
stellung von flacher gehaltenen neben runderen Figuren entstanden. In den
kleineren Bildern, wo die Compositionsbedingungen andere sind, verschwindet
jener Schematismus ganz oder größtentheils, wie er z. B. auch in einem andern
Augusteischen Relief, dem ravennatischen, nicht vorhanden ist, da hier alle
Figuren in gleich hohem Relief nebeneinander stehen. Wo die andere Weise
*) Diese sind häufig in den Stucklandschaften und Deckenschmuck Taf. XII ff. Hier begünstigte
des Hauses bei der Farnesina, Lessing-Mau, Wand- freilich die Technik die flottere Behandlung.