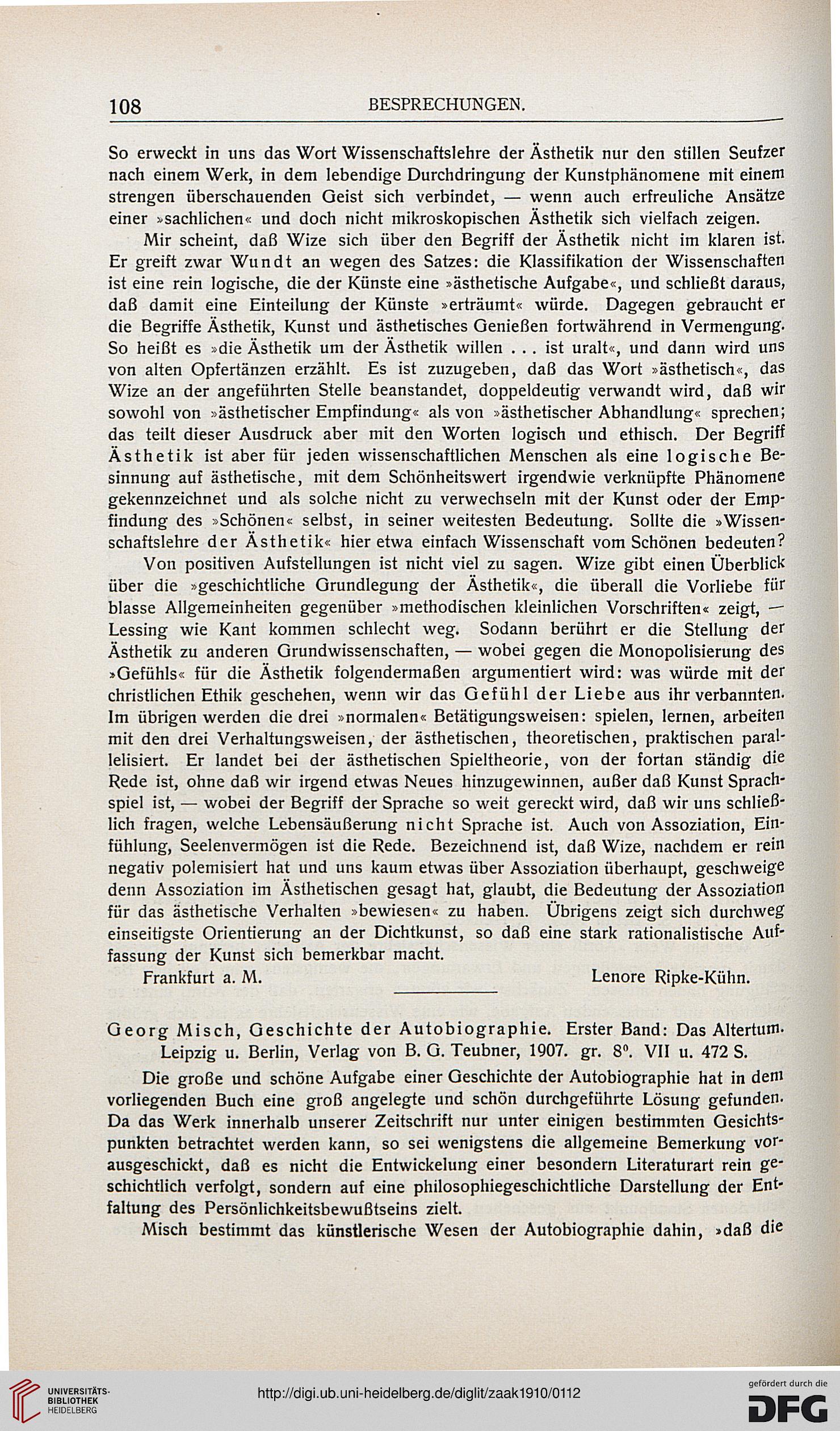108 BESPRECHUNGEN.
So erweckt in uns das Wort Wissenschaftslehre der Ästhetik nur den stillen Seufzer
nach einem Werk, in dem lebendige Durchdringung der Kunstphänomene mit einem
strengen überschauenden Geist sich verbindet, — wenn auch erfreuliche Ansätze
einer »sachlichen« und doch nicht mikroskopischen Ästhetik sich vielfach zeigen.
Mir scheint, daß Wize sich über den Begriff der Ästhetik nicht im klaren ist.
Er greift zwar Wundt an wegen des Satzes: die Klassifikation der Wissenschaften
ist eine rein logische, die der Künste eine »ästhetische Aufgabe«, und schließt daraus,
daß damit eine Einteilung der Künste »erträumt« würde. Dagegen gebraucht er
die Begriffe Ästhetik, Kunst und ästhetisches Genießen fortwährend in Vermengung.
So heißt es »die Ästhetik um der Ästhetik willen ... ist uralt«, und dann wird uns
von alten Opfertänzen erzählt. Es ist zuzugeben, daß das Wort »ästhetisch«, das
Wize an der angeführten Stelle beanstandet, doppeldeutig verwandt wird, daß wir
sowohl von »ästhetischer Empfindung« als von »ästhetischer Abhandlung« sprechen;
das teilt dieser Ausdruck aber mit den Worten logisch und ethisch. Der Begriff
Ästhetik ist aber für jeden wissenschaftlichen Menschen als eine logische Be-
sinnung auf ästhetische, mit dem Schönheitswert irgendwie verknüpfte Phänomene
gekennzeichnet und als solche nicht zu verwechseln mit der Kunst oder der Emp-
findung des »Schönen« selbst, in seiner weitesten Bedeutung. Sollte die »Wissen-
schaftslehre der Ästhetik« hier etwa einfach Wissenschaft vom Schönen bedeuten?
Von positiven Aufstellungen ist nicht viel zu sagen. Wize gibt einen Überblick
über die »geschichtliche Grundlegung der Ästhetik«, die überall die Vorliebe für
blasse Allgemeinheiten gegenüber »methodischen kleinlichen Vorschriften« zeigt, —
Lessing wie Kant kommen schlecht weg. Sodann berührt er die Stellung der
Ästhetik zu anderen Grundwissenschaften, — wobei gegen die Monopolisierung des
»Gefühls« für die Ästhetik folgendermaßen argumentiert wird: was würde mit der
christlichen Ethik geschehen, wenn wir das Gefühl der Liebe aus ihr verbannten.
Im übrigen werden die drei »normalen« Betätigungsweisen: spielen, lernen, arbeiten
mit den drei Verhaltungsweisen, der ästhetischen, theoretischen, praktischen paral-
lelisiert. Er landet bei der ästhetischen Spieltheorie, von der fortan ständig die
Rede ist, ohne daß wir irgend etwas Neues hinzugewinnen, außer daß Kunst Sprach-
spiel ist, — wobei der Begriff der Sprache so weit gereckt wird, daß wir uns schließ-
lich fragen, welche Lebensäußerung nicht Sprache ist. Auch von Assoziation, Ein-
fühlung, Seelenvermögen ist die Rede. Bezeichnend ist, daß Wize, nachdem er rein
negativ polemisiert hat und uns kaum etwas über Assoziation überhaupt, geschweige
denn Assoziation im Ästhetischen gesagt hat, glaubt, die Bedeutung der Assoziation
für das ästhetische Verhalten »bewiesen« zu haben. Übrigens zeigt sich durchweg
einseitigste Orientierung an der Dichtkunst, so daß eine stark rationalistische Auf-
fassung der Kunst sich bemerkbar macht.
Frankfurt a. M. Lenore Ripke-Kühn.
Georg Misch, Geschichte der Autobiographie. Erster Band: Das Altertum-
Leipzig u. Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1907. gr. 8". VII u. 472 S.
Die große und schöne Aufgabe einer Geschichte der Autobiographie hat in dem
vorliegenden Buch eine groß angelegte und schön durchgeführte Lösung gefunden.
Da das Werk innerhalb unserer Zeitschrift nur unter einigen bestimmten Gesichts-
punkten betrachtet werden kann, so sei wenigstens die allgemeine Bemerkung vor-
ausgeschickt, daß es nicht die Entwickelung einer besondern Literaturart rein ge-
schichtlich verfolgt, sondern auf eine philosophiegeschichtliche Darstellung der Ent-
faltung des Persönlichkeitsbewußtseins zielt.
Misch bestimmt das künstlerische Wesen der Autobiographie dahin, >daß die
So erweckt in uns das Wort Wissenschaftslehre der Ästhetik nur den stillen Seufzer
nach einem Werk, in dem lebendige Durchdringung der Kunstphänomene mit einem
strengen überschauenden Geist sich verbindet, — wenn auch erfreuliche Ansätze
einer »sachlichen« und doch nicht mikroskopischen Ästhetik sich vielfach zeigen.
Mir scheint, daß Wize sich über den Begriff der Ästhetik nicht im klaren ist.
Er greift zwar Wundt an wegen des Satzes: die Klassifikation der Wissenschaften
ist eine rein logische, die der Künste eine »ästhetische Aufgabe«, und schließt daraus,
daß damit eine Einteilung der Künste »erträumt« würde. Dagegen gebraucht er
die Begriffe Ästhetik, Kunst und ästhetisches Genießen fortwährend in Vermengung.
So heißt es »die Ästhetik um der Ästhetik willen ... ist uralt«, und dann wird uns
von alten Opfertänzen erzählt. Es ist zuzugeben, daß das Wort »ästhetisch«, das
Wize an der angeführten Stelle beanstandet, doppeldeutig verwandt wird, daß wir
sowohl von »ästhetischer Empfindung« als von »ästhetischer Abhandlung« sprechen;
das teilt dieser Ausdruck aber mit den Worten logisch und ethisch. Der Begriff
Ästhetik ist aber für jeden wissenschaftlichen Menschen als eine logische Be-
sinnung auf ästhetische, mit dem Schönheitswert irgendwie verknüpfte Phänomene
gekennzeichnet und als solche nicht zu verwechseln mit der Kunst oder der Emp-
findung des »Schönen« selbst, in seiner weitesten Bedeutung. Sollte die »Wissen-
schaftslehre der Ästhetik« hier etwa einfach Wissenschaft vom Schönen bedeuten?
Von positiven Aufstellungen ist nicht viel zu sagen. Wize gibt einen Überblick
über die »geschichtliche Grundlegung der Ästhetik«, die überall die Vorliebe für
blasse Allgemeinheiten gegenüber »methodischen kleinlichen Vorschriften« zeigt, —
Lessing wie Kant kommen schlecht weg. Sodann berührt er die Stellung der
Ästhetik zu anderen Grundwissenschaften, — wobei gegen die Monopolisierung des
»Gefühls« für die Ästhetik folgendermaßen argumentiert wird: was würde mit der
christlichen Ethik geschehen, wenn wir das Gefühl der Liebe aus ihr verbannten.
Im übrigen werden die drei »normalen« Betätigungsweisen: spielen, lernen, arbeiten
mit den drei Verhaltungsweisen, der ästhetischen, theoretischen, praktischen paral-
lelisiert. Er landet bei der ästhetischen Spieltheorie, von der fortan ständig die
Rede ist, ohne daß wir irgend etwas Neues hinzugewinnen, außer daß Kunst Sprach-
spiel ist, — wobei der Begriff der Sprache so weit gereckt wird, daß wir uns schließ-
lich fragen, welche Lebensäußerung nicht Sprache ist. Auch von Assoziation, Ein-
fühlung, Seelenvermögen ist die Rede. Bezeichnend ist, daß Wize, nachdem er rein
negativ polemisiert hat und uns kaum etwas über Assoziation überhaupt, geschweige
denn Assoziation im Ästhetischen gesagt hat, glaubt, die Bedeutung der Assoziation
für das ästhetische Verhalten »bewiesen« zu haben. Übrigens zeigt sich durchweg
einseitigste Orientierung an der Dichtkunst, so daß eine stark rationalistische Auf-
fassung der Kunst sich bemerkbar macht.
Frankfurt a. M. Lenore Ripke-Kühn.
Georg Misch, Geschichte der Autobiographie. Erster Band: Das Altertum-
Leipzig u. Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1907. gr. 8". VII u. 472 S.
Die große und schöne Aufgabe einer Geschichte der Autobiographie hat in dem
vorliegenden Buch eine groß angelegte und schön durchgeführte Lösung gefunden.
Da das Werk innerhalb unserer Zeitschrift nur unter einigen bestimmten Gesichts-
punkten betrachtet werden kann, so sei wenigstens die allgemeine Bemerkung vor-
ausgeschickt, daß es nicht die Entwickelung einer besondern Literaturart rein ge-
schichtlich verfolgt, sondern auf eine philosophiegeschichtliche Darstellung der Ent-
faltung des Persönlichkeitsbewußtseins zielt.
Misch bestimmt das künstlerische Wesen der Autobiographie dahin, >daß die