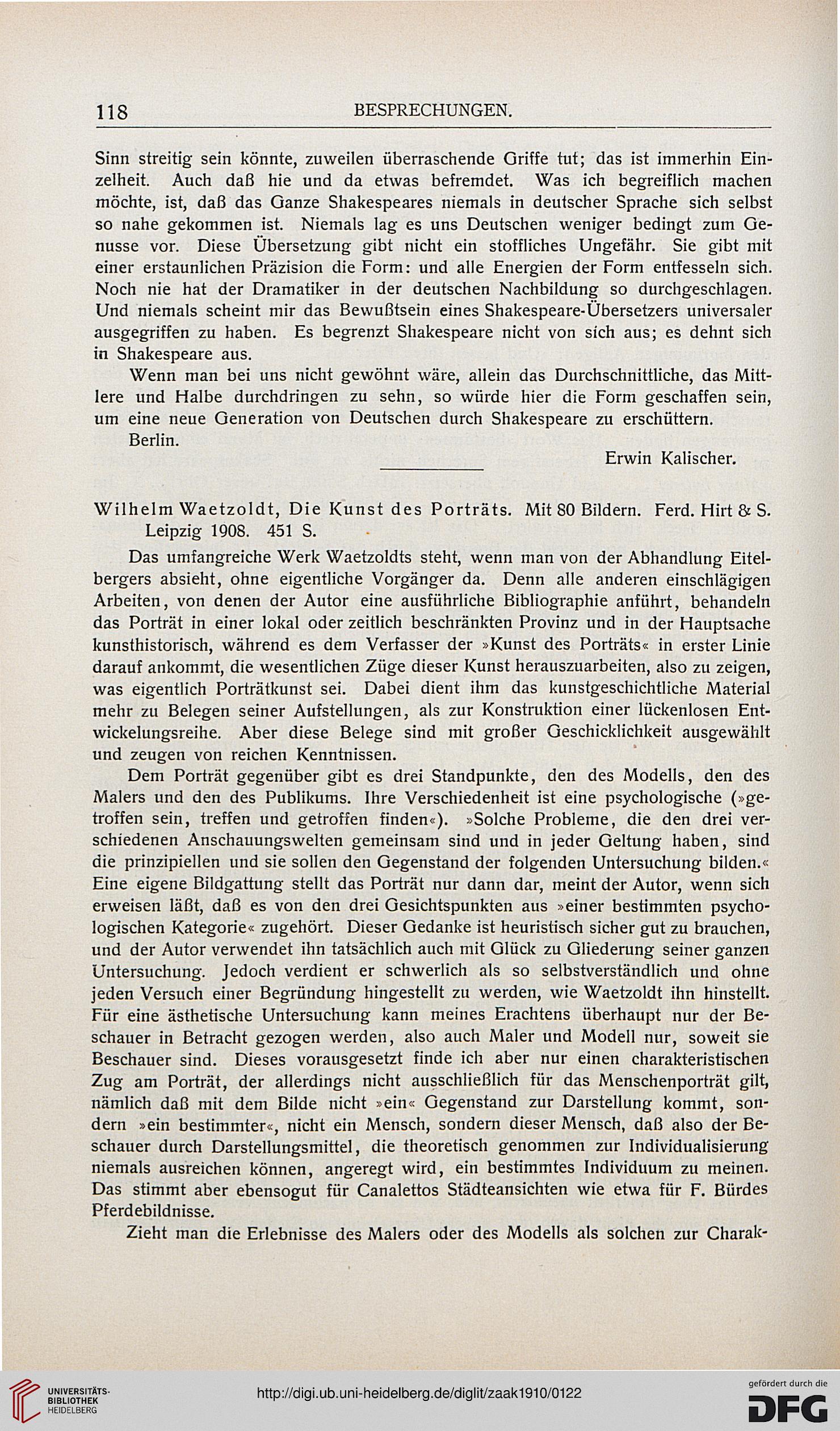118 BESPRECHUNGEN.
Sinn streitig sein könnte, zuweilen überraschende Griffe tut; das ist immerhin Ein-
zelheit. Auch daß hie und da etwas befremdet. Was ich begreiflich machen
möchte, ist, daß das Ganze Shakespeares niemals in deutscher Sprache sich selbst
so nahe gekommen ist. Niemals lag es uns Deutschen weniger bedingt zum Ge-
nüsse vor. Diese Übersetzung gibt nicht ein stoffliches Ungefähr. Sie gibt mit
einer erstaunlichen Präzision die Form: und alle Energien der Form entfesseln sich.
Noch nie hat der Dramatiker in der deutschen Nachbildung so durchgeschlagen.
Und niemals scheint mir das Bewußtsein eines Shakespeare-Übersetzers universaler
ausgegriffen zu haben. Es begrenzt Shakespeare nicht von sich aus; es dehnt sich
in Shakespeare aus.
Wenn man bei uns nicht gewöhnt wäre, allein das Durchschnittliche, das Mitt-
lere und Halbe durchdringen zu sehn, so würde hier die Form geschaffen sein,
um eine neue Generation von Deutschen durch Shakespeare zu erschüttern.
Berlin.
____________ Erwin Kalischer.
Wilhelm Waetzoldt, Die Kunst des Porträts. Mit 80 Bildern. Ferd. Hirt & S.
Leipzig 1908. 451 S.
Das umfangreiche Werk Waetzoldts steht, wenn man von der Abhandlung Eitel-
bergers absieht, ohne eigentliche Vorgänger da. Denn alle anderen einschlägigen
Arbeiten, von denen der Autor eine ausführliche Bibliographie anführt, behandeln
das Porträt in einer lokal oder zeitlich beschränkten Provinz und in der Hauptsache
kunsthistorisch, während es dem Verfasser der »Kunst des Porträts« in erster Linie
darauf ankommt, die wesentlichen Züge dieser Kunst herauszuarbeiten, also zu zeigen,
was eigentlich Porträtkunst sei. Dabei dient ihm das kunstgeschichtliche Material
mehr zu Belegen seiner Aufstellungen, als zur Konstruktion einer lückenlosen Ent-
wickelungsreihe. Aber diese Belege sind mit großer Geschicklichkeit ausgewählt
und zeugen von reichen Kenntnissen.
Dem Porträt gegenüber gibt es drei Standpunkte, den des Modells, den des
Malers und den des Publikums. Ihre Verschiedenheit ist eine psychologische (»ge-
troffen sein, treffen und getroffen finden«). »Solche Probleme, die den drei ver-
schiedenen Anschauungswelten gemeinsam sind und in jeder Geltung haben, sind
die prinzipiellen und sie sollen den Gegenstand der folgenden Untersuchung bilden.«
Eine eigene Bildgattung stellt das Porträt nur dann dar, meint der Autor, wenn sich
erweisen läßt, daß es von den drei Gesichtspunkten aus »einer bestimmten psycho-
logischen Kategorie« zugehört. Dieser Gedanke ist heuristisch sicher gut zu brauchen,
und der Autor verwendet ihn tatsächlich auch mit Glück zu Gliederung seiner ganzen
Untersuchung. Jedoch verdient er schwerlich als so selbstverständlich und ohne
jeden Versuch einer Begründung hingestellt zu werden, wie Waetzoldt ihn hinstellt.
Für eine ästhetische Untersuchung kann meines Erachtens überhaupt nur der Be-
schauer in Betracht gezogen werden, also auch Maler und Modell nur, soweit sie
Beschauer sind. Dieses vorausgesetzt finde ich aber nur einen charakteristischen
Zug am Porträt, der allerdings nicht ausschließlich für das Menschenporträt gilt,
nämlich daß mit dem Bilde nicht »ein« Gegenstand zur Darstellung kommt, son-
dern »ein bestimmter«, nicht ein Mensch, sondern dieser Mensch, daß also der Be-
schauer durch Darstellungsmittel, die theoretisch genommen zur Individualisierung
niemals ausreichen können, angeregt wird, ein bestimmtes Individuum zu meinen.
Das stimmt aber ebensogut für Canalettos Städteansichten wie etwa für F. Bürdes
Pferdebildnisse.
Zieht man die Erlebnisse des Malers oder des Modells als solchen zur Charak-
Sinn streitig sein könnte, zuweilen überraschende Griffe tut; das ist immerhin Ein-
zelheit. Auch daß hie und da etwas befremdet. Was ich begreiflich machen
möchte, ist, daß das Ganze Shakespeares niemals in deutscher Sprache sich selbst
so nahe gekommen ist. Niemals lag es uns Deutschen weniger bedingt zum Ge-
nüsse vor. Diese Übersetzung gibt nicht ein stoffliches Ungefähr. Sie gibt mit
einer erstaunlichen Präzision die Form: und alle Energien der Form entfesseln sich.
Noch nie hat der Dramatiker in der deutschen Nachbildung so durchgeschlagen.
Und niemals scheint mir das Bewußtsein eines Shakespeare-Übersetzers universaler
ausgegriffen zu haben. Es begrenzt Shakespeare nicht von sich aus; es dehnt sich
in Shakespeare aus.
Wenn man bei uns nicht gewöhnt wäre, allein das Durchschnittliche, das Mitt-
lere und Halbe durchdringen zu sehn, so würde hier die Form geschaffen sein,
um eine neue Generation von Deutschen durch Shakespeare zu erschüttern.
Berlin.
____________ Erwin Kalischer.
Wilhelm Waetzoldt, Die Kunst des Porträts. Mit 80 Bildern. Ferd. Hirt & S.
Leipzig 1908. 451 S.
Das umfangreiche Werk Waetzoldts steht, wenn man von der Abhandlung Eitel-
bergers absieht, ohne eigentliche Vorgänger da. Denn alle anderen einschlägigen
Arbeiten, von denen der Autor eine ausführliche Bibliographie anführt, behandeln
das Porträt in einer lokal oder zeitlich beschränkten Provinz und in der Hauptsache
kunsthistorisch, während es dem Verfasser der »Kunst des Porträts« in erster Linie
darauf ankommt, die wesentlichen Züge dieser Kunst herauszuarbeiten, also zu zeigen,
was eigentlich Porträtkunst sei. Dabei dient ihm das kunstgeschichtliche Material
mehr zu Belegen seiner Aufstellungen, als zur Konstruktion einer lückenlosen Ent-
wickelungsreihe. Aber diese Belege sind mit großer Geschicklichkeit ausgewählt
und zeugen von reichen Kenntnissen.
Dem Porträt gegenüber gibt es drei Standpunkte, den des Modells, den des
Malers und den des Publikums. Ihre Verschiedenheit ist eine psychologische (»ge-
troffen sein, treffen und getroffen finden«). »Solche Probleme, die den drei ver-
schiedenen Anschauungswelten gemeinsam sind und in jeder Geltung haben, sind
die prinzipiellen und sie sollen den Gegenstand der folgenden Untersuchung bilden.«
Eine eigene Bildgattung stellt das Porträt nur dann dar, meint der Autor, wenn sich
erweisen läßt, daß es von den drei Gesichtspunkten aus »einer bestimmten psycho-
logischen Kategorie« zugehört. Dieser Gedanke ist heuristisch sicher gut zu brauchen,
und der Autor verwendet ihn tatsächlich auch mit Glück zu Gliederung seiner ganzen
Untersuchung. Jedoch verdient er schwerlich als so selbstverständlich und ohne
jeden Versuch einer Begründung hingestellt zu werden, wie Waetzoldt ihn hinstellt.
Für eine ästhetische Untersuchung kann meines Erachtens überhaupt nur der Be-
schauer in Betracht gezogen werden, also auch Maler und Modell nur, soweit sie
Beschauer sind. Dieses vorausgesetzt finde ich aber nur einen charakteristischen
Zug am Porträt, der allerdings nicht ausschließlich für das Menschenporträt gilt,
nämlich daß mit dem Bilde nicht »ein« Gegenstand zur Darstellung kommt, son-
dern »ein bestimmter«, nicht ein Mensch, sondern dieser Mensch, daß also der Be-
schauer durch Darstellungsmittel, die theoretisch genommen zur Individualisierung
niemals ausreichen können, angeregt wird, ein bestimmtes Individuum zu meinen.
Das stimmt aber ebensogut für Canalettos Städteansichten wie etwa für F. Bürdes
Pferdebildnisse.
Zieht man die Erlebnisse des Malers oder des Modells als solchen zur Charak-