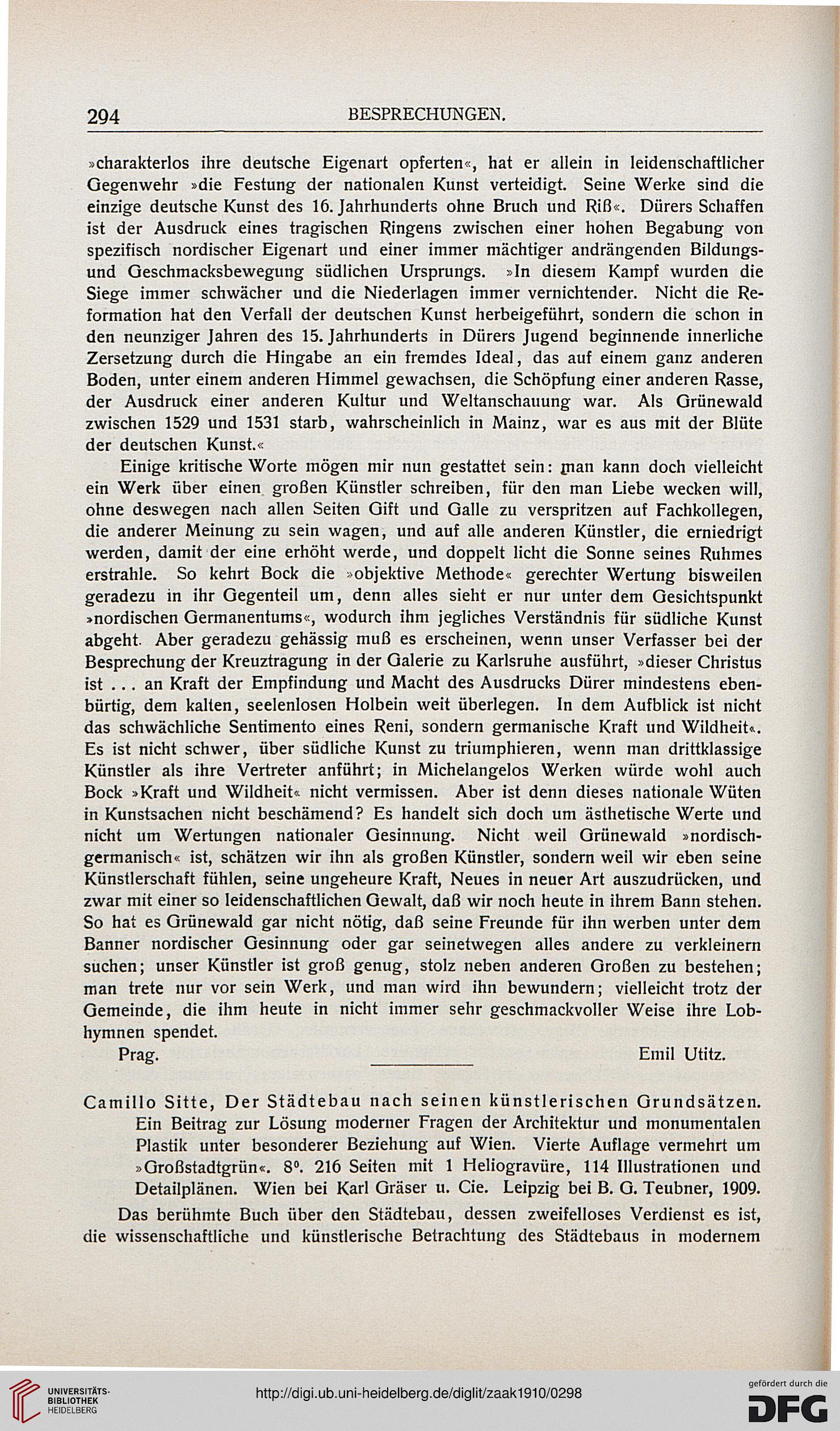294 BESPRECHUNGEN.
»charakterlos ihre deutsche Eigenart opferten«, hat er aliein in leidenschaftlicher
Gegenwehr »die Festung der nationalen Kunst verteidigt. Seine Werke sind die
einzige deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts ohne Bruch und Riß«. Dürers Schaffen
ist der Ausdruck eines tragischen Ringens zwischen einer hohen Begabung von
spezifisch nordischer Eigenart und einer immer mächtiger andrängenden Bildungs-
und Geschmacksbewegung südlichen Ursprungs. »In diesem Kampf wurden die
Siege immer schwächer und die Niederlagen immer vernichtender. Nicht die Re-
formation hat den Verfall der deutschen Kunst herbeigeführt, sondern die schon in
den neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts in Dürers Jugend beginnende innerliche
Zersetzung durch die Hingabe an ein fremdes Ideal, das auf einem ganz anderen
Boden, unter einem anderen Himmel gewachsen, die Schöpfung einer anderen Rasse,
der Ausdruck einer anderen Kultur und Weltanschauung war. Als Grünewald
zwischen 1529 und 1531 starb, wahrscheinlich in Mainz, war es aus mit der Blüte
der deutschen Kunst.«
Einige kritische Worte mögen mir nun gestattet sein: pian kann doch vielleicht
ein Werk über einen großen Künstler schreiben, für den man Liebe wecken will,
ohne deswegen nach allen Seiten Gift und Galle zu verspritzen auf Fachkollegen,
die anderer Meinung zu sein wagen, und auf alle anderen Künstler, die erniedrigt
werden, damit der eine erhöht werde, und doppelt licht die Sonne seines Ruhmes
erstrahle. So kehrt Bock die objektive Methode« gerechter Wertung bisweilen
geradezu in ihr Gegenteil um, denn alles sieht er nur unter dem Gesichtspunkt
»nordischen Germanentums«, wodurch ihm jegliches Verständnis für südliche Kunst
abgeht. Aber geradezu gehässig muß es erscheinen, wenn unser Verfasser bei der
Besprechung der Kreuztragung in der Galerie zu Karlsruhe ausführt, »dieser Christus
ist ... an Kraft der Empfindung und Macht des Ausdrucks Dürer mindestens eben-
bürtig, dem kalten, seelenlosen Holbein weit überlegen. In dem Auf blick ist nicht
das schwächliche Sentimento eines Reni, sondern germanische Kraft und Wildheit*.
Es ist nicht schwer, über südliche Kunst zu triumphieren, wenn man drittklassige
Künstler als ihre Vertreter anführt; in Michelangelos Werken würde wohl auch
Bock »Kraft und Wildheit« nicht vermissen. Aber ist denn dieses nationale Wüten
in Kunstsachen nicht beschämend? Es handelt sich doch um ästhetische Werte und
nicht um Wertungen nationaler Gesinnung. Nicht weil Grünewald »nordisch-
germanisch« ist, schätzen wir ihn als großen Künstler, sondern weil wir eben seine
Künstlerschaft fühlen, seine ungeheure Kraft, Neues in neuer Art auszudrücken, und
zwar mit einer so leidenschaftlichen Gewalt, daß wir noch heute in ihrem Bann stehen.
So hat es Grünewald gar nicht nötig, daß seine Freunde für ihn werben unter dem
Banner nordischer Gesinnung oder gar seinetwegen alles andere zu verkleinern
suchen; unser Künstler ist groß genug, stolz neben anderen Großen zu bestehen;
man trete nur vor sein Werk, und man wird ihn bewundern; vielleicht trotz der
Gemeinde, die ihm heute in nicht immer sehr geschmackvoller Weise ihre Lob-
hymnen spendet.
Prag. ____________ Emil Utitz.
Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen.
Ein Beitrag zur Lösung moderner Fragen der Architektur und monumentalen
Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien. Vierte Auflage vermehrt um
»Großstadtgrün«. 8°. 216 Seiten mit 1 Heliogravüre, 114 Illustrationen und
Detailplänen. Wien bei Karl Gräser u. Cie. Leipzig bei B. G. Teubner, 1909.
Das berühmte Buch über den Städtebau, dessen zweifelloses Verdienst es ist,
die wissenschaftliche und künstlerische Betrachtung des Städtebaus in modernem
»charakterlos ihre deutsche Eigenart opferten«, hat er aliein in leidenschaftlicher
Gegenwehr »die Festung der nationalen Kunst verteidigt. Seine Werke sind die
einzige deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts ohne Bruch und Riß«. Dürers Schaffen
ist der Ausdruck eines tragischen Ringens zwischen einer hohen Begabung von
spezifisch nordischer Eigenart und einer immer mächtiger andrängenden Bildungs-
und Geschmacksbewegung südlichen Ursprungs. »In diesem Kampf wurden die
Siege immer schwächer und die Niederlagen immer vernichtender. Nicht die Re-
formation hat den Verfall der deutschen Kunst herbeigeführt, sondern die schon in
den neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts in Dürers Jugend beginnende innerliche
Zersetzung durch die Hingabe an ein fremdes Ideal, das auf einem ganz anderen
Boden, unter einem anderen Himmel gewachsen, die Schöpfung einer anderen Rasse,
der Ausdruck einer anderen Kultur und Weltanschauung war. Als Grünewald
zwischen 1529 und 1531 starb, wahrscheinlich in Mainz, war es aus mit der Blüte
der deutschen Kunst.«
Einige kritische Worte mögen mir nun gestattet sein: pian kann doch vielleicht
ein Werk über einen großen Künstler schreiben, für den man Liebe wecken will,
ohne deswegen nach allen Seiten Gift und Galle zu verspritzen auf Fachkollegen,
die anderer Meinung zu sein wagen, und auf alle anderen Künstler, die erniedrigt
werden, damit der eine erhöht werde, und doppelt licht die Sonne seines Ruhmes
erstrahle. So kehrt Bock die objektive Methode« gerechter Wertung bisweilen
geradezu in ihr Gegenteil um, denn alles sieht er nur unter dem Gesichtspunkt
»nordischen Germanentums«, wodurch ihm jegliches Verständnis für südliche Kunst
abgeht. Aber geradezu gehässig muß es erscheinen, wenn unser Verfasser bei der
Besprechung der Kreuztragung in der Galerie zu Karlsruhe ausführt, »dieser Christus
ist ... an Kraft der Empfindung und Macht des Ausdrucks Dürer mindestens eben-
bürtig, dem kalten, seelenlosen Holbein weit überlegen. In dem Auf blick ist nicht
das schwächliche Sentimento eines Reni, sondern germanische Kraft und Wildheit*.
Es ist nicht schwer, über südliche Kunst zu triumphieren, wenn man drittklassige
Künstler als ihre Vertreter anführt; in Michelangelos Werken würde wohl auch
Bock »Kraft und Wildheit« nicht vermissen. Aber ist denn dieses nationale Wüten
in Kunstsachen nicht beschämend? Es handelt sich doch um ästhetische Werte und
nicht um Wertungen nationaler Gesinnung. Nicht weil Grünewald »nordisch-
germanisch« ist, schätzen wir ihn als großen Künstler, sondern weil wir eben seine
Künstlerschaft fühlen, seine ungeheure Kraft, Neues in neuer Art auszudrücken, und
zwar mit einer so leidenschaftlichen Gewalt, daß wir noch heute in ihrem Bann stehen.
So hat es Grünewald gar nicht nötig, daß seine Freunde für ihn werben unter dem
Banner nordischer Gesinnung oder gar seinetwegen alles andere zu verkleinern
suchen; unser Künstler ist groß genug, stolz neben anderen Großen zu bestehen;
man trete nur vor sein Werk, und man wird ihn bewundern; vielleicht trotz der
Gemeinde, die ihm heute in nicht immer sehr geschmackvoller Weise ihre Lob-
hymnen spendet.
Prag. ____________ Emil Utitz.
Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen.
Ein Beitrag zur Lösung moderner Fragen der Architektur und monumentalen
Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien. Vierte Auflage vermehrt um
»Großstadtgrün«. 8°. 216 Seiten mit 1 Heliogravüre, 114 Illustrationen und
Detailplänen. Wien bei Karl Gräser u. Cie. Leipzig bei B. G. Teubner, 1909.
Das berühmte Buch über den Städtebau, dessen zweifelloses Verdienst es ist,
die wissenschaftliche und künstlerische Betrachtung des Städtebaus in modernem