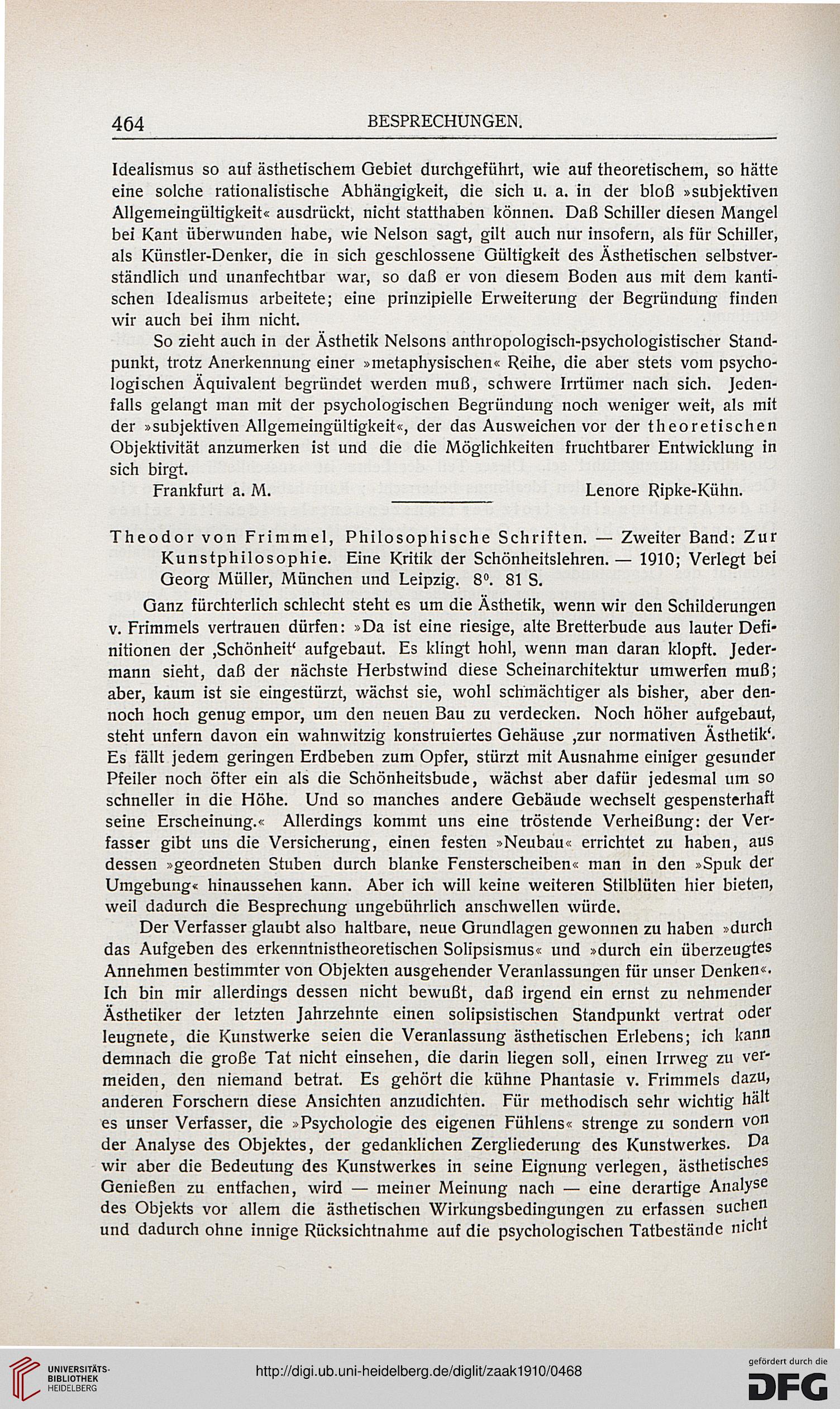464 BESPRECHUNGEN.
Idealismus so auf ästhetischem Gebiet durchgeführt, wie auf theoretischem, so hätte
eine solche rationalistische Abhängigkeit, die sich u. a. in der bloß »subjektiven
Allgemeingültigkeit« ausdrückt, nicht statthaben können. Daß Schiller diesen Mangel
bei Kant überwunden habe, wie Nelson sagt, gilt auch nur insofern, als für Schiller,
als Künstler-Denker, die in sich geschlossene Gültigkeit des Ästhetischen selbstver-
ständlich und unanfechtbar war, so daß er von diesem Boden aus mit dem kanti-
schen Idealismus arbeitete; eine prinzipielle Erweiterung der Begründung finden
wir auch bei ihm nicht.
So zieht auch in der Ästhetik Nelsons anthropologisch-psychologistischer Stand-
punkt, trotz Anerkennung einer »metaphysischen« Reihe, die aber stets vom psycho-
logischen Äquivalent begründet werden muß, schwere Irrtümer nach sich. Jeden-
falls gelangt man mit der psychologischen Begründung noch weniger weit, als mit
der »subjektiven Allgemeingültigkeit«, der das Ausweichen vor der theoretischen
Objektivität anzumerken ist und die die Möglichkeiten fruchtbarer Entwicklung in
sich birgt.
Frankfurt a. M. Lenore Ripke-Kühn.
Theodor von Frimmel, Philosophische Schriften. — Zweiter Band: Zur
Kunstphilosophie. Eine Kritik der Schönheitslehren.— 1910; Verlegt bei
Georg Müller, München und Leipzig. 8°. 81 S.
Ganz fürchterlich schlecht steht es um die Ästhetik, wenn wir den Schilderungen
v. Frimmels vertrauen dürfen: »Da ist eine riesige, alte Bretterbude aus lauter Defi-
nitionen der ,Schönheit' aufgebaut. Es klingt hohl, wenn man daran klopft. Jeder-
mann sieht, daß der nächste Herbstwind diese Scheinarchitektur umwerfen muß;
aber, kaum ist sie eingestürzt, wächst sie, wohl schmächtiger als bisher, aber den-
noch hoch genug empor, um den neuen Bau zu verdecken. Noch höher aufgebaut,
steht unfern davon ein wahnwitzig konstruiertes Gehäuse ,zur normativen Ästhetik'.
Es fällt jedem geringen Erdbeben zum Opfer, stürzt mit Ausnahme einiger gesunder
Pfeiler noch öfter ein als die Schönheitsbude, wächst aber dafür jedesmal um so
schneller in die Höhe. Und so manches andere Gebäude wechselt gespensterhaft
seine Erscheinung.« Allerdings kommt uns eine tröstende Verheißung: der Ver-
fasser gibt uns die Versicherung, einen festen »Neubau« errichtet zu haben, aus
dessen »geordneten Stuben durch blanke Fensterscheiben« man in den »Spuk der
Umgebung« hinaussehen kann. Aber ich will keine weiteren Stilblüten hier bieten,
weil dadurch die Besprechung ungebührlich anschwellen würde.
Der Verfasser glaubt also haltbare, neue Grundlagen gewonnen zu haben »durch
das Aufgeben des erkenntnistheoretischen Solipsismus« und »durch ein überzeugtes
Annehmen bestimmter von Objekten ausgehender Veranlassungen für unser Denken«.
Ich bin mir allerdings dessen nicht bewußt, daß irgend ein ernst zu nehmender
Ästhetiker der letzten Jahrzehnte einen solipsistischen Standpunkt vertrat oder
leugnete, die Kunstwerke seien die Veranlassung ästhetischen Erlebens; ich kann
demnach die große Tat nicht einsehen, die darin liegen soll, einen Irrweg zu ver-
meiden, den niemand betrat. Es gehört die kühne Phantasie v. Frimmels dazu,
anderen Forschern diese Ansichten anzudichten. Für methodisch sehr wichtig hält
es unser Verfasser, die »Psychologie des eigenen Fühlens« strenge zu sondern von
der Analyse des Objektes, der gedanklichen Zergliederung des Kunstwerkes. Da
wir aber die Bedeutung des Kunstwerkes in seine Eignung verlegen, ästhetisches
Genießen zu entfachen, wird — meiner Meinung nach — eine derartige Analyse
des Objekts vor allem die ästhetischen Wirkungsbedingungen zu erfassen suchen
und dadurch ohne innige Rücksichtnahme auf die psychologischen Tatbestände nicht
Idealismus so auf ästhetischem Gebiet durchgeführt, wie auf theoretischem, so hätte
eine solche rationalistische Abhängigkeit, die sich u. a. in der bloß »subjektiven
Allgemeingültigkeit« ausdrückt, nicht statthaben können. Daß Schiller diesen Mangel
bei Kant überwunden habe, wie Nelson sagt, gilt auch nur insofern, als für Schiller,
als Künstler-Denker, die in sich geschlossene Gültigkeit des Ästhetischen selbstver-
ständlich und unanfechtbar war, so daß er von diesem Boden aus mit dem kanti-
schen Idealismus arbeitete; eine prinzipielle Erweiterung der Begründung finden
wir auch bei ihm nicht.
So zieht auch in der Ästhetik Nelsons anthropologisch-psychologistischer Stand-
punkt, trotz Anerkennung einer »metaphysischen« Reihe, die aber stets vom psycho-
logischen Äquivalent begründet werden muß, schwere Irrtümer nach sich. Jeden-
falls gelangt man mit der psychologischen Begründung noch weniger weit, als mit
der »subjektiven Allgemeingültigkeit«, der das Ausweichen vor der theoretischen
Objektivität anzumerken ist und die die Möglichkeiten fruchtbarer Entwicklung in
sich birgt.
Frankfurt a. M. Lenore Ripke-Kühn.
Theodor von Frimmel, Philosophische Schriften. — Zweiter Band: Zur
Kunstphilosophie. Eine Kritik der Schönheitslehren.— 1910; Verlegt bei
Georg Müller, München und Leipzig. 8°. 81 S.
Ganz fürchterlich schlecht steht es um die Ästhetik, wenn wir den Schilderungen
v. Frimmels vertrauen dürfen: »Da ist eine riesige, alte Bretterbude aus lauter Defi-
nitionen der ,Schönheit' aufgebaut. Es klingt hohl, wenn man daran klopft. Jeder-
mann sieht, daß der nächste Herbstwind diese Scheinarchitektur umwerfen muß;
aber, kaum ist sie eingestürzt, wächst sie, wohl schmächtiger als bisher, aber den-
noch hoch genug empor, um den neuen Bau zu verdecken. Noch höher aufgebaut,
steht unfern davon ein wahnwitzig konstruiertes Gehäuse ,zur normativen Ästhetik'.
Es fällt jedem geringen Erdbeben zum Opfer, stürzt mit Ausnahme einiger gesunder
Pfeiler noch öfter ein als die Schönheitsbude, wächst aber dafür jedesmal um so
schneller in die Höhe. Und so manches andere Gebäude wechselt gespensterhaft
seine Erscheinung.« Allerdings kommt uns eine tröstende Verheißung: der Ver-
fasser gibt uns die Versicherung, einen festen »Neubau« errichtet zu haben, aus
dessen »geordneten Stuben durch blanke Fensterscheiben« man in den »Spuk der
Umgebung« hinaussehen kann. Aber ich will keine weiteren Stilblüten hier bieten,
weil dadurch die Besprechung ungebührlich anschwellen würde.
Der Verfasser glaubt also haltbare, neue Grundlagen gewonnen zu haben »durch
das Aufgeben des erkenntnistheoretischen Solipsismus« und »durch ein überzeugtes
Annehmen bestimmter von Objekten ausgehender Veranlassungen für unser Denken«.
Ich bin mir allerdings dessen nicht bewußt, daß irgend ein ernst zu nehmender
Ästhetiker der letzten Jahrzehnte einen solipsistischen Standpunkt vertrat oder
leugnete, die Kunstwerke seien die Veranlassung ästhetischen Erlebens; ich kann
demnach die große Tat nicht einsehen, die darin liegen soll, einen Irrweg zu ver-
meiden, den niemand betrat. Es gehört die kühne Phantasie v. Frimmels dazu,
anderen Forschern diese Ansichten anzudichten. Für methodisch sehr wichtig hält
es unser Verfasser, die »Psychologie des eigenen Fühlens« strenge zu sondern von
der Analyse des Objektes, der gedanklichen Zergliederung des Kunstwerkes. Da
wir aber die Bedeutung des Kunstwerkes in seine Eignung verlegen, ästhetisches
Genießen zu entfachen, wird — meiner Meinung nach — eine derartige Analyse
des Objekts vor allem die ästhetischen Wirkungsbedingungen zu erfassen suchen
und dadurch ohne innige Rücksichtnahme auf die psychologischen Tatbestände nicht